Die neue Regierung muss der veränderten Realität, die Trump mit der Einführung von Zöllen auf Autoimporte geschaffen hat, Rechnung tragen. Das bedeutet grundsätzlich, der deutschen Autoindustrie keine zusätzlichen Belastungen aufzuerlegen, sondern für Entlastungen zu sorgen.

 IMAGO / Joerg Boethling
IMAGO / Joerg Boethling
Der Entwurf des Koalitionsvertrags steht inzwischen, Details sind bekannt, wenn auch nicht alle. In der Autoindustrie herrscht schon jetzt große Skepsis. Dazu als Beispiel der Zentralverband des Kfz-Gewerbes (VDK): „Mittelstand muss Vorteile wie Goldstaub suchen“.
Zu allem Übel hat der amerikanische Präsident Donald Trump sektorale Sonderzölle von zusätzlich 25 Prozent ab dem 2. April 2025 zeitlich unbegrenzt eingeführt: auf sämtliche Autoimporte, auch aus Kanada und Mexiko. Davon ist mit rund 7,23 Millionen in etwa die Hälfte aller in USA verkauften Autos betroffen: Im Jahr 2024 kamen 2,20 Millionen aus Mexiko, 0,72 Millionen aus Kanada, 0,82 aus der EU und 0,45 aus Deutschland (Quelle: JATO, VDA)
Die Geschäftsgrundlagen, vor allem für die deutsche Autoindustrie, haben sich dadurch nachhaltig verschlechtert. Bei einzelnen Herstellern wie Porsche gehen die Zölle an die Substanz.
Merkantilistische Politik: Keiner gewinnt, alle verlieren
Der amerikanische „Tariff-man“ aus dem Weißen Haus möchte den 2. April als „Tag der Befreiung Amerikas“ feiern. Amerikas Autoindustrie soll aus „Gründen der nationalen Sicherheit“ geschützt, die US-Handelsbilanz aus den roten Zahlen herausgeholt und vor allem ausländische Hersteller dazu bewegt werden, ihre Produktion nach Amerika zu verlagern. Nur wer innerhalb der Grenzen der USA produziert, bleibt von den Zöllen verschont. Sonderzölle werden deshalb auch auf Autoteile wie „Motoren, Getriebe, Teile des Antriebsstrangs und elektrische Komponenten“ erhoben, um zu verhindern, dass diese in USA nur zusammengeschraubt werden.
Als lobendes Beispiel für seine Absicht führt Trump den japanischen Hersteller Honda an, der derzeit eine seiner größten Fabriken in den USA baut. Vermutlich mit Absicht unterschlägt er dabei den Hersteller BMW, der mit einer Jahreskapazität von über 400.000 Einheiten sein größtes Werk weltweit in Spartanburg (South Carolina) betreibt und weiter ausbaut; und zum größten Autoexporteur der USA aufgestiegen ist.
Die merkantilistische Politik von Präsident Trump ist volkswirtschaftlicher Unfug, weil sie die Inflation in den USA ankurbelt, das Wachstum bremst, die Realeinkommen der amerikanischen Verbraucher senkt und deren Arbeitsplätze gefährdet, das Handelsbilanzdefizit zunächst nur vergrößert und international potenziell einen Handelskrieg mit katastrophalem Ausgang auch für die US-Wirtschaft nach sich ziehen wird. Keiner gewinnt, alle verlieren.
Solche Konsequenzen nimmt Trump – Stand heute – offensichtlich in Kauf. Mit den Zolleinnahmen plant Trump, die im Wahlkampf versprochene Steuersenkung zu finanzieren. Bezeichnend ist die Reaktion der US-Automobilarbeiter-Gewerkschaft, die verkündete: „Wir applaudieren der Trump-Regierung, dass sie sich dafür einsetzt, das Freihandeldesaster zu beenden, das jahrzehntelang die Arbeiterklasse belastet hat“ (UAW-Präsident Shawn Fain).
Getroffen sind von den Sonderzöllen alle Automobilimporteure, auch die US-Hersteller GM, Ford selber und Stellantis mit seiner Fiat-Division, Letzterer allerdings nur mit geringen Stückzahlen. Ohne Zollbelastung bleiben nur Elektroauto-Hersteller Tesla und Rivian, Partner von VW mit bislang geringen Stückzahlen, aber umso höheren Verlusten. Tesla selber ist sogar Profiteur der Sonderzölle, da Tesla alle in USA verkauften Autos ausschließlich aus einer seiner sechs amerikanischen Fabriken beliefern lässt, und lediglich über importierte Zulieferteile betroffen ist.
Folgen der Sonderzölle für die deutsche Autoindustrie
Der US-Präsident hat mit den Sonderzöllen die Axt an den freien Welthandel gelegt, der für die deutsche Volkswirtschaft mit einem Wertschöpfungsanteil von 40 Prozent bisher Geschäfts- und Wohlstandsgrundlage gewesen ist. Doch das ist noch nicht das Ende der präsidialen Protektionismus-Fahnenstange. Reziproke Zölle auf alle Einfuhren aus dem Ausland in dem Maße, wie andere Länder amerikanische Produkte durch Zölle und sonstige Handelshemmnisse verteuern, ab Anfang April sind bereits angekündigt. Die Folgen dürfte vor allem die deutsche Wirtschaft zu spüren bekommen. Mit einem Exportanteil am Bruttoinlandsprodukt von 42 Prozent ist Deutschland abhängig von ausländischen Märkten wie kaum eine andere große Volkswirtschaft.
Für die deutschen Automobilhersteller sind die USA der größte Exportmarkt. Die Abhängigkeitsquoten in Prozent des Gesamtabsatzes (und in Klammern die in USA verkauften Autos) im Einzelnen (Quelle: Automobilwoche):
- Porsche: 27,9 Prozent (86.541)
- BMW: 16,2 Prozent (397.652)
- Audi: 14,4 Prozent (240.771)
- Mercedes: 13,6 Prozent (324.500)
- VW: 7,9 Prozent (379.178)
Diese Zahlen lassen erahnen, welche heftigen Folgen die Trumpschen Sonderzölle für die deutsche Autoindustrie haben. In kein anderes Land der Welt liefern die deutschen Hersteller mehr Autos als nach Amerika. Im Jahr 2024 gingen 446.000 Fahrzeuge made in Germany in die USA, das waren 13,1 Prozent aller deutschen Autoexporte (nach Großbritannien 11,3 Prozent, nach Frankreich 7,4 Prozent); BMW verkaufte jede sechste Karosse im Auslandsgeschäft in Amerika, Porsche sogar jede dritte.
Aus der EU als Produktionsort stammten 2024 in Summe nur rund 5 Prozent (821.000 Einheiten) aller am US-Markt verkauften Autos. Das waren nur knapp ein Drittel (13,6 Prozent) der Autos, die von Herstellern aus aller Welt aus Mexiko in die USA exportiert wurden, darunter alle deutschen Hersteller. Umgekehrt exportierten die USA 2024 nur 217.000 Autos nach Europa, davon allein 90.000 aus dem BMW-Werk in Spartanburg. US-Hersteller spielen aufgrund des völlig andersartigen Angebotes weit jenseits europäischer Kundenwünsche als Importeure in Europa keine Rolle. Selbst die europäischen Automobiltöchter Ford und Opel konnten trotz langer Tradition mit dem Wettbewerb in Europa nicht mithalten. GM hat Europa bereits verlassen, Ford ist dabei, sich zu verzwergen – insgesamt ein Trauerspiel.
Gegenzölle auf Auto-Importe aus den USA sind mangels Masse als Abwehrmittel der EU völlig ungeeignet. Deutsche Hersteller wie BMW würden paradoxerweise vollends zwischen die Zoll-Mühlsteine dieseits und jenseits des Atlantiks geraten.
Zölle treffen deutsche Autoindustrie in ohnehin turbulenten Zeiten
Am stärksten von den Trumpschen Strafzöllen sind die Premium-Hersteller Porsche, Mercedes, Porsche und Audi betroffen, weniger BMW aufgrund seines Werkes in Spartanburg. Mercedes hat – wie VW in Chattanooga (Tennessee) und BMW in Spartanburg, ein großes Werk in Tuscaloosa (Alabama), dennoch werden vor allem die teuren Limousinen in Deutschland gebaut und exportiert, ebenso wie bei BMW.
Porsche hat keine Produktion in USA, sondern liefert voll aus Deutschland, rund ein Drittel seiner Jahresproduktion. Audi produziert ebenfalls nicht in USA, sondern beliefert den US-Markt aus Mexiko. Die übrigen Premium-Hersteller haben eigene Werke in USA, am stärksten ist BMW vertreten. BMW beliefert den US-Markt fast zur Hälfte (48 Prozent), Mercedes zu 43 Prozent und VW mit bescheidenen 21 Prozent aus eigenen Werken im Süden der USA. Alle sind jedoch in hohem Maße von Teile-Zulieferungen aus Mexiko und dem Rest der Welt abhängig, über die Lieferketten wäre also auch die US-Produktion durch die Zölle belastet.
Von BMW und Mercedes liegen bislang keine Stellungnahmen vor, von Audi-Chef Gernot Döllner ist laut Süddeutscher Zeitung zu hören, Audi prüfe in den USA zu „lokalisieren“, was nichts anderes heißt, künftig auch in USA Autos zu bauen (SZ, Nr.73, 28. März 2025). Das VW-Werk in Chattanooga böte da sicher Möglichkeiten. Nur für Porsche reichen die Stückzahlen für eine selbständige lokale Produktion nicht aus, weder in USA noch in China.
Die Sonderzölle treffen die deutschen Autohersteller wie die Zulieferer in ohnehin turbulenten Zeiten: Vor ihrer Verkündung durch Trump verging kaum eine Woche, in der nicht ein Autokonzern schrumpfende Absatzzahlen, Gewinneinbrüche, Umsatzverluste und Investitionskürzungen verkünden musste. China und Elektromobilität haben in den Bilanz- und Geschäftszahlen deutliche Spuren hinterlassen – in diesem Fall tiefrote. Und jetzt auch noch Sonderzölle, Zusatzkosten und voraussichtlich Absatzrückgänge im Hauptmarkt USA als Zusatzbelastungen – vordem eine sicher geglaubte Bank.
Die Erwartungen der Branche, das Jahr 2025 werde ein Aufschwungjahr für die Autoindustrie werden, sind verflogen, die Perspektiven sind düster, die Furcht vor einem Handelskrieg wächst, zunehmender Pessimismus macht sich breit.
Selbst wenn einzelne Hersteller sich zu der Entscheidung durchringen, aus Deutschland, Mexiko oder von anderswo Produktion in die USA zu verlagern, entstehen hohe Zusatzkosten und Verluste, und es braucht Zeit, bis die Werke in USA laufen. Auch eine Überwälzung der Sonderzölle auf die amerikanischen Verbraucher, wie von der Regierung über höhere Steuereinnahmen bereits „eingepreist“, dürfte nicht ohne Absatzverluste einhergehen. In jedem Fall gehen in Deutschland so oder so Arbeitsplätze verloren, je stärker die Autoindustrie unter Druck gerät.
Regierung muss der veränderten Realität Rechnung tragen
Die Zölle aus dem Weißen Haus sollten die Politiker von CDU, CSU und SPD wachrütteln, sich in laufenden Koalitionsverhandlungen nicht im ideologischen Klein-Klein von parteilichen Partikularinteressen zu verlieren. Im Mittelpunkt stehen dabei die deutschen Autohersteller, die Gefahr laufen, zwischen den Mühlsteinen von Verbrennerverbot und amerikanischen Sonderzöllen zerrieben zu werden.
Dazu der Kommentar der Neuen Zürcher Zeitung: „Dass Trump speziell die Autoindustrie ins Visier nimmt, ist besonders für Deutschland ein Problem. Denn sie ist das Herz der deutschen Industrie, das Kraftwerk der Volkswirtschaft. Mit unzähligen Verästelungen und weitverzweigten Wertschöpfungsketten sorgen die heimischen Autohersteller für Millionen Arbeitsplätze und Wohlstand – noch, muss man wohl dazusagen“ (NZZ – Der andere Blick am Abend, 27. März 2025).
Die NZZ konstatiert zu recht, dass durch den politisch oktroyierten Technologiewandel hin zum Elektroauto sich die deutsche Autoindustrie seit Jahren in der Krise befindet. Ihre komparativen Vorteile, die in der Produktion von Verbrennungsmotoren bestehen, kann sie immer weniger ausspielen. Vor allem nicht in China, wo ihr chinesische Hersteller mit technisch hochwertigen und preiswerten E-Autos Marktanteile abjagen.
Was auch immer die Koalitionsvereinbarungen bezüglich Verkehr und Autoindustrie bringen, sie müssen im wohlverstandenen politischen Eigeninteresse für Wachstum und Arbeitsplätze getroffen werden. Trump hat die Spielregeln verändert! Die neue Regierung muss der veränderten Realität Rechnung tragen.
Konkret heißt das: Weg mit aktuellen wie mit geplanten, aber aufschiebbaren Zusatzbelastungen. Nicht Ideologie oder das Wünschbare wie unter dem Grünen Robert Habeck sind jetzt gefragt, sondern Schadensbegrenzung durch Förderung der Branche.
Die Zölle zu umgehen, indem Autoteile aus europäischer Fertigung nach Amerika geliefert und dort zusammengebaut werden, ist kaum möglich. Denn die Zölle gelten auch für Autoteile. Der Druck auf die Autohersteller, die gesamte Produktion nach Amerika zu verlagern, nimmt daher zu. Das gilt zumindest für die Verbrennerproduktion, da in USA keine Beschränkung herrscht, sondern pure Erdöl-Euphorie („Drill, baby, drill!“). Im krassen Gegensatz zu Europa, wo in 10 Jahren bereits ein absolutes Verbrennerverbot droht.
Das Problem für die deutsche Wirtschaft dabei ist: Aktuell werden bei einem Marktanteil von rund 18 Prozent von Elektroautos immer noch über 80 Prozent der automobilen Wertschöpfung durch den Verbrenner erbracht. Ein Exodus der deutschen Autoindustrie und anderer Industriebranchen über den Atlantik hätte weitreichende Folgen.
Sollte dieses Wertschöpfungsbein der Autoindustrie durch Trump zu Fall gebracht werden und die Verbrenner-Produktion nach USA abwandern, ist der Niedergang der deutschen Autoindustrie nicht aufzuhalten. Das Standbein von heute und der überschaubaren Zukunft bricht. Autohersteller, die morgen pleite sind, oder in den USA produzieren, können übermorgen in Deutschland auch keine Elektroautos mehr bauen. Zumal die USA mit niedrigeren Energie-, Lohn- und Steuerkosten sowie mit weniger mächtigen Gewerkschaften locken.
Nochmals: Die neue Regierung muss der veränderten Realität Rechnung tragen! Das bedeutet, der deutschen Autoindustrie keine zusätzlichen Belastungen aufzuerlegen, sondern für Entlastungen zu sorgen. Im Mittelpunkt steht dabei die Aussetzung des Verbrennerverbots auf unbestimmte Zeit und Sicherung der Verbrenner-Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland selber.
Darin liegen Chancen, denn der Autopark in Deutschland altert schnell wegen der Unsicherheit über zukünftig noch erlaubte Mobilität. Klarheit würde hier Bremsen bei Verbrauchern lockern und Käufe auslösen. Auch die Entwicklung sauberer Verbrenner würde sich wieder lohnen – derzeit fallen auch hier deutsche Hersteller gegenüber japanischen Produzenten zurück.
Derzeit geht die Politik allerdings in Richtung Förderung der lahmenden Elektromobilität und Wiederaufnahme der Verkaufsförderung von Elektroautos nach sozialen Gesichtspunkten. Beides ist abzulehnen: Die Politik wird scheitern, wenn sie sich gegen die Konsumenten stellt. Wenn Elektroautos sich aus eigener Kraft nicht durchsetzen können, zeigt sich, dass dies ein falsches Konzept ist. Die Förderung der E-Mobilität hat schließlich mit dazu beigetragen, die Autoindustrie in die derzeitige Krise zu treiben. Der Irrweg sollte gestoppt werden, auch wenn grüne Politikerinnen zetern.
Gemessen an dem, was an Wohlstand auf dem Spiel steht, sind Fragen nach Tempolimit auf Bundesautobahnen von sehr untergeordneter Bedeutung. Da wird der Wohlstandskrieg nicht entschieden.


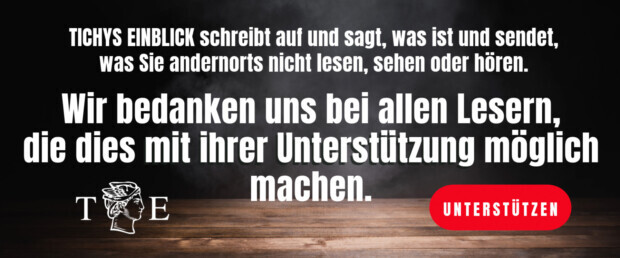


























Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
Die Gewinne beim größten Autobauer Deutschlands sind 2024 drastisch zurück gegangen und nehmen bereits bedrohliche Ausmaße an und das sieht man auch am Einzelgewinn pro Fahrzeug was von 1652,– EUR auf 1250, zurück ging und das vor Steuern, wo es sich bald nicht mehr lohnt überhaupt noch Fahrzeuge anzubieten, bei der Minimal-Rendite bezogen auf die hohen Preise, was das Vehikel garnicht wert ist und auch für andere zutrifft, die derzeit ebenfalls in den Seilen hängen und wenn sie abstürzen ist das auch egal, denn wer schlüpfrigen Untergrund betritt muß auch mit schlimmen Ereignissen rechnen. Wer Wasserkopf ist einfach zu groß… Mehr
Herr Trump beschleunigt nur, was in D vorgeht. Deutsche Unternehmen fragen sich nur noch, wie lange die Republikaner regieren und ob die Demokraten die Investitionen unrentabel machen, sobald sie wieder regieren.
BMW scheint einiges richtig zu machen. D wird es nicht tun.
Egal ob Autoindustrie, Maschinenbau, Chemieindustrie oder welche Branche sonst noch Deutschland zu einem „reichen Land“ machte, die Arbeitsplätze fallen nicht weg, im Gegenteil, die Weltwirtschaft wächst stetig weiter.
Sie sind perspektivisch nur nicht mehr in Deutschland.
„Klimaneutralität“ im Grundgesetz, ein besseres Indiz für die Machtübernahme der Dummheit findet man nicht.
Die neue Regierung sollte am besten nichts tun, und die Finger von der üblichen Regierungstätigkeit lassen. Dann richtet sie am wenigsten Schaden an.
Die Bundesregierung wird mE keine EU-Vorschriften lockern, sondern die deutsche Autoindustrie untergehen lassen.
Die Trumpschen Zölle sind doch ein Geschenk für CDUSPD: Sie ermöglichen den Verantwortlichkeiten (- Merkel und Scholz, Merz muss nur stillhalten), die Schuld auf Trump zu schieben. Sozusagen eine nützliche Dolchstoß-Legende.
Ich glaube nicht, dass die deutsche Automobilindustrie ihre Produktion mit Gewinnerzielungsabsichten betreibt und Trump ihr letzter Sargnagel ist. Mir kommt es so vor, dass man dort nach der Pfeife der ergrünten Politik tanzen, nicht auffallen und sich jeder Vorstandsboss noch möglichst lange die Taschen vollmachen möchte. Preis-Leistung lassen vermuten, dass der deutsche Kunde alle Verluste von den Konzernen aufgenackt bekommt, die die Fahrzeugpreise in astronomische Höhe schnellen lassen. Was bei den Neuwagen nicht mehr zu verdienen ist, weil man schon eine Million Neuwagenkunden p.a vergrault hat, schlägt man inzwischen bei den Ersatzteilpreisen auf. Kaputt darf da nichts mehr gehen, ohne… Mehr
Wirr! Erst ist Trump der tumbe Tölpel, der durch seine Zölle die amerikanische Wirtschaft kaputtmacht (wobei komplett unterschlagen wird, dass die EU seit über dreißg Jahren 10% Zoll auf die Einfuhr von US-Autos erhebt), dann wird -absolut korrekt- davor gewarnt, dass die euopäischen Automobilbauer in die Staaten gehen werden. Was ja wiederum ein Geniestreich ist. Und dann wird ausgerechnet an die neue deutsche Regierung appelliert, also an die Parteien, die seit Jahrzehnten vorsätzlich, wissentlich und willentlich die deutsche Industrie zerstören. Absurd. Wenn Herr Becker einen Mehrwert schaffen will, sollte er sich dazu äußern, ab wann man dann Aktien der in… Mehr
Das rafft der Meister Becker nicht. Der hat ja vor nicht mal einem Jahr noch behauptet, die deutschen Autobauer hätten den Elektrotrend verschlafen, wo schon klar war, daß dieser Trend – wenn es denn je einen gab – ein Strohfeuer ist. Ich habe es hier schon öfter geschrieben: E-Mobilität ist TOT. Wir haben nicht den Strom, wir haben nicht die Infrastruktur, die Probleme der langen Ladezeiten, der geringen Reichweiten, der hohen Preise und vor allem dem kaum vorhandenen Gebrauchtmarkt mit hohen Wertverlusten beim Wiederverkauf, den unkalkulierbaren Preisen bei Reparatur und auch Unfällen sind nach wie vor ungelöst. Noch blöder wird… Mehr
„Was die neue Regierung tun muss, um die Autoindustrie zu retten“ – aber nicht tun wird, weil sonst die Pariser Klimaziele (zu denen Merkel Deutschland verpflichtet hat) nicht erreicht werden können.
Was ich ja schon vor 10 Jahren schrieb, dass ohne Rückbau der deutschen Industrie diese Ziele nicht erreichbar wären.
Was mir damals niemand geglaubt hat…