Zölle sind schlecht fürs Geschäft. Sie schädigen die internationale Arbeitsteilung und treiben Verbraucherpreise in die Höhe. Ihr Comeback zeigt, dass wir im Primat der Politik leben. Eine neue Zeit der Machtpolitik ist angebrochen. Von Thomas Kolbe

 picture alliance / Sipa USA | Davide Bonaldo
picture alliance / Sipa USA | Davide Bonaldo
Donald Trump kommuniziert laut, bisweilen schrill. Dass er den 2. April, den Tag der Einführung eines aggressiven Zollprogramms der USA, zum „Liberation Day“ verkündete, sollte nicht verwundern – es ist Teil der harschen Kommunikationsstrategie des Weißen Hauses seit der Amtsübernahme. Handelspartner wie die Europäische Union reagieren geschockt, drohen mit Gegenmaßnahmen auf den Zollschritt von 20 Prozent. Andere wie Argentiniens Präsident Javier Milei betonen ihre Bereitschaft zu Konzessionen und beugen sich der Drohgebärde.
Doch hinter der schrillen Kommunikation des US-Präsidenten steckt mehr als bloße Provokation. Die USA befinden sich fest im Würgegriff eines doppelten Defizits. Handels- sowie Fiskalbilanz rutschen immer tiefer in den roten Bereich und sorgen für Verwerfungen in der amerikanischen Wirtschaft, bis hin zum Verlust der industriellen Basis. Hier setzt die neue US-Regierung an, das sogenannte „Triffin-Dilemma“ zu eliminieren. Dieses besagt, dass derjenige, der die Weltreservewährung emittiert, die globale Wirtschaft über ein korrespondierendes Handelsdefizit mit Liquidität versorgen muss. Zollpolitik und Steuersenkungen sollen die größte Volkswirtschaft der Welt aus dieser Umklammerung befreien. Darum geht es hier im Kern.
Aufschrei der Dauerempörten
Dass dies zu Problemen führen kann, wissen wir aus der Wirtschaftsgeschichte. Aktive Zollpolitik mündet nicht selten in Handelskriege und kann den beteiligten Ökonomien schwere Schäden zufügen. Nur ein freier Handel befähigt die Teilnehmer des Wirtschaftsgeschehens, Spezialisierungsmuster auszuformen, die eine optimale Versorgung der Märkte gewährleisten.
Allerdings befinden wir uns nicht in einer utopischen Lehrbuchökonomie, sondern an einer geopolitischen Schwelle, die uns kalte Machtpolitik und nationale Präferenzlagen zurückbringt. Die Reaktion der EU-Europäer auf die Kehrtwende der US-Handelspolitik fällt daher auch erwartbar heftig aus. Auf die rege Reisetätigkeit europäischer Spitzenpolitiker der Präsidenten Emmanuel Macron und Keir Starmer folgt nun die Ankündigung der EU-Kommission, die Zölle der Amerikaner mit Gegenmaßnahmen zu kontern. Willkommen im Handelskrieg!
Folgt man den Empörungswallungen der Europäer, muss man sich allerdings verwundert die Augen reiben. Immerhin ist es die EU, die bereits ihr Fundament auf Kohle- und Agrarsubventionen aufsetzte und seit ihren Gründungstagen eine überdimensionierte Subventionsmaschine zur Umsetzung eigener industriepolitischer Ambitionen betreibt. Wer heute als Externer den Schritt auf den europäischen Binnenmarkt wagt, sieht sich einer Fülle regulatorischer Handelsbarrieren ausgesetzt, die unter dem Euphemismus „Harmonisierung“ firmieren. Subtil und anstelle hoher Einfuhrzölle weist die EU externe Konkurrenz über Produkt- und Produktionsstandards (Lieferkettengesetz), bürokratische Hürden und Schutzzölle ihrer Kernsektoren an den Grenzen zurück. Die Zeche zahlt der Verbraucher über höhere Preise, da so der Wettbewerb geschwächt wird.
Gemeinsame Agrarpolitik als Pseudoargument
Produkte wie Fleisch oder Milch aus Drittländern unterliegen nicht nur Zöllen, sondern auch Hygiene- und Qualitätsstandards, die oft nichts anderes sind als reine Schikane, um potenzielle Wettbewerber aus dem Feld zu räumen. Häufig wird medienwirksam auf den Schutz der Verbraucher verwiesen, doch in Wahrheit dient die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), um nur ein Beispiel zu nennen, ausschließlich dem Schutz heimischer Anbieter. Laut OECD machen solche nichttarifären Barrieren bis zu 60 Prozent der EU-Protektion aus – weit mehr als die sichtbaren Zölle.
In der Industrie zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Automobilbranche etwa wird durch einen Zoll von 10 Prozent auf Importfahrzeuge geschützt, ergänzt durch technische Vorschriften und Emissionsstandards, die auf europäische Hersteller und ihre Produktionsstruktur zugeschnitten sind. US- oder asiatische Firmen sind auf diese Weise gezwungen, hohe Anpassungskosten zu stemmen und treten mit spürbaren Nachteilen in den Markt. Das Ergebnis: ein faktischer Marktschutz für Konzerne wie Volkswagen oder Stellantis, ohne dass die EU als protektionistisch auffiele.
USA legen die Karten auf den Tisch
Während die USA nun versuchen, ihr Handelsdefizit zu reduzieren und ihre Industrie wieder aufzubauen, operiert die EU im Klandestinen. Der „Carbon Border Adjustment Mechanism“ (CBAM), ab 2026 aktiv, belastet Importe aus Ländern mit niedrigeren Klimastandards. Offiziell geht es um den Klimaschutz.
In Wahrheit handelt es sich aber um ein scharfes Schwert des Protektionismus, da die Europäer die CO2-Keule als betriebswirtschaftliches Totschlagargument einsetzen und wissen, dass man außerhalb der klimamoralisierenden Brüsseler Bürokratie eher auf wirtschaftliche Vernunft als auf ideologische Wolkenkuckucksheime setzt.
Und auch in der Digitalwirtschaft verhängt die EU hohe Auflagen gegen US-Tech-Riesen wie Google oder X, während sie europäische Konkurrenzunternehmen aktiv fördert. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erschwert nicht-europäischen Firmen den Marktzugang, während heimische Unternehmen profitieren. Das ist kein freier Handel, sondern gezielte Abschottung.
Ausgang offen, aber mit Vorteilen für die USA
Wir dürfen gespannt sein, wie sich dieser Konflikt in den kommenden Wochen entfaltet. Die USA setzen dabei auf ihre breite technologische Basis, auf Energieautonomie und die Fähigkeit, über offenere Märkte mobiles Kapital von einem Investment in den Staaten zu überzeugen. Sie nehmen mit der Zollpolitik in Kauf, dass der US-Verbraucher zunächst geschwächt wird. Europa sollte den Fehdehandschuh der Trump-Regierung als Arbeitsauftrag auffassen und eigene Konzepte und Fehlentwicklungen kritisch unter die Lupe nehmen.
Eine Rückkehr zu marktwirtschaftlichen Prinzipien und offenen Märkten ist eine zwingende Schlussfolgerung, die aus dem aggressiven Auftreten der Amerikaner abzuleiten wäre. Allerdings ist dies nicht denkbar ohne ein radikales Umdenken in Brüssel und den europäischen Hauptstädten. Der Versuch, eine grüne und weitgehend deindustrialisierte Ökonomie zu errichten, ist an der ökonomischen Realität gescheitert. Diese präsentiert sich als tiefe Wachstumskrise und legt sich nieder im erlahmten Produktivitätswachstum. Und der Machtapparat der Zentralplaner in Brüssel ist nun diesem gleißenden Licht der Realität ausgesetzt.


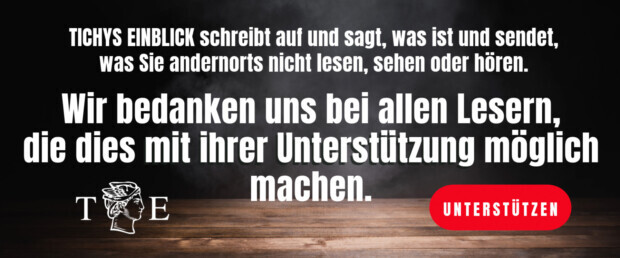












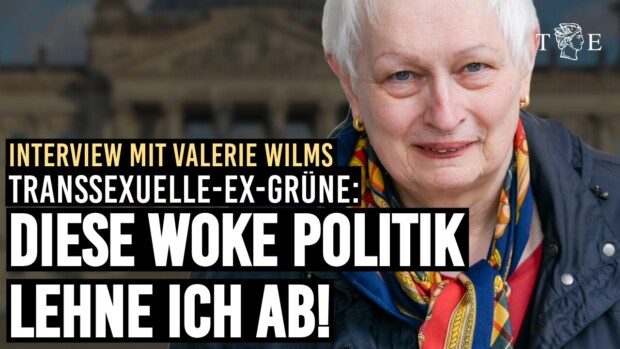











Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
Der SPD-Gabriel weiß es: „Kanada ist europäischer als manches Mitglied der Europäischen Union“.
Europa müsse angesichts des Vorstoßes von US-Präsident Donald Trump, die USA und Kanada zu vereinen, gegenhalten. „Ohnehin ist Kanada europäischer als manches Mitglied der Europäischen Union“, fügte Gabriel hinzu.
Jo, da hat unser Sigmar mal wieder Großes verkündet. Wie würde der wohl reden, wenn Kanada „gute Beziehungen“ zu Russland hätte? Alter Dummschwätzer, solche Leute braucht niemand, um Vernunft und Frieden zu fördern!!!
Habe gerade heute mit jemanden gesprochen der in Kanada war, Urlaub wohlgemerkt, aber dort Verwandschaft hat. Im Vergleich meines persönliches Gespräches und des Vergleiches Gabriels kommt mir die Galle hoch. Kanada hat kurze heisse Sommer und lange, kalte schneereiche Winter. Was ist daran europäisch? Das gesamte kanadische Wesensmerkmal, ist Eigenverantwortung. Du geniesst alle Freiheiten. Wenn du Fehler machst die Dritte gefährdet, bekommst du die volle Härte der Gesellschaft und des Gesetzes zu spüren. Was ist an dieser Haltung europäisch? Kann das einer von Euch bestätigen?
Je grösser die Empörung, desto grösser das Eingeständnis der eigenen Schwäche. Im Grunde genommen, genau die Entwicklung, die grüne Politik möchte. Herunterfahren des Kommerz und Konsum. Wie nennen die das …Degrowth? Will das nicht googeln sonst ist mein Text perdu.
Getroffene Hunde bellen und wollen durch Lauststärke Aufmerksamkeit erreichen! In der ganzen medialen und politisch verbreiteten Empörung vermisst der durch dieses Ritual geschulte, erfahrene Bürger wieder einmal das ganze Bild. Wo sind denn die Gegenüberstellungen der bisherigen Zölle der EU gegenüber anderen Ländern in allen Qualitätsmedien? Und wer zahlt wann und wie Mehrwertsteuer noch obendrauf? Und was ist in China in der Automobilindustrie für die EU Staatsnähe und in Niedersachsen unerwähnt, scheinbar nur politische Folklore? In Frankreich gehört die Automobilindustrie übrigens fast zum nationalen Kulturgut! Globale Zölle sind das eine, aber den grössten Zoll produziert diese EU nach innen selbst.… Mehr
Ein sehr ausgewogener Beitrag, der sich wohltuend von dem dumpfen Trump/USA-Bashing des linken Mainstreams abhebt. Am lustigststen empfand ich heute den Spruch, ich glaube von Scholz, man müsse es Trump jetzt zeigen.” Also dem “Bôsen” gegenüber wird die germanische Moralkeule geschwungen, die erwartungsgemäß auf der Erde aufschlagen und nur Staub und Dreck aufwirbeln wird. Analog zu dem Dummspruch vor 3 Jahren, wer damals auch die Sprüche, per WhatsApp versandt, erhielt, erinnert sich vielleicht: “Wir frieren für die Ukraine und verzichten auf Gas aus Russland. Wir werden es Putin zeigen.” Tja! Einige Monate später rummste es am Ostseegrund und seitdem steigen… Mehr
Gestern schrieb hier einer:
„Woher die Zölle? Man muss wissen, dass 75% der Zolleinnahmen direkt in die Taschen der EU-Kommission fließen. Die EU-Kommission ist vermutlich an hohen Zöllen interessiert.“
Kann jemand bestätigen, dass das stimmt?
Keine Zeit alles zu recherchieren. Der Zoll und Zölle ist allerdings eine Abgabe die seine Legitimation durch grenzüberschreitendes Handeln erfährt. Es wäre abwegig zu denken, dass eine Kommision nicht Nutzniesser dieses Handelns wäre.
Der Abbau der Zölle, so lehrt die Volkswirtschaftslehre, erhöht den allgemeinen Wohlstand – aber nicht unbedingt für alle. Es gibt Gewinner und Verlierer.
Verlierer der durch den Freihandel verursachten Verlagerung der Industrie in Schwellenländer ist die mittlere und untere US-Mittelschicht. Früher als Industriearbeiter gut bezahlt, müssen sie jetzt einfache Jobs machen – großer Einkommens- und Statusverlust. Gewinner sind die Tech-Spezialisten und Spitzenmanager. Das hat die USA gespalten, mehr als jemals.
Trump will die Industrie zu Gunsten der o.g. Verliererschichten zurückholen. Er hat damit nicht völlig unrecht.
Im Prinzip bin ich ähnlicher Meinung mit dem Autor. Nur was die Gründe für die Subventionen in Europa betrifft, bin ich anderer Meinung. Zunächst möchte ich aber nur als Beispiel darauf hinweisen, dass in Deutschland jeder Arbeitnehmer, der die Pendlerpauschale nutzt, subventioniert wird. Hat er einen Arbeitsweg von 50 km entspricht das den Direktzahlungen von 20 ha Ackerland. Das allerdings, ohne dass die Politik ihm vorschreibt, wie viele Leute er als Beispiel noch kostenlos mitbefördern soll für das Allgemeinwohl. Der Punkt ist nämlich: Die europäischen Landwirte haben dank Subventionen keine Wettbewerbsvorteile. Die europäischen und deutschen Regeln in der Landwirtschaft sind… Mehr
Der Autor übersieht zwei entscheidende Punkte, die seine Argumentation ad absurdum führen. Zum einen hat die USA nicht nur gegenüber der EU ein Handelsdefizit sondern auch gegenüber den beiden anderen großen Marktwirtschaften China und Japan, ebenso mit Süd-Korea und Taiwan. Umgekehrt verkaufen sich chinesische, japanische und koreanische Produkte hervorragend in der EU. Die Erklärung, dass die EU mit ihren hohen Anforderungen an Produktqualität und -sicherheit Schuld an dem amerikanischen Handelsdefizit sein sollen, ist also falsch. China, Japan und Korea kommen mit den EU-Anforderungen offensichtlich sehr gut zurecht! Und auch verkaufen sich amerikanische Produkte nicht nur in der EU schlecht sondern… Mehr
Sie vergleichen Äpfel mit Birnen. Chinesische Autos verkaufen sich in Europa so gut wie gar nicht. China ist im Vergleich zu Japan, Süd-Korea und Taiwan ein Billiglohn-Land, was bislang wenig Innovation hervorgebracht hat. J, S-K und Taiwan sind Technologieführer im Hightech-Bereich. In manchen Bereichen sind die Weltspitze und allein von daher schon konkurrenzfähig bzw konkurrenzlos. Die Absätze asiatischer Autos sind Deutschland trotzdem insgesamt minimal. Hyunday steht bei Neuzulassungen an Platz 9 mit 3 Prozent, dann kommt auf Platz 11 Toyota (2,7%), gefolgt von Kia auf Platz 14 mit 2,3 Prozent. Nissan als nächstes auf Platz 20 mit 1,1 und Suzuki… Mehr
Chrysler ist genauso wenig europäisch wie Volvo chinesisch ist.
Letztlich bestätigen Sie, dass deutsche Autos nach wie vor Weltspitze sind und sich deswegen in den USA aber auch China gut verkaufen.
Und wenn die USA ein Außenhandelsdefizit nicht nur gegenüber einem Billiglohnland wie China hat sondern auch gegenüber Hochlohnländern wie Japan, SK und eben Europa, belegt das einmal mehr, was ich oben schrieb: amerikanische Produkte sind auf dem Weltmarkt schlicht nicht konkurrenzfähig. Der IT-Dienstleistungsbereich ausgenommen.
Es ist nicht nur die USA, die sich fest im doppelten Würgegriff befinden. Es sind auch die Deutschen, die diesen Würgegriffen ausgesetzt sind. Hier eine schwächelnde Währung, die Miet- und Konsumpreise in den letzten 2 Dekaden verdoppelt hat, dazu ein progressives Steuersystem, das alles andere als progressiv ist. Dazu eine wild wuchernde Staatsverschuldung, eine regelrechte Schuldenorgie, ohne jeden Rückzahlplan. Weiterhin eine fehlgeleitete Klimapolitik, Asylpolitik, Gesundheitspolitik und Außenpolitik. Wenn Sie das als Privatperson machen, wird Ihnen Ihre Bank den Stecker ziehen und die Kredite fällig stellen.
Zudem kommt Energiemangel durch Sanktionen und Preiserhöhungen durch den Anspruch, wie auch immer zu erklärende Klimaneutralität zu erreichen – mitsamt uns vorgemachten „Abhängigkeiten“ von Öl- und Gaslieferanten, auch von Strom aus AKWs – auch, wenn diese wechselten. Der Nochwirtschaftsminister erklärt dazu recht einseitig, aber durch manches auch sich selbst und sein Agieren schützend ohne inhaltlich oder zu Maßnahmen wie Zielen konkret zu werden – dass er nichts zu sagen hat – aber weiter für ein Amt ante portas steht: https://rtnewsde.com/kurzclips/video/241515-darf-es-ihnen-noch-nicht/ Sogar die angebliche „Geheimwaffe“ gegen das alles bleibt als nichts weiter als ein Stoß Papier zu erkennen. . Seltsam, dass… Mehr
Mittels der Regierungsmedien glaubt der deutsche und evtl. auch der „europäische“ Konsument, „seine“ Regierung in Berlin und die EU in Brüssel würden zu seinem Schutz und Vorteil agieren.