Die USA und Russland verhandeln über die Ukraine – Europa bleibt außen vor. Trump hat Putin bereits Zugeständnisse gemacht, während die EU um Einfluss bettelt. Ein Diktatfrieden droht. Die einstige Friedensdividende ist passé - und am Ende zahlen die Deutschen.

 IMAGO / Bestimage
IMAGO / Bestimage
Heute starteten US- und Russland-Delegationen ihre Gespräche über die Ukraine. Als Ergebnis droht ein Diktatfrieden. Die EU-Europäer und zumal die Deutschen sind bestenfalls Zaungäste. Dass diese Planung von US-Präsident Trump einem in der westlichen Welt nie dagewesenen Affront gegen Europa bzw. die EU und die europäischen Nato-Mitglieder gleichkommt, ist offenbar. Der frühere Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen (Däne, 72, von 2009 bis 2014 Nato-Generalsekretär) sagt denn auch in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ zu Recht: „Europas Betteln um einen Platz am Verhandlungstisch ist peinlich“. Es könnte freilich nicht einmal zu einem Platz am Katzentisch reichen.
Rasmussen kritisiert zu Recht, dass Trump an Putin vorab viele Zugeständnisse gemacht hat bzw. machen ließ: keine Rückkehr der Ukraine in die Grenzen vor 2014, keine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine, keine US-Truppen als Sicherheitstruppen nach einem Waffenstillstand. Europäer und Deutsche können also vorläufig nur zuschauen, wie Trump Putin zum Sieger kürt. Allerdings haben sich Europäer und zumal Deutsche ihre marginale Rolle in den vergangenen drei Jahrzehnten quasi redlich verdient. Selbst wenn die Europäer die Ukraine in den vergangenen Jahren in der Summe insgesamt mehr unterstützt haben, als die USA es taten.
Friedendividende „isch längst over“
Viele Deutsche – und Europäer – scheinen noch immer berauscht vom optimistischen Geschichtsdenken eines Francis Fukuyama (*1952), und zwar von seinem Aufsatz vom Sommer 1989 und nachfolgend seinem Buch »The End of History and the Last Man« (1992). Seine Kernaussage war: Kommunismus und Faschismus seien an ihr Ende gekommen. Jetzt sei im Sinne von Hegels Idealismus weltweit der liberale Staat mit Grundrechten, Rechtsstaatlichkeit und Marktwirtschaft in Sicht. Man begann, von einer »Zärtlichkeit der Völker« zu schwärmen. Die Politik Westeuropas machte begeistert mit, »Friedensdividende« zugunsten sozialpolitischer Wohltaten und zuungunsten des Militärs war angesagt. Die Bundeswehr wurde heruntergewirtschaftet. Man sah sich ja nur noch von Freunden umgeben.
Denkste! Russland gehörte und gehört nicht zu den Freunden. Putins Russland ist heute denn auch nichts anderes als ein postsowjetisches Land. Glasnost und Perestroika waren kurze Episoden, in denen Helmut Kohl die Chance der deutschen Wiedervereinigung ergriff. Die Zäsur von 1989/90 war in Russland auch kein Kontinuitätsbruch, schrieb der renommierte Historiker Heinrich August Winkler 2016. Michail Gorbatschow hatte zwar den Nachfolger der Sowjetunion, die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten GUS, dem Westen annähern wollen, er sprach in einer Prager Rede am 10. April 1987 von Europa als »gemeinsamem Haus«. Und am 25. September 2001 hatte Putin im Bundestag erklärt, Russland wolle sich Europa annähern. Seine Rede beendete er in deutscher Sprache mit dem Satz: »Russland ist ein freundliches europäisches Land.«
Noch Ende 2019 – fünf Jahre nach der Annexion der Krim – hatte eine Umfrage des PEW Research Center ergeben: 66 Prozent der Deutschen wünschen sich bessere Beziehungen zu Russland als zu den USA. Jacques Schuster (Welt) schrieb dazu damals: Bei Russland setze der Verstand vieler Deutscher aus. Clemens Wergin (ebenfalls Welt) macht sich Gedanken über den »seltsamen Russland-Tick der Deutschen« und deren »sicherheitspolitischen Analphabetismus«. Der ehemalige tschechische Außenminister (2007 bis 2013) Karel Schwarzenberg hat die Äquidistanz der Deutschen zu Russland und den USA wie folgt auf den Punkt gebracht: »Russland kann besetzen oder erobern, wen oder was es will, in Deutschland wird es immer Leute finden, die dafür Verständnis haben.«
Für Ex-Kanzler Gerhard Schröder war/ist (?) Putin ein »lupenreiner Demokrat«. Er betet Putins Definition von Russland als »gelenkter Demokratie« nach. Bereits drei Wochen nach seinem Ausscheiden als Kanzler im Herbst 2005 wurde er Lobbyist für Putins Öl- und Gasgeschäfte. Während seiner Kanzlerschaft 1998 bis 2005 gab es mehr als vierzig, oft auch sehr private Treffen mit Putin. Aber Schröder war hier nicht Solist. Sehr wohl als dessen Alphatier schuf er ein männerbündisches Netzwerk: eine Moskau-Connection. Die Namen dieses Netzwerkes lesen sich wie ein »Who ist Who« der SPD, vor allem der Niedersachsen-SPD als »Erzdiözese« der SPD und deren Vorfeldorganisationen. »Frogs« heißen sie: »Friends of Gerhard Schröder«.
Zur Erinnerung
Am 24. August 1991 erklärte die Ukraine, bis dato hinsichtlich Bevölkerung zweitgrößte, hinsichtlich Fläche drittgrößte der 15 Sowjetrepubliken, ihre Unabhängigkeit. Diese Unabhängigkeit wurde von Russland am Tag darauf anerkannt. Am 5. Dezember 1994 wurde das „Budapester Memorandum“ im Rahmen der KSZE verabschiedet. Vertragspartner waren die USA, Großbritannien und Russland. In drei getrennten Verträgen bekräftigte man als Gegenleistung für deren Nuklearwaffenverzicht die Souveränität der Ukraine, Weißrusslands und Kasachstans in den bestehenden Grenzen. Die Ukraine, die bis dahin die drittstärkste militärische Atommacht der Welt war, gab an Russland ab: 176 Interkontinentalraketen, 1.272 Atomsprengköpfe, 2.500 taktische Atomwaffen und mehrere strategische Bomber. Der damalige US-Präsident Clinton sagt heute: Das war ein Fehler. Wäre die Ukraine 2022 noch Atommacht gewesen, wäre es nicht zum Überfall Putins auf die Ukraine gekommen.
Am 31. Mai 1997 wurde der russisch-ukrainische Freundschaftsvertrag geschlossen. Er endete am 31. März 2019 – fünf Jahre, nachdem Putin 2014 die Krim nach Russland einverleibt hatte. Am 29. Januar 2003 kam es in Kiew zum russisch-ukrainischen Grenzvertrag zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Kutschma; der Vertrag trat am 23. April 2004 in Kraft.
Für Putin alles belanglos. Man hätte Putin besser kennen können. Etwa seine St.-Petersburger Doktorarbeit von 1997, sie mag ein Plagiat gewesen sein, aber der Titel ist bezeichnend: »Strategische Planung bei der Nutzung der Rohstoffbasis einer Region in Zeiten der Entstehung von Marktmechanismen«. Was 1999 im 2. Tschetschenien-Krieg und 2008 in Georgien geschah, hat man verdrängt. Nicht ernstgenommen hat man Putins Aussage von 2005, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion »die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts« sei, dass Putin weiter von einer »Russischen Welt« und »Russischer Erde« träumte und dass er diesen Traum mit der Annexion der Krim und von Teilen der Ostukraine 2014 zu verwirklichen begann. Unabhängig von der Nato-Russland-Grundakte von 1997, von den Minsk-Abkommen von Anfang 2015 und vom sog. Normandie-Format vom Juni 2015. All diese Initiativen waren für die Katz.
Putin verfolgte unbeirrt seinen Plan. Vom Zerbrechen der Sowjetunion traumatisiert, kratzte der Beitritt von Mitgliedsstaaten des früheren Warschauer Pakts (Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien) und gar von vormaligen Sowjetrepubliken (Estland, Lettland, Litauen) zur Nato und/oder zur EU am russischen Stolz. Um hier einer Legende entgegenzutreten: Es gibt keine Vereinbarung mit Russland, die diese Beitritte ausschließt! In der Folge will Putin seither Russlands unmittelbare Nachbarn ängstigen. Anfangs beließ er es bei Militärmanövern und mit der Simulation etwa eines Nuklearangriffs auf Warschau. 2008 gab es den Kaukasuskrieg, 2014 annektierte Russland die Krim. Man wollte nicht wissen, dass die Spuren des Abschusses der MH-17-Boeing über der Ostukraine am 17. Juli 2014 mit 298 Opfern nach Moskau zeigten. Man wollte die Hochrüstung Russlands, auch die Schaffung einer Cyber-Armee nicht wahrhaben. Unbeachtet blieb, dass Russland seit 2004 die Verteidigungsausgaben massiv erhöht hatte. Ein Zweimal-Außenminister Steinmeier (2005–2009, 2013–2017; SPD) sprach im Zusammenhang mit Russlands Krieg in Georgien von »westlicher Scharfmacherei« gegen Russland, in Bezug auf ein Nato-Manöver im Juni 2016, also nach Russlands Krim-Annexion, vom »Säbelrasseln« und vom »Kriegsgeheul« des Westens. Ein damaliger CDU-Vize Armin Laschet warnte inmitten der Krim-Annexion im März 2014 vor einem »marktgängigen Anti-Putin-Populismus«.
Die zunehmende Indoktrination der russischen Bevölkerung, die Ausschaltung von Opposition und freier Presse wollte man nicht wahrhaben. Und auch, dass die Spuren bei Morden bzw. Mordanschlägen nach Moskau führten, wurde verdrängt: 2006 der Giftanschlag in London auf Sergei Skripol, im August 2019 der Mord an Selimchan Changoschwill in Berlin (»Tiergartenmord«) oder der Giftanschlag auf Alexei Nawalny im August 2020. Nawalny war es auch, der Schröder als Putins »Laufburschen« bezeichnet hatte. Am 16. Februar 2024 ist Nawalny unter nie transparenten Umständen in einem Straflager mit 47 Jahren gestorben. Da währte der am 24. Februar 2022 initiierte, von langer Hand vorbereitete völkerrechtswidrige Krieg Russlands gegen die Ukraine, vor allem gegen deren Zivilbevölkerung und Infrastruktur schon zwei Jahre.
Putin denkt wie Stalin in der Dimension von Divisionen
Im Denken ist Putin ein Nachfolger Stalins. Letzterer hatte auf der Jalta-Konferenz vom Februar 1945, auf der es nach Deutschlands erwartbarem Zusammenbruch um die Nachkriegsordnung ging, Churchills Vorschlag, den Papst als Vermittler einzuschalten, süffisant gefragt: „Wie viele Divisionen hat der Papst?“ Auch Putin denkt in dieser Kategorie. Die Hochrüstung, in die er sein Land seit Jahren treibt, zeigt das. Putin weiß auch zu gut, dass ihm der Westen – außer den USA – nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen hat. Das Nato-Ziel, zwei Prozent des BIP für Verteidigung auszugeben, wurde zwar schon beim Nato-Gipfel in Wales 2002 in Prag vereinbart, aber fast niemand (außer den USA und Griechenland mit jeweils mehr als 3 Prozent) hielt sich daran. Im September 2014 beim entsprechenden Gipfel in Wales wurde das Ziel erneuert – ein halbes Jahr nach der Annexion der Krim durch Russland. Beide Vereinbarungen gab es also bereits vor Trump, der schon in seiner ersten Amtszeit als US-Präsident – wie zuvor Obama – an die zwei Prozent erinnerte und nun mehr als die zwei Prozent verlangt. Gleichwohl dümpelte der Bundeswehretat all die 16 Merkel-Jahre von 2005 bis 2021 hindurch bei 1,3 bis 1,4 Prozent herum. Wenn dann ein französischer Staatspräsident Macron im November 2019 die Nato für „hirntot“ erklärte, dann knallten im Kreml die Krimskoye-Korken. Zumal Putin sehr bald, spätestens ab US-Präsident Obama (2009-2017), registrieren konnte, dass die USA ihre strategische Ausrichtung weg von Europa mehr in den pazifischen Raum verlagerten. Ein Weckruf für Europa und für Deutschland wurde das nicht.
Man braucht sich nur vergegenwärtigen, wie Deutschland seine Bundeswehr heruntergewirtschaftet hat. Stichworte mögen genügen: Aus 495.000 Soldaten wurden 179.000. Die Wehrplicht wurde ausgesetzt. Aus mehr aus 3.000 Leo-Panzern wurden 300. Munition reicht gerade für zwei bis drei Tage einer größeren kriegerischen Auseinandersetzung. Das Verteidigungsministerium wurde zweimal von ahnungslosen Politikerinnen geführt (2013 bis 2019 von CDU-Frau von der Leyen; Ende 2021 bis Anfang 2024 von SPD-Frau Christine Lambrecht). Wenn die Bundeswehr „out of area“ im Einsatz war (siehe Afghanistan oder Mali) musste Personal und Material aus allen bundesweit verteilten Einheiten zusammengeklaut werden, um eine halbwegs funktionsfähige Missionstruppe aufzustellen.
Putin weiß das. Und nun gelingt es ihm auch noch, den Westen zu spalten. Dank Trump! Dank Orban! Dank dreier deutscher Parteien, die mit 20 plus zweimal vier oder sechs Prozent Wählerstimmen in der Hinterhand Putin verstehen und meinen, Deutschland müsse neutral sein. Nein, Deutschland kann nicht „neutral“ sein. Klar auch: Geschichte kann nicht rückgängig gemacht werden und sie wiederholt sich auch nicht 1:1. Wer aber die Geschichte ignoriert, muss damit rechnen, sie wiederholen zu müssen. Mit einer Politik eines Appeasements wird man Putin mit seinen über die Ukraine hinausweisenden Absichten nicht beikommen. Man erinnere sich an das Münchner Abkommen von 1938. Damals ging Hitler mit der Abtretung des Sudentengebietes an das Deutsche Reich als Sieger hervor. 1939 fühlte er sich so stark, den Zweiten Weltkrieg vom Zaun zu brechen. Die Appeasementpolitik hatte ihn zusätzlich motiviert. Heute geht es auch um Abtretungen, nämlich um die Abtretung großer Teile der Ostukraine an Russland. Wird Putin hier Erfolg haben, wird er sich weiter d’ran machen, „russische Erde“ einzusammeln.
Ob ein Trump so weit historisch denkt? Nein, er nicht, Putin schon. Aber vielleicht gelingt es ein paar Europäern, Trump zu beeinflussen. Viele sind es nicht, die Trump – außer dem Putin-Versteher und Trump-Flüsterer Orban – ernst nimmt: Scholz nicht, Macron nicht. Einen möglichen Kanzler Merz? Wir werden sehen. Meloni und Tusk vielleicht. Am ehesten Nato-Generalsekretär Rutte, den Trump schon einmal als einen „nice guy“ geadelt hat.
Der soeben, am 17. Februar, eilends in Paris zusammengetrommelte informelle Mini-EU-Krisengipfel inkl. Großbritannien, wird Trump und Putin nicht beeindrucken. Die beteiligten Länder Frankreich, Großbritannien, Italien, Deutschland, die Niederlande, Dänemark und Spanien verzettelten sich ja allein schon mit der Frage, wer bereit sei, nach einem Waffenstillstand Schutztruppen für die Ukraine zu stellen. Wenn dann auch noch eine deutsche Außenministerin Baerbock in dem ihr eigenen Mitteilungsdrang jetzt schon kundtut, die EU plane ein Finanzpaket für die Ukraine in der Größenordnung von 700 Milliarden, dann kann sich Trump ja zurücklehnen und seinen streng bilateralen USA-Russland-Kurs fortführen.
Unabhängig davon: Ab sofort muss ein Ruck durch Europa gehen. Und zwar vor allem durch die europäischen Nato-Mitglieder. Die EU kann hier kaum die entscheidende Rolle spielen, denn die Liste der EU-Mitglieder und der europäischen Nato-Mitglieder ist nicht identisch: Österreich, Zypern, Irland und Malta gehören zur EU, aber nicht zur Nato. Großbritannien, die Türkei, Irland, Albanien, Island, Nordmazedonien, Norwegen gehören zur Nato, aber nicht zur EU. Dass Finnland mit seiner 1.300 Kilometer langen Grenze mit Russland 2023 und 2024 Schweden als Ostseeanrainer mit der längsten Küste Nato-Mitglieder wurden, zeigt, dass man dort die Zeichen der Zeit erkannt hat.

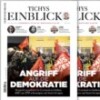

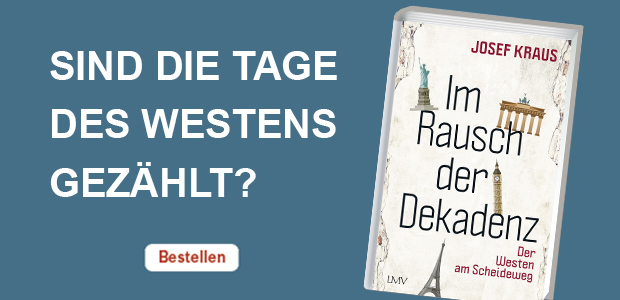














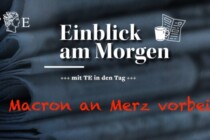



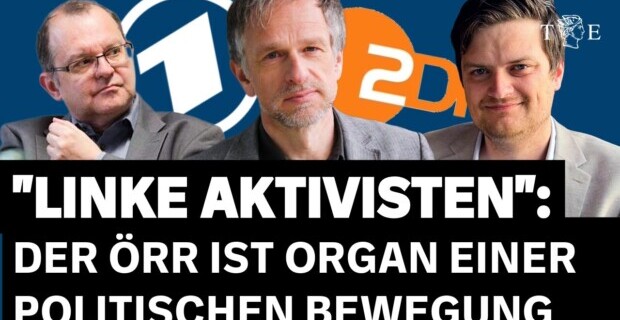




Liebe Leser!
Wir sind dankbar für Ihre Kommentare und schätzen Ihre aktive Beteiligung sehr. Ihre Zuschriften können auch als eigene Beiträge auf der Site erscheinen oder in unserer Monatszeitschrift „Tichys Einblick“.
Bitte entwerten Sie Ihre Argumente nicht durch Unterstellungen, Verunglimpfungen oder inakzeptable Worte und Links. Solche Texte schalten wir nicht frei. Ihre Kommentare werden moderiert, da die juristische Verantwortung bei TE liegt. Bitte verstehen Sie, dass die Moderation zwischen Mitternacht und morgens Pause macht und es, je nach Aufkommen, zu zeitlichen Verzögerungen kommen kann. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Hinweis