Eine kleine Geschichte aus dem (Rundfunk-)Alltag widerlegt die Behauptung der postkolonialen Ideologie, dass es gegen Weiße überhaupt keinen Rassismus geben könne. Der Autor, der sie selbst erlebte, zieht daraus ein verstörendes Resümee.

 IMAGO/Zuma Wire
IMAGO/Zuma Wire
In der zuweilen unterhaltsamen Rundfunkkolumne „100 Sekunden Leben“ des Inforadios des RBB, erzählt der Kolumnist eine Begebenheit, die er erlebte. „Als weißer, großer, deutscher Cis-Mann mit Abitur“ kam er in Neukölln bei einem Friseur vorbei, der einen Haarschnitt für 10 Euro anbot. Und da sein Haar „wild und wirr“ war und er auch noch etwas Zeit hatte, wollte er diese Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen lassen. Er betrat den Laden, in dem er „ungefähr zwölf allesamt arabisch sprechende Männer“ erblickte, grüßte und spürte sofort, dass er in der deutschen Hauptstadt der Willkommenskultur in diesem Friseurladen nicht willkommen war.
Eine Dreiviertelstunde verging, in der immer neue Männer den Laden betraten, so dass der wackere Kolumnist nicht mehr zu unterscheiden vermochte, wer von ihnen als Kunde oder als Kumpel kam oder dort arbeitete. Weil alles Ignorieren nichts half und der Kolumnist unendlich geduldig ausharrte, schickte der Friseur seinen „weißen“ Kunden in den Hinterraum, wo er von einem „Praktikanten oder Azubi oder wer das war, frisiert“ wurde, jedenfalls von „einem Typen, der das noch nicht so oft gemacht hatte und sehr schüchtern war.“
Als ein Mann mit Goldketten, befehlsgewohnten Gesten und lauter Stimme herein kam, zog der sämtliche Aufmerksamkeit auf sich. Der Kolumnist berichtete: „Der Typ sah mich, kam mit Zigarette im Mund bedrohlich nah an meinen Stuhl und sagte auf Deutsch – ich sollte es verstehen – zum Azubi: Ahh…bedient ihr jetzt auch Deutsche, so tief seid ihr gesunken. Und dann noch was in einer anderen Sprache. Ein Dutzend Männer lachte.“
Möglich, dass er „Deutsche“ dafür verachtete, weil sie vielleicht ihn oder Verwandte von ihm finanzierten, weil sie ihn und seinen Clan in ihr Land gelassen hatten, weil sie dafür Steuern zahlten, weil sie sich an das Gesetz hielten, weil sie ihr Land mit ihm teilten. Nicht alle, die als Flüchtlinge bezeichnet werden, sind es auch, manche sind schlicht nicht geflohen, sondern zugewandert, und zuweilen ist die Einwanderung nicht mit dem Wunsch verbunden, sich in die neue Gesellschaft zu integrieren. Manch einer sieht die Einwanderung auch als Landnahme an, weil Allah den Muslimen die Welt geschenkt hat und sie eigentlich die Herren der Welt sind, sie sich nur nehmen, was ihnen doch ohnehin von Allah von Geburt an gegeben ward.
Während es aber angeblich nach Ansicht von Antidiskriminierungsbeauftragten wie Ferda Ataman keinen Rassismus gegen weiße Deutsche geben kann und die weißen Deutschen immer diskriminieren und nicht diskriminiert werden können, werden auf Berliner Schulhöfen weiße Kinder längst verspottet. In den Schulen, wo der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund besonders hoch ist und weiter wächst, weil die weißen Eltern, die ihre Kinder von den dortigen Schulen nehmen können, es auch tun.
Oder, wie spottete Ferda Ataman im Spiegel über die weißen Deutschen und mithin auch über diese Kinder: „Schließlich wären Zuschreibungen wie Spargelfresser, Leberwurst oder Weißbrot kulinarisch und semantisch genauso naheliegend. Oder politisch fieser und ironischer: Deutsche mit Nationalsozialismusgeschichte oder germanische Ureinwohner oder Monokulturdeutsche – in logischer Anlehnung an die Begriffe, die man den „Anderen“ gibt.“ Das alles stellt für Ferda Ataman kein Problem dar. So trifft die Kritik der Union an Atamans Jahresbericht zur Diskriminierung zu, dass nämlich ein Teil des Spektrums von Diskriminierung in Deutschland, wie „Rassismus unter Migranten“ und Antisemitismus als Teil der islamistischen Ideologie, von Ataman ausgeblendet werden.
Es ist fast rührend, wie der Kolumnist versuchte, diese Alltagserfahrung, die ihn verstörte, mit seiner Ideologie in Einklang zu bringen: „Meine Identifikation mit meiner Nationalität war nie besonders ausgeprägt, aber der Typ machte mich gerade klein, minderwertig und zum Gespött, nur weil ich aussehe, wie ich aussehe und herkomme, wo ich herkomme.“
Nun könnte man freilich fragen, was in einem Land nicht stimmt, wenn jemand in einem Friseurladen diskriminiert wird, weil er aussieht, wie er aussieht und herkommt, wo er herkommt, zumal, wenn es noch dazu sein eigenes Land ist,, warum er fremd und diskriminiert im eigenen Haus wird. Doch so obsiegt dann schließlich die Ideologie über die Realität, wenn der Kolumnist resümiert: „Mann, dachte ich, als ich wieder auf der Straße war – andere Leute, die nicht so aussehen wie ich, erleben sowas jeden Tag, jeden Tag.“ Ohne diese Täter-Opfer-Umkehr am Ende als weit hergeholte Moral von der Geschichte wäre die Kolumne im rbb womöglich auch nicht gesendet worden.



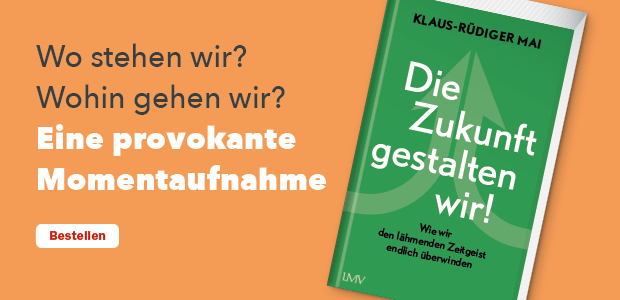





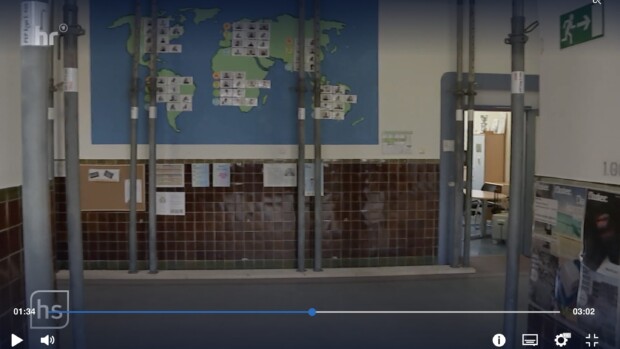


















Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
Diese Erfahrung habe ich schon 1985 gemacht. Musste als 33jährige Frau dringend auf die Toilette. Wollte mir im „Grünen Baum“ in Ingolstadt einen Kaffee kaufen und auf die Toilette gehen. Beim Eintritt in den Gastraum haben mich ca. 7 türkische Gastarbeiter finster angeblickt und der Gasthausbetreiber (Pächter?) hat mir jedes Getränk und die Toilette verwehrt. Da ist mir die Zukunft Deutschlands bereits klar geworden. Vor wenigen Jahren sehr nette Einheimische in der Türkei: Zu Euch sind nur die armen, fanatischen, zurückgebliebenen Anatolier. Die haben wir gerne gehen lassen. Der linke ehemalige Kanzler Schmidt hat übrigens noch 2009 öffentlich betont, dass… Mehr
Die gebildeten, fleißigen, toleranten und intelligenten (?) indigenen Malocher bzw. Sklaven arbeiten devot für die ungebildeten arbeitsscheuen aber vom wahren Glauben durchdrungenen Eroberer und werden dafür von Ihnen – nicht ganz zu unrecht- verachtet.
Also das sowas einem RbbMann passiert ,nicht zu glauben .
Wetten das ihm in der nächsten Redaktionskonferenz schon klar gemacht wird das der Typ mit der Goldkette nur spielen wollte und seine Bemerkung das sie nunmehr auch noch Deutsche bedienen doch wirklich nur Satire sein konnte .
Wir sind so weit in eine geduldete arabisch und Nordafrikanische Paralelgesellschaft gesunken das es zum normalen Alltag gehört ,als Deutscher vorgeführt zu werden .
Nur in den maßgeblichen Grünroten Kreisen ist diese Erkenntnis nichts wert . Weil diese Nichtskönner und Nichtwisser nichts begreifen .
Was ein Jammerlappen, der Typ vom rbb. Gastronomie bei Ausländern ist in Ordnung, Schneiderei auch – bei Gebrauchtwarenhandel hätte ich schon Bedenken, Arzt nur mit argen Bauchschmerzen, aber Friseur? Niemals! Mit meinem Haarschnitt bin ich derzeit übrigens sehr zufrieden. Eine insgesamt ausgesprochen attraktive Dame, leider durch Tätowierungen verunstaltet, egal, und mit unüberhörbar orientalischem Akzent, verrichtete ihr Werk ganz nach meinen Wünschen. Den Salon werde ich wieder besuchen und empfehle ich weiter – der ist aber von einer deutschen Friseurmeisterin geführt. Mir ist völlig schleierhaft, wie man zu so einem „Barbershop“ gehen kann. Eher ginge ich zu hiesigem Schäfer und stellte… Mehr
Dieser Kolumnist des rbb versuchte mit seinem Artikel den Sprung des Tigers, bekam aber im Flug noch die Kurve und landete sanft mit seiner Schlussbemerkung als Bettvorleger.
Irgendwie erbärmlich, aber auch selbstverschuldet durch die Aufgabe des Korrektivs als vierte Macht und den damit verbundenen Verlust des Respekts.
Man könnte viel schreiben, etwa, dass es arabische Barber-Shops gibt, in denen man vorzüglich behandelt wird, und es ebenso miese Buden gibt.
Aufgefallen ist mir die Kombination aus deutschem Gutmenschendenken und Geiz-Mentalität.
Die billigen Preise können die Barber-Shops anbieten, weil Araber und Türken quasi jede Woche beim Frisör sitzen und nicht viel zu schnippeln ist. Oder auch, weil die Läden als Tarnung und zur Geldwäsche dienen.
Als deutscher Geizling, der für einen Zehner sein „wildes und wirres“ Haar schön gemacht kriegen will, ist man da halt nicht gerne gesehen.
Ja, ja der alte weiße Mann, die weiße Oma als Umweltsau, die deutschen Kartoffel, die verachtenswerten Strassenköter usw. Die Weißen sind an allem schuld, speziell die Deutschen. Diese Selbstherrlichkeit mit der diese NOCH Minderheit ihr ach so bedauernswertes Schicksal des gegen sie ausgeübten Rasissmus und Opferseins vor sich hertragen, ihre ständigen und unverschämten Forderungen sind auch mit größter Toleranz nicht mehr aus zu halten. Aber der Deutsche findet natürlich immer wieder Gründe und Erklärungen warum er dies zu ertragen hat, da diese Toleranz halt schon in Dummheit umgeschlagen ist. Das Motto: Du arbeiten und zahlen und ich jetzt leben, da… Mehr
Die verachten die Deutschen weil sie weich, dekadent und ohne jedes Selbstwertgefühl sind, sich wie eine Weihnachtsganz ausnehmen lassen und sich ihren Ausnehmern auch noch unterwürfig anbiedern
So eine Heuchelei. Dieser Mann tut nicht genug Buße. Völlig zu Recht fragt er wenigstens nicht, ob er anderen Anlass zu aggressivem Verhalten gegeben hat, denn er ist ein Weißer und haftet dafür, wenn sich nichtweiße Ausländer nicht wohl fühlen in dem Land, dem sie sich aufgedrängt haben. Aber während der Goldkettenträger jeden Tag geknechtet und erniedrigt wird, tut der Täter, der noch immer im RBB arbeiten darf, nicht tägliche Buße: Er lebt nicht im Clangebiet, er lässt Ausländer wie Sklaven für ein allenfalls symbolisches Entgelt an seinem Erscheinungsbild arbeiten, er selbst dient ihnen nicht, er kriecht nicht, er zwingt… Mehr
Habe ich schon selbst erlebt, das eigene Klientel wird bevorzugt behandelt. Frau Attaman wird hier aber nicht helfen.