Bund, Länder, Kommunen – Der deutsche Staat ist der größte Arbeitgeber des Landes. Die Überbesetzung in den Verwaltungsbereichen sorgt für einen Anstieg der Bürokratiebelastung und langwierige Entscheidungsprozesse. Auch der Steuerzahler wird zunehmend belastet.

 picture alliance / 360-Berlin
picture alliance / 360-Berlin
Laut einer kürzlich veröffentlichten Untersuchung des Deutschen Beamtenbunds, dem „Monitor öffentlicher Dienst 2025‟, sind in Deutschland insgesamt 5,2 Millionen Menschen für Bund, Länder und Gemeinden tätig. Davon sind 1,9 Millionen Beamte, während 3,3 Millionen als Angestellte beschäftigt sind. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Sektor deutlich gestiegen. Im Jahr 2010 waren es noch insgesamt 4,7 Millionen Beamte und Angestellte.
Im EU-Vergleich der Länder mit den meisten Beschäftigten im öffentlichen Sektor liegt Deutschland mit dieser Zahl auf Platz zwei hinter Frankreich, wo sogar mehr als sechs Millionen Menschen im öffentlichen Dienst tätig sind.
Angesichts der hohen Beschäftigungszahl in diesem Sektor könnte man annehmen, dass ein Großteil dieser Beschäftigten in gesellschaftlich wichtigen Berufen tätig ist – etwa als Ärzte, Polizisten, Soldaten, Lehrer, Erzieher oder Feuerwehrleute. Doch die Realität sieht anders aus: In essenziellen Berufsfeldern sind vergleichsweise wenige Menschen angestellt. So arbeiten im deutschen Gesundheitswesen, zu dem unter anderem Ärzte und Arzthelfer gehören, lediglich rund 210.000 Beschäftigte.
Besonders auffällig ist im Vergleich dazu der Bereich „Politische Führung und zentrale Verwaltung‟, in dem knapp 600.000 Menschen entweder verbeamtet oder angestellt sind.
Anstieg der Beschäftigten im öffentlichen Dienst sorgt für gigantische Personalkosten
Die stetig wachsende Zahl an Staatsbediensteten im oben genannten Sektor stellt eine erhebliche finanzielle Belastung für den Steuerzahler dar. Der Grund: Ein beachtlicher Teil der Steuereinnahmen fließt in die Personalkosten des öffentlichen Dienstes. Interessant ist, dass laut Daten von Statista der Anteil der Personalkosten am Bundeshaushalt seit Amtseintritt der Ampelregierung deutlich gestiegen ist. Im Jahr 2021 belief sich der Anteil der Personalkosten am Gesamthaushalt noch auf 6,1 Prozent. Zwei Jahre später, 2023, war dieser Wert bereits auf 8,7 Prozent gestiegen. Für 2024 liegen noch keine offiziellen Zahlen vor, jedoch prognostiziert Statista einen weiteren Anstieg auf 9,7 Prozent.
„Bei allem Verständnis für die Herausforderungen, die zu bewältigen sind, sollte die Landesregierung auch Einsparungen in Betracht ziehen“, fordert Eike Möller, Landesvorsitzender des Bundes der Steuerzahler Baden-Württemberg. Er schlägt vor, Verwaltungsprozesse stärker zu automatisieren, etwa durch den Einsatz moderner Technologien. „Der Wille der Landesregierung, Personalkosten zu senken, ist aus unserer Sicht nicht ausreichend ausgeprägt“, kritisiert Möller deutlich. Wohl oder Übel, wird die finanzielle Mehrbelastung für den Steuerzahler auch weiter ansteigen, selbst wenn es zu einem Stopp von Neueinstellungen oder gar einem
Stellenabbau kommen sollte. Der Grund dafür liegt in den aktuellen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst, bei denen die Gewerkschaften Gehaltserhöhungen fordern. Konkret stehen 8 Prozent mehr Lohn oder mindestens 350 Euro monatlich im Raum. Zusätzlich werden drei zusätzliche freie Tage, sowie eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 200 Euro monatlich verlangt. Diese Forderungen betreffen rund 2,5 Millionen Beschäftigte bei Bund und Kommunen.
Sollte eine Gehaltserhöhung von 8 Prozent für alle Beschäftigten im öffentlichen Sektor durchgesetzt werden, hätte dies massive Auswirkungen auf den Bundeshaushalt. Währenddessen bleiben viele für die Gesellschaft wichtige Berufsgruppen unterbezahlt.
Zudem stellt sich die Frage, wo die Entlastungen etwa für Rentner bleiben. Viele Bürger, die das Land nach der Wende mit aufgebaut haben, leben heute unter dem Existenzminimum. Die durchschnittliche Rente in Deutschland beträgt lediglich 1.800 Euro brutto im Monat – ein Wert, der viele Einzelschicksale nicht abbildet, da zahlreiche Rentner deutlich weniger erhalten. Außerdem wird das gesetzliche Renteneintrittsalter kontinuierlich angehoben: Bis 2031 steigt es von ursprünglich 65 auf 67 Jahre.
Bürokratie als Wachstumsbremse: Wie der öffentliche Sektor die Wirtschaft belastet
Mit der finanziellen Belastung durch den überbordenden Staatsapparat ist es jedoch nicht getan. Die steigende Zahl an Beschäftigten im öffentlichen Sektor trägt nachweislich zu einer Zunahme des bürokratischen Aufwands bei. Laut einer Studie des ifo-Instituts kostet die Bürokratie in Deutschland jährlich rund 146 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung. Ein wesentlicher Faktor für diese Entwicklung ist, dass Beschäftigte im öffentlichen Dienst Anreize haben, immer neue Maßnahmen und Regelungen zu schaffen, jedoch kaum Motivation, bestehende Vorgaben abzubauen oder zu vereinfachen.
Mit der Zunahme der Beschäftigten kommen mehr und mehr Beamte und Angestellte hinzu, die sich aktiv an der Entwicklung neuer Regularien beteiligen. Die Auswirkungen der überbordenden Bürokratie treffen vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden: Mit einem Anteil von 99,6 Prozent aller Unternehmen (Stand 2022) und einem Beitrag von rund 77 Prozent zum Gesamtumsatz, sowie 87 Prozent der Beschäftigten dominieren sie die deutsche Unternehmenslandschaft.
Argentinien als Vorreiter: Das kann Deutschland von Milei lernen
Um Unternehmen von der erdrückenden Bürokratie zu entlasten und den Bundeshaushalt langfristig zu stabilisieren, und so auch den Steuerzahler zu unterstützen, ist es essenziell, den Staatsapparat zu verkleinern. Ein unmittelbarer Einstellungsstopp, oder auch Entlassungen im politischen und administrativen Bereich, könnten dabei effektive Maßnahmen sein.
Ein Blick nach Argentinien zeigt, wie erfolgreich ein solcher Ansatz sein kann. Der libertäre Präsident Javier Milei hat seit seinem Amtsantritt vor etwas mehr als einem Jahr eine umfassende Reform des öffentlichen Sektors eingeleitet. Laut Federico Sturzenegger, dem argentinischen Minister für Deregulierung und Transformation des Staates, wurden seit Mileis Übernahme bis November 2024 insgesamt 35.936 Stellen im öffentlichen Dienst abgebaut. Mit seiner konsequenten Politik der Verschlankung des Staatsapparats hat Milei erreicht, was viele für unmöglich hielten: Der stark angeschlagene Haushalt des Landes konnte sich stabilisieren. Erstmals seit 2010 erzielte Argentinien einen Haushaltsüberschuss – ein Beleg dafür, dass ein radikaler Umbau der staatlichen Strukturen positive Auswirkungen auf die finanzielle Lage eines Landes haben kann. Es liegt nun an der neuen Bundesregierung einen ähnlichen Schritt zu wagen.
Am 23. Februar ist die Urnenwahl zum Bundestag. Liegen Sie mit Ihrer Prognose besser als die Demoskopen? Machen Sie mit bei der TE-Wahlwette!














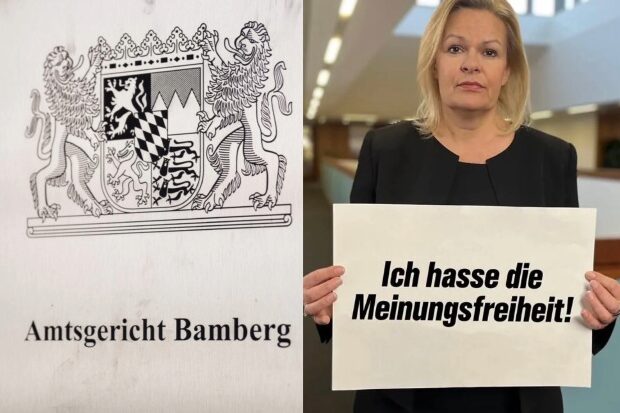













Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
Wenn man diesen europäischen Vergleich zieht, sollte man es schon richtig machen. Die reine Zahl der im öD Beschäftigten ist nicht vergleichbar. So muss man sich wundern, dass dabei Deutschland nicht mit Abstand auf Platz 1 liegt, da die Gesamtbeschäftigtenzahl ja auch mit Abstsnd am Höchsten ist. Ein vernünftiger Vergleich setzt die Gesamtbeschäftigtenzahl im Verhältnis zur im Verhältnis zu der Beschäftigtenzahl im öD oder auch zur Bevölkerungszahl. Ein solcher Vergleich sieht dann ganz anders aus, da liegt D nämlich nicht auf Platz 2 sondern am Ende der Skala. So liegt z.B. die Quote in Dänemark bei ca. 50%. Was eine… Mehr
Schön warm, vergleichbar gutes Einkommen ohne Risikobehaftung und Sicherheit im Krankheitsfall, mit üppiger Pension ab einer gewissen Einstufung am Ende, was will man mehr und man kann sich jederzeit auch in politischen Disziplinen üben und das ebenfalls risikolos, solange man sich im Winde beugt und das alles hat magnetischen Charakter, ebenso wie die Anziehungskraft in unsere Sozialsysteme, was man niemand verdenken kann, solange man diesen Irrsinn beibehält und andere dafür zahlen läßt. Das ist Sozialismus pur und total veraltet, denn die haben immer noch das alte Machtsystem der Feudalherren damit aufrecht erhalten und sind nun vom Untertan selbst zu Gutsherren… Mehr
Die Erziehung der Kinder in einer Kita zählt zur Bildung der heranwachsenden Generationen.
Und Bildung ist in Deutschland grundsätzlich frei.
Soll heißen: Auch der Besuch einer Kita muss von der Allgemeinheit finanziert werden.
Das wir in einem paranoiden Staat leben zeigt ein Bespiel: Eine Oma wird mit einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus gebracht. Sie krümmt sich von Schmerzen und ist so gestresst, dass sie knapp ihre Addresse aussprechen kann. Sie hat noch keinen behandelnden Arzt gesehen, schon steht an der Trage einer aus der Krankenhausverwaltung mit einem 3-seitihgen kleingedruckten Behandlungsvertrag mit 2 Unterschriften und einem 5-seitigen Formular uber Datenschutz und Datenverwendung der Patientin mit 3 weiteren Unterschriften. Welche Rechtsrelevanz haben solche Maßnahmen? Sind alle in dem Lande, wo alle Strassen immer dreckiger werden wirklich bekloppt geworden? Verweise auf Parkinsonsche Gesetze. Die Bürokratie läßst… Mehr
Markus Krall würde dazu sagen: Wenn der Staat radikal zusammengekürzt und die Angehörigen des öffentlichen Dienstes größtenteils entlassen werden, dann profitieren sie am Ende auch selbst. Die Privatwirtschaft erstickt nicht mehr unter der Steuerlast und kann produktive, daher besser bezahlte Arbeitsplätze auch für ehemalige Staatsdiener schaffen.
Der öffentliche Sektor stopft sich voll mit Leuten und Ansprüchen und der dumme Bürger begreift es nicht.
Der öffentliche Dienst ist weit größer als die 5,2 Millionen direkt Beschäftigten, da eine Vielzahl von öffentlichen – auch bürokratische – Aufgaben in privatwirtschaftlichem Gewand daherkommen. Benannte Stellen, TüV, Zertifizierer, NGO, Verbände aller Art, Verkehrsbetriebe, Sozialeinrichtungen, Krakenhäuser etc.pp. Überall werden Ressourcen zur Erschwerung von echter Wertschöpfung eingesetzt. Meine Abschätzung ist, dass inzwischen mehr als ein Drittel aller geleisteten Arbeitsstunden katabolen, nutzenvernichtenden Charakter haben. Wir regulieren und verbieten uns zu Tode.
Wenn man massiv Leute rausschmeißt und dazu auch noch die Ausgaben radikal zusammenstreicht, müsste es wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn daraus kein Haushaltsüberschuss erwächst.
Man sollte aber die ganze Wahrheit sagen und nicht nur die Zahlen hernehmen, die einem am besten ins Konzept passen. Im EU-Vergleich der Länder mit den meisten Beschäftigten im öffentlichen Sektor liegt Deutschland mit dieser Zahl auf Platz zwei hinter Frankreich… Dann schauen wir doch mal weiter rein, in den vom Autor zitierten Bericht des Beamtenbundes: Gesamtstaatliche Ausgaben für die allgemeine öffentliche Verwaltung in Prozent des Bruttoinlandsprodukts:1) Italien: 8,48%..8)Deutschland: 6,15%Anteil der Beschäftigung im öffentlichen Dienstan der Gesamtbeschäftigung (in Prozent1) Schweden: 28,9%..21) Deutschland: 11,2%“ Da der Autor sicherlich nur vergessen hat den Link zu Untersuchung des DBB anzugeben, möchte ich das… Mehr
Das muss man sich mal vorstellen. In 3 Jahren von 6,1 auf 9,7%. Das schlägt dem Faß wirklich den Boden aus.
Die „Grünenm“ und Linken versorgen halt ihre ideologische Gefolgschaft
Verschaffen Posten hauptsächlich an verantwortlichen stellen um das was in Behörden und Ämtern Tatsächlich gemacht wird im Griff zu haben Von geltenden Vorschriften einhalten und Fachkenntnis erschien mir z.B. schon mehrmals nicht mehr so Praxis.( Erfahrung Baden Wüprttemberg)