Unter amerikanischen Bedingungen könnten in Deutschland ein Unternehmer wie Carsten Maschmeyer, ein Schauspieler wie Til Schweiger, eine Kirchenfrau wie Margot Käsmann oder ein Weltenerklärer wie Michel Friedman sich berufen fühlen, uns zu regieren. Dann doch lieber Angela Merkel oder Sigmar Gabriel, Frank-Walter Steinmeier oder Ursula von der Leyen.


Mehr Demokratie geht eigentlich nicht: Wer in den Vereinigten Staaten Präsident werden will, muss sich zunächst in einem monatelangen parteiinternen Wettbewerb gegen mehrere Bewerber aus der eigenen Partei durchsetzen. Erst dann kann er vom Parteitag zum Kandidaten gekürt werden, ehe er in die eigentliche Wahlschlacht zieht. Da haben es in Deutschland potentielle Kanzlerkandidaten einfacher: Sie müssen die wichtigsten Strippenzieher in der eigenen Partei von sich überzeugen, aber keineswegs die Parteimitglieder. Die Nominierung auf dem Parteitag ist dann nur noch eine Formsache.
Der Funktionärseinfluss ist kleiner
Keine Frage: Aus der Sicht von Befürwortern von „mehr Demokratie“, von möglichst direkter Demokratie, hat Amerika es besser. Die Parteivorstände der beiden großen Parteien, Republikaner und Demokraten, haben so gut wie keinen Einfluss darauf, wer nominiert wird. Auch die meisten Delegierten der „Conventions“, die letztlich den Kandidaten nominieren, stehen keineswegs von vornherein fest. Sie werden vielmehr in Vorwahlen („Primary“) und in Parteiversammlungen („Caucus“) bestimmt, die Anfang Februar traditionell in Iowa und New Hampshire begonnen haben und sich noch bis Juni hinziehen.
Das System ist kompliziert und von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden. Aber seine Grundprinzipien sind einfach. Wer sich im staatlichen Wählerregister als „Republican“ oder „Democrat“ registriert hat, gibt auf der örtlichen Parteiversammlung oder im Wahllokal seine Stimme für seinen Wunschkandidaten ab. Diese Parteiversammlungen werden in zehn Staaten abgehalten; dort wird offen abgestimmt. In den meisten Staaten gibt es dagegen „Primaries“ mit geheimer Stimmabgabe. Je mehr Stimmen ein Kandidat in einem Staat bekommt, umso mehr auf ihn verpflichtete Delegierte entsendet dieser Staat zum Nominierungsparteitag. Dies ist im Grunde das Gegenteil der bei uns gerne kritisierten „Hinterzimmer-Politik“ bei der Kandidatenaufstellung. Viel mehr Basisdemokratie ist eigentlich kaum vorstellbar.
Es ist zudem ein offenes Auswahlsystem. Jeder, der will, kann sich bewerben. Er muss vorher noch nie ein politisches Amt ausgeübt haben, ja er muss nicht einmal in der Partei, deren Kandidat er werden will, aktiv gewesen sein. Das macht den Charme des Vorwahlen-Systems aus – und seinen großen Nachteil. Wollte in Deutschland ein Hinterbänkler aus einem Landesparlament plötzlich nach der Kanzlerkandidatur greifen, würde man über ihn den Kopf schütteln; kein Parteigremium würde sich jedoch mit dieser Kandidatur beschäftigen. In den USA hat dagegen jeder eine Chance, dem es gelingt, die öffentliche Aufmerksamkeit und die der Medien zu gewinnen. Dazu braucht er „nur“ zwei Dinge: eine Botschaft und Geld, viel Geld. Dabei spielt es keine Rolle, ob er den Wahlkampf durch Spenden oder aus der eigenen Tasche finanziert. Dass es aber auf „Botschaft plus Geld“ ankommt, zeigt sich jetzt gerade bei den Republikanern: Jeb Bush, Sohn und Bruder von Ex-Präsidenten, hatte eine prall gefüllte Wahlkampfkasse, aber keine Botschaft. Der exzentrische Milliardär Donald Trump dagegen hat beides.
Die Kandidaten-Legitimation ist größer
Eines ist sicher: Ein nach US-Regeln bestimmter Kandidat hat eine ganz andere Legitimation als ein von einem kleinen Führungszirkel ausgesuchter. Gleichwohl bleibt er das „Produkt“ einer Minderheit. Bei den Vorwahlen liegt die Wahlbeteiligung im ohnehin wahlfaulen Amerika weit unter 20 Prozent. Was wiederum den Einfluss gut organisierter Interessengruppen und Minderheiten überproportional erhöht. Jeb Bush ist unter anderem daran gescheitert, dass er der bestens organisierten „religiösen Rechten“ inhaltlich nicht entgegenkam; auch machte er den gleichfalls gut vernetzten radikalen Republikanern von der „Tea Party“-Bewegung keine Zugeständnisse. Hillary Clinton umgekehrt baut darauf, dass die politisch schlagkräftigen Organisationen der Schwarzen und Latinos sowie die Gewerkschaften ihr Wähler zutreiben.
Das US-Modell der Willensbildung von unten nach oben leidet freilich an einem gravierenden Nachteil. Weil man auch ohne jeden politischen Befähigungsnachweis Präsidentschaftskandidat werden kann, kann ein exzentrischer Unternehmer und schamloser Pöbler wie Donald Trump sich gute Chancen ausrechnen, am republikanischen Parteiestablishment vorbei nominiert zu werden. Auch Barack Obama hätte es unter deutschen Bedingungen vor acht Jahren nie ins höchste Amt gebracht. Als Kurzzeit-Senator hatte er 2008 politisch nichts vorzuweisen. Aber er war ein Mann mit einer Mission, mit Charisma und obendrein der mit Abstand beste Wählkämpfer seit Bill Clinton. Was zählte da die dürftige bisherige Leistungsbilanz des Kandidaten? Dass auch die Bilanz nach acht Jahren im Weißen Haus nicht viel besser ausfällt, war eigentlich absehbar.
Wer es gut mit der deutschen Demokratie meint, kann nicht einer „Demokratisierung“ à la USA das Wort reden. Zugegeben: Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Doch unter amerikanischen Bedingungen könnten sich in Deutschland ein Unternehmer wie Carsten Maschmeyer, ein Schauspieler wie Til Schweiger, eine Kirchenfrau wie Margot Käsmann oder ein Weltenerklärer wie Michel Friedman berufen fühlen, uns zu regieren. Dann doch lieber Angela Merkel oder Sigmar Gabriel, Frank-Walter Steinmeier oder Ursula von der Leyen. Die wissen wenigstens, wie man Politik schreibt.









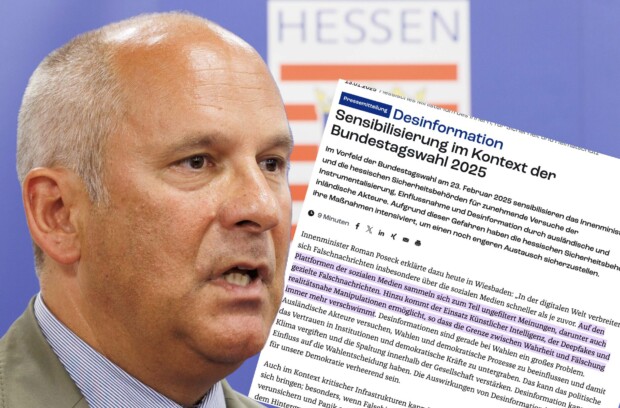



















Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein