Man muss nicht gleich die Zukunft rosarot zeichnen und voraussagen, dass innerhalb der nächsten 25 - 30 Jahre molekulare Maschinen existieren werden, so wie es das Nobelpreiskomitee tut. Aber tatsächliche Forschung ist ergebnisoffen.

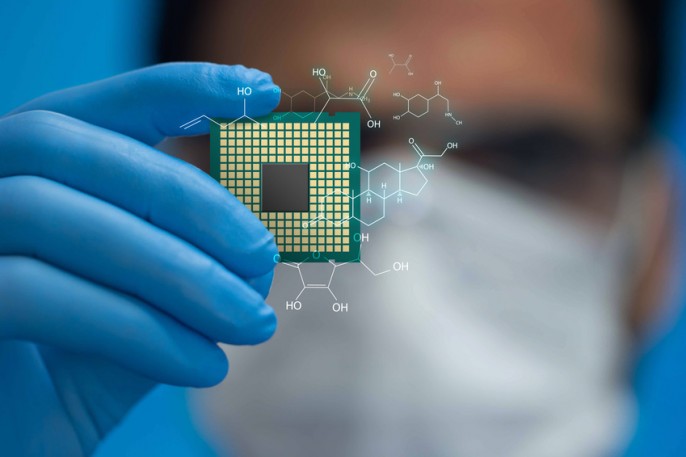 © Fotolia
© Fotolia
Motoren kann man so groß und mächtig bauen, daß sie die größten Schiffe der Welt antreiben, die mit 18.000 Containern oder randvoll mit Öl gefüllt durch die Weltmeere pflügen. Oder man kann sie so klein bauen, dass man sie mit bloßem Auge nicht mehr erkennen kann, sondern nur noch mit elektronischen Mikroskopen.
Diese Mikromotoren allerdings werden nicht mehr in großen Stahlwerken mit eindrucksvoller Gießerei und flüssigem Eisen, mit Umformen, Pressen, Stanzen produziert. Ihre Größe bewegt sich im Bereich von Milliardstel Metern. Alle Bestandteile sind aus Silizium gefertigt – so ähnlich wie die Chips in der Computerindustrie.
Dann kann man Maschinen tatsächlich noch kleiner bauen, wenn man in den berühmten Nanobereich geht. Aber hier sind noch relativ große Maschinen am Werke, Proteine nämlich, relativ große, teilweise mehrere Meter lange Molekülketten.
Die Reise ins Innere
Das beliebteste Element der Forscher in diesem Bereich ist das DNA-Molekül. Jenes Molekül mit der berühmten Doppelhelix gehört zu den am besten erforschten Molekülen, fast alle Eigenschaften sind bekannt. Eine Reise in das Innere dieser erstaunlichen Welten finden Sie hier.
In jeder Muskelzelle sind zum Beispiel winzige Motor-Proteine, die geringe Bewegungen angetrieben von geheimnisvollen ATP-Molekülen, die die Energie, die wir mit unserer Nahrung aufnehmen, in winzige Portionen aufgeteilt zu jedem einzelnen Motor-Protein bringen. Zusammen mit vielen Milliarden anderen Motor-Proteinen sorgen sie dafür, dass wir mit Hilfe unserer Armmuskeln einen Kasten Bier hochheben können. Diese Muskelproteine lassen sich die Biotechnologen von Bakterien zusammen bauen. Damit entstehen Maschinen im Nanobereich.
Gegossen wird bei der Herstellung von solchen Motoren auf molekularer Ebene zwar auch, aber nicht so wie bei unseren großen Schiffsdieseln. Hier schütten Chemiker Flüssigkeiten in Reagenzgläser. Auf Rütteltischen bewegen sich Glaskolben, Substanzen sollen sich bei genau kalkulierten Temperaturen gut durchmischen. Dann leisten Bakterien ihre Arbeit.
Doch es geht noch kleiner. Kleine Maschinen, die nach den Prinzipien der Organischen Chemie aufgebaut sind. In diesen Welten bewegt sich der neue Nobelpreisträger Ben Feringa und seine Forscherkollegen. Er arbeitet übrigens auch mit einer Arbeitsgruppe an Technischen Universität München zusammen.
Sie können nicht mehr Bakterien zu Hilfe ziehen, sondern müssen ihre Moleküle selbst aufbauen. Sie benutzen dazu die klassischen Arbeitsweisen, wie sie in der Biochemie seit langem verbreitet sind, also das Manipulieren von Atomen und Molekülen. Es ist eine Art Legospiel. Moleküle werden zusammengesteckt, die es vorher so noch nicht gegeben hat. Sie bauen neue Gerüste etwas aus Kohlenstoff-Molekülen auf oder suchen nach neuen Molekülen, die sich als Pharma-Wirkstoffe eignen.
Moleküle bauen
Entscheidend ist die geometrische Form der Moleküle, die über Stabilität oder Instabilität entscheidet. Ebenso darüber, wie gut sie sich mit anderen Molekülen verbinden oder eben nicht. Ähnlich wie bei einem Haus. Wenn das die falsche Geometrie hat, den falschen statischen Aufbau, fällt es zusammen. Dabei nutzen Biochemiker auch seit langem photochemische Reaktionen. Dabei wird Lichtenergie auf Kohlenstoff-Moleküle übertragen. Es gibt photolabile Substanzen, bei denen Bindungen geöffnet oder geschlossen oder sogar eine Drehbewegung angeregt werden, wenn Energie auf sie fällt.
Solche Versuche, Kohlenstoff-Ketten so zusammenbauen, dass sie beweglich sind, gibt es schon länger. Doch irgendetwas muss sie antreiben. Von allein bewegen sie sich meist nicht. Es muss also eine Zufuhr von Energie geben, die sie vorantreibt. Die muss außerdem gesteuert werden können wie der Motor beim Auto durch das Gaspedal. Keine leichte Aufgabe in der Nanowelt.
Nanoskala
Solche Motoren zu bauen, sind erst einmal witzige Spielereien auf der Nanoskala. Doch diese Arbeiten sind ein Meilenstein auf dem Weg, molekulare Maschinen kontrolliert über eine Oberfläche bewegen zu lassen. „Der bedeutende Schritt“, sagt Ben Feringa, „besteht darin, dass wir zeigen konnten, wie sich ein einzelnes Molekül auf einer Oberfläche in eine kontrollierte Richtung bewegt.“
Es bleibe aber noch viel zu tun, sagt etwa Ludwig Bartels von der University of California at Riverside. Wissenschaftler wie James Tour von der Rice University in Texas stellen sich vor, dass solche Nanomaschinen auch sinnvolle Tätigkeiten ausführen, zum Beispiel irgendwelche Strukturen im Nanobereich selbständig aufzubauen, so wie das Enzyme in jedem Organismus tun. Doch nur für solche witzigen oder originellen Arbeiten wie von Feringa & Co bekommt man als Wissenschaftler in der Regel den Nobelpreis. Für schnöde Alltagsarbeit, bei der der Irrtum überwiegt, eher nicht.
Feringas Mitpreisträger Jean-Pierre Sauvage fielen zwei Moleküle auf, die sich um ein Kupferion gelegt hatten, der Grundstein einer molekularen Maschine. Denn meist halten Bindungen von Elektronenpaaren Moleküle zusammen. Hier aber gab es plötzlich eine Bindung, die gleichzeitig beweglich war wie zum Beispiel ein Rad an einem Auto. Das hängt fest an der Achse, kann sich dennoch frei drehen. 30 Jahre lang ist Sauvage diesem Phänomen auf den Grund gegangen. Dem dritten Nobelpreisträger in Chemie, Sir James Fraser Stoddart, schließlich gelang es, ringförmige Moleküle zu entwickeln und die auch noch zu bewegen. Legendär ist sein »Nano-Aufzug«. Ringförmig angeordnete Moleküle konnten sich tatsächlich an einer Säule hinaufbewegen. Der Hub allerdings war für Nanomaßstäbe gewaltig, für uns eher gering einzuschätzen: 0,7 Nanometer, also ein Höhenunterschied von weniger als ein millionstel Millimeter.
Was dabei herauskommt und vor allem ob jemals etwas daraus entsteht, weiß zunächst niemand. Doch das ist kein Grund, es nicht zu tun.
Man muss nicht gleich die Zukunft rosarot zeichnen und voraussagen, dass innerhalb der nächsten 25 – 30 Jahre molekulare Maschinen existieren werden, so wie es das Nobelpreiskomitee tut. Wir seien am Vorabend einer neuen Revolution, meinen die Mitglieder des Komitees, das uns einen gewaltigen Schritt voran bringen werde. Es reicht, wenn uns allein solche Arbeiten sehr viel über den Aufbau jener Maschinen im Nanobereich lehren, die auch uns antreiben. Völlig ergebnisoffen Dingen auf den Grund gehen, ohne gar politisch vorprägte Orientierung zu forschen – das ist Wissenschaft. Was dann kommt, kann niemand wissen.
Einstein dachte, als er bei seinen epochemachenden Arbeiten auch das Phänomen der Zeitdilatation untersuchte, mit Sicherheit nicht daran, dass dieses Grundlagenwissen einmal dafür wichtig sein könnte, dass wir uns mit einem phantastischen System wie dem GPS auf der Welt metergenau orientieren können.




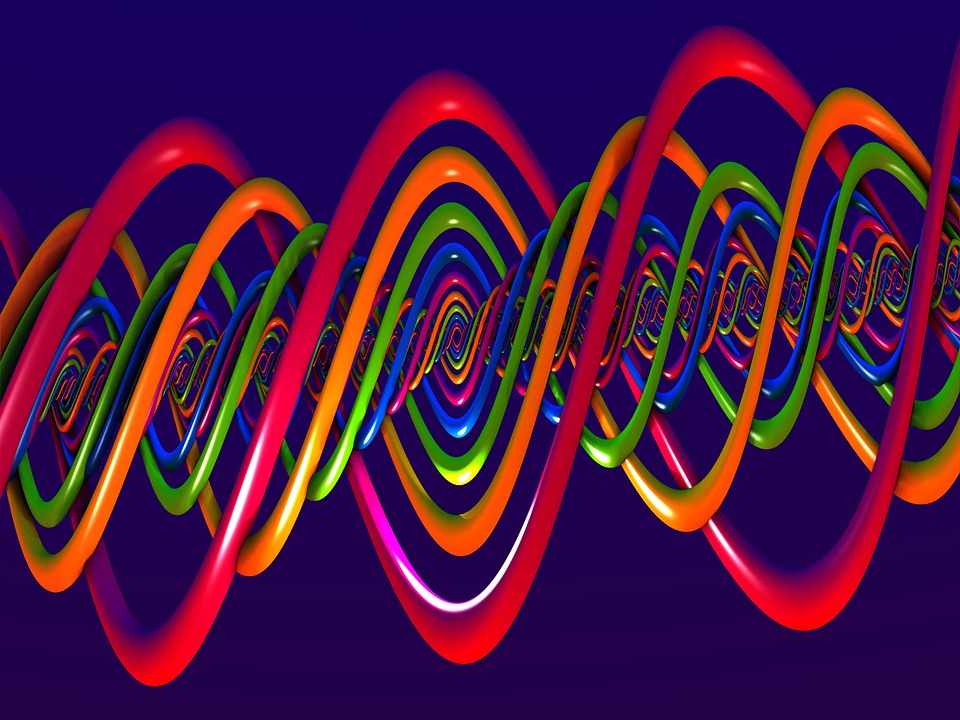
























Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein