In einer ablehnenden Gesellschaft hat die zivile Nutzung der Kernenergie nur Chancen, wenn sie sich neu erfindet: in neuen Märkten jenseits der Stromproduktion. Das ist möglich, denn die Kernspaltung bietet Optionen wie keine andere Technologie.
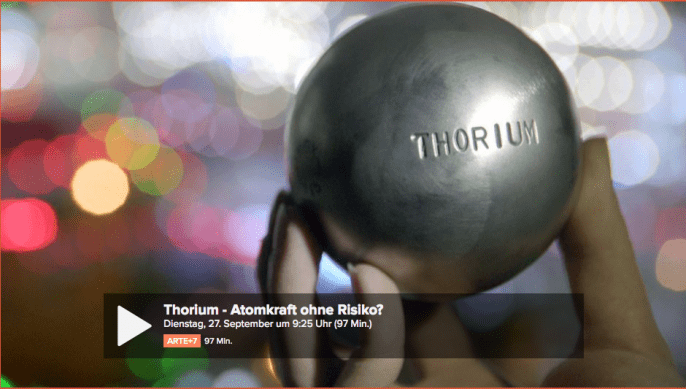 Screenshot arte
Screenshot arte
Vor einigen Jahren wurde meiner von einem hartnäckigen Schilddrüsenproblem geplagten Bekannten eine Therapie mit Jod 131 empfohlen. Tatsächlich verschwanden ihre Beschwerden nach zweimaliger Verabreichung. Jod 131 leistet bereits heute das, was futuristische Nanomaschinen versprechen. Eingebracht in die Blutbahn sammelt es sich in der Schilddrüse an und tötet dort mit ionisierender Strahlung gezielt das kranke Gewebe, als wäre es ein mikroskopisches Skalpell.
Jod 131 werden die meisten Menschen wohl nur aus der Berichterstattung über die Störfälle in den Kernkraftwerken von Tschernobyl und Fukushima kennen, bei denen es in großen Mengen freigesetzt und für allerlei besorgniserregende Schlagzeilen sorgte. Fälle wie der meiner Bekannten dagegen kommen in den Medien nur selten vor. Wäre es anders, hätte die Bevölkerung hierzulande vielleicht eine andere Einstellung zur Kernenergie. Jod 131 findet sich nämlich nicht in der Natur. Dieses Material gibt es nur, weil wir Atomkerne spalten. Eigentlich sollte in jeder nuklearmedizinischen Praxis ein Plakat hängen „Wir spalten Kerne für Ihre Gesundheit“. Denn daraus kann man nicht aussteigen.
Ein wenig Kernphysik
Ein Atom besteht aus einem Kern und einer Hülle. Der Kern enthält elektrisch positiv geladene Protonen und elektrisch neutrale Neutronen, in der Hülle befinden sich elektrisch negative Elektronen. Die Anzahl der Protonen im Kern bestimmt die Struktur der Atomhülle und diese wiederum definiert die chemischen Eigenschaften eines Elementes, insbesondere seine Neigung, sich mit anderen Elementen zu komplexeren Stoffen zu verbinden. Im Periodensystem der Elemente sind daher die bekannten Grundstoffe nach der Struktur ihrer Elektronenhülle sortiert. Dies ermöglicht dem Chemiker auf einen Blick eine erste Abschätzung darüber, wie eine gewünschte Verbindung hergestellt werden könnte. In gewisser Hinsicht ist das Periodensystem also die Sicht des Chemikers auf die Welt. Jedes Element hat darin eine Nummer, die Ordnungszahl, die die Anzahl der Protonen im Kern wiedergibt. Jod hat die Ordnungszahl 53. Wann immer man also ein Atom mit exakt 53 Protonen im Kern findet, ist es Jod und nichts anderes. Das natürlich vorkommende Jod enthält zudem 74 Neutronen, in Summe also 127 Kernbausteine. In diesem Text wird als einfache Schreibweise die Zahl der Nukleonen im Kern dem Elementnamen nachgestellt. Der vollständige Name des „normalen“ Jods lautet also Jod 127.
Tatsächlich gibt es von jedem Element unterschiedliche Isotope, die sich in der Anzahl der Neutronen im Kern unterscheiden. Jod 131 besteht ebenfalls aus 53 Protonen, hat aber 78 Neutronen im Kern. Dies ändert zwar nichts an seinen chemischen Eigenschaften, es ist in dieser Hinsicht von Jod 127 ununterscheidbar, wohl aber differieren verschiedene physikalische Parameter, beispielsweise die Masse. Jod 131 ist schwerer als Jod 127. Man könnte sagen: Die Struktur der Atomhülle bestimmt die chemischen, die Struktur des Kerns die physikalischen Eigenschaften eines Stoffes. So, wie das Periodensystem den Blick des Chemikers auf die Welt verdeutlicht, entspricht die sogenannte Nuklidkarte, in der die Stoffe nicht nach Ordnungszahl und Struktur der Atomhülle, sondern nach der Anzahl der Protonen und Neutronen im Kern angeordnet werden, dem Blick des Physikers.Eine interaktive Nuklidkarte mit allen bekannten Isotopenfindet man auf den Seiten der IAEA. Jod gibt es dieser Quelle zufolge in immerhin 38 verschiedenen „Sorten“, von Jod 108 bis Jod 145. Bis auf eben Jod 127 sind diese alle instabil, sie verwandeln sich über kurz oder lang in etwas anderes, indem sie ein Elementarteilchen an die Umgebung abgeben. In Jod 131 beispielsweise zerfällt eines der Neutronen im Kern mit einer Halbwertszeit von acht Tagen in ein Proton und ein Elektron. Letzteres macht sich auf den Weg, um beispielsweise in einer Schilddrüse kranke Zellen zu zerstören. Das Jod 131 verwandelt sich durch den Gewinn eines Protons in das stabile und physiologisch unbedenkliche Edelgas Xenon 131.
Bei den Isotopen der anderen Elemente stellt sich das ähnlich dar. Sie sind fast alle instabil und zerfallen auf unterschiedliche Weise bei Aussendung unterschiedlicher Strahlungsarten in unterschiedliche Tochterprodukte. Manche erleiden wie Jod 131 den sogenannten Beta-Minus-Zerfall, manche schicken aber auch ein Positron auf die Reise, wodurch sich im Kern selbst ein Proton in ein Neutron verwandelt. Manche entledigen sich einfach gleich überzähliger Neutronen oder gar eines Alpha-Teilchens (ein Helium-Kern mit zwei Protonen und zwei Neutronen). Einige schwere Kerne zerlegen sich von selbst in zwei leichte Tochterprodukte und einige Neutronen. Und vielen Nukliden stehen gleich mehrere dieser Möglichkeiten offen, für die sie sich mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten entscheiden.
Das Neutron als Werkzeug der Kerntechnik
Eine komplizierte und spannende Aufgabe hat die Natur da gestellt, will man etwas Nützliches wie Jod 131 erschaffen. Es besteht ja nur die Option, mit den vorhandenen stabilen oder zumindest sehr langlebigen Isotopen zu beginnen, um dann Kernreaktionen gezielt auszulösen und zu steuern, die über verschiedene Zwischenprodukte entlang der Nuklidkarte zum Ziel führen. Bei Jod 131 gelingt das sogar in einem Schritt. Uran 235 spaltet sich mitunter spontan in zwei leichtere Kerne auf, und einer davon ist häufig das medizinisch verwertbare Radionuklid. Allerdings geschieht dieser Zerfall sehr selten. Einfaches Anhäufen von Uran 235 und Abwarten genügt nicht, um Patienten wie meine Bekannte zu versorgen.
Mit Thorium zu freien Neutronen
Gebraucht wird eine neuartige Maschine als akzeptable Reaktionsumgebung einer nuklearen Kettenreaktion, die ausreichend freie Neutronen zur Herbeiführung der gewünschten Kernumwandlungen liefert. Akzeptabel bedeutet, einer leicht erregbaren Öffentlichkeit keine Nahrung für weitere Technologieverbote zu geben. In der anzustrebenden Anlage sollten daher sogenannte Transurane, also bestimmte Plutonium-Isotope, Neptunium, Curium, Americium und weitere erst gar nicht entstehen. Denn diese Stoffe stellen hochtoxische Materialien dar, die für sehr lange Zeiträume von einigen zehn- bis hunderttausend Jahren von der Umweltabgeschlossen zu lagern sind.
Uran 235 findet man nur in Verbindung mit Uran 238 und beide Stoffe sind kaum zu trennen. Trifft ein Neutron auf Uran 238, sorgt es in der Regel nicht für eine Spaltung. Sondern gliedert sich in den Kern ein und induziert über weitere sich anschließende Prozesse eine Transmutation hin zu eben den zu vermeidenden Aktiniden. Ein Uran 235/Uran 238-Reaktor erbrütet also zwangsläufig langlebigen und giftigen Atommüll, für dessen Behandlung es zumindest in Deutschland noch keine Lösung gibt.
Zusätzlich wäre auf Stoffe zu verzichten, die auf einfache Weise zum Bau von Kernwaffen verwendet werden können – zu groß sind die Befürchtungen vor einer Proliferation, möge diese im Hinblick auf den konventionellen Leichtwasserreaktor auch noch so unwahrscheinlich sein. Auch dadurch müssen Uran 235, Plutonium 239 und Plutonium 241 von der Liste gestrichen werden.
Es verbleibt Uran 233 als einzige denkbare Alternative. Das kann man zwar in keinem Bergwerk der Welt fördern, aber aus Thorium 232 herstellen. Und Thorium wiederum ist in der Erdkruste ungefähr so häufig wie Silber, also in mehr als ausreichender Menge vorhanden. Fängt Thorium 232 ein Neutron ein, entsteht Thorium 233. Dieses transmutiert nach einem Betazerfall weiter zu Protactinium 233. Ein weiterer Betazerfall schließt sich an und am Ende der Reaktionskette steht Uran 233.
Man könnte auf dieser Grundlage einen Reaktor bauen, der mit Thorium gefüttert wird. Herstellung und Transport von Brennelementen, also eine dem Einsatz im Reaktor vorgelagerte Fertigungskette, würden entfallen und damit auch alle diesbezüglichen Bedenken. Die Neutronenquelle, Uran 233, entstünde im Rahmen eines Brutprozesses erst im Reaktor selbst und würde dort auch wieder vollständig verbraucht. Uran 233 ist in der Nuklidkarte sehr weit von den Transuranen entfernt. Es hätte nacheinander sechs Neutronen einzufangen, ohne zwischenzeitlich gespalten zu werden, um in die Nähe von Plutonium zu kommen. Das ist überaus unwahrscheinlich.
Der Flüssigsalzreaktor
Zu dem neuen chemischen Konzept gesellen sich Anforderungen an die technische Realisierung, durch die Risiken nicht nur minimiert, sondern gleich vollständig ausgeschlossen werden. Wasser und Phasenübergänge zwischen Wasser und Dampf sind tabu. Aktive Kühlsysteme sollten nicht notwendig sein. Eine Kernschmelze darf unter keinen Umständen geschehen, selbst wenn, wie in Fukushima, sämtliche Betriebssysteme keine Energie mehr erhalten. Eine Freisetzung radioaktiver Materialien in die Umgebung darf nicht stattfinden, auch nicht bei vollständiger Zerstörung des Reaktors.
Und dann soll diese Maschine auch noch die einfache und kostengünstige Herstellung von Jod 131 gestatten. In herkömmlichen Kernkraftwerken wird der Kernbrennstoff in fester Form als Uranoxid in den Reaktor eingebracht. Dieses keramische Material weist einen sehr hohen Schmelzpunkt und eine hohe chemische Stabilität bei gleichzeitig geringer Wärmeleitfähigkeit auf. Das erhöht zwar die Betriebssicherheit, macht es aber fast unmöglich, aus den Brennelementen noch vorhandenen Brennstoff und die vielen Spalt- und Brutprodukte selektiv wiederzugewinnen.
Wären dagegen die Kernbrennstoffe und entsprechend auch die Spalt- und Brutprodukte in flüssiger Form vorhanden, könnte man die gewünschten Stoffe mit etablierten chemischen und physikalischen Methoden sogar während des laufenden Betriebs abscheiden.
Flüssige Salze, beispielsweise Fluoride, bieten sich als Trägermedien an. Eine Mischung aus Lithium- und Berylliumfluorid erscheint auf Basis früherer Entwicklungsarbeiten als besonders geeignet. Man kann nahezu alles darin lösen, auch Thorium, Uran und Brennelemente aus herkömmlichen Reaktoren. Ab etwa 400° C wird dieses Salz flüssig. Die erforderliche Wärme kann der Reaktor im Betrieb durch die ablaufenden Kernreaktionen selbst erzeugen, wobei er seine Temperatur im Rahmen einer durch die Auslegung vorgegebenen Bandbreite selbst regelt. Bei Erwärmung dehnen sich Flüssigkeiten aus, ihre Dichte sinkt und die freigesetzten Neutronen können mit entsprechend geringerer Wahrscheinlichkeit weitere Kernreaktionen auslösen. Die Wärmeerzeugung stoppt, die Temperatur fällt ab, die Dichte des Mediums steigt wieder an und die Zahl der Kernreaktionen und damit die Energieproduktion nehmen wieder zu.
Es wäre also für die Salzschmelze nicht möglich, heiß genug zu werden, um sich einen Weg in die Umwelt selbst zu bahnen. Sollte es aber durch eine äußere Einwirkung zu einem Leck kommen, würde das auslaufende Salz sofort erstarren und die radioaktiven Stoffe in einer glasartigen Masse sicher einschließen. Eine Kontamination von Flächen außerhalb des eigentlichen Reaktorgebäudes wäre ausgeschlossen. Oder genauer ausgedrückt: Die Naturgewalt, die das erreichen könnte, hätte ein Ausmaß, bei dem die Freisetzung radioaktiver Stoffe nicht mehr von Belang wäre.
Man kann sich so eine Maschine im Prinzip als eine Ansammlung von Röhren vorstellen, in der flüssige Salze bei hohen Temperaturen in unterschiedlichen Kreisläufen zirkulieren. Da wäre beispielsweise der Kernkreislauf, in dem Uran 233 über eine Kettenreaktion gespalten wird und dabei ständig Energie und freie Neutronen produziert. Ein Teil dieser Neutronen gelangt über einen Moderator, der ihre Energie auf einen optimalen Bereich einstellt, in den Thorium-Kreislauf, um aus Thorium 232 wieder neues Uran 233 zu erbrüten, das dann aus dem Thorium-Kreislauf entfernt und wieder dem Kernkreislauf zugeführt wird.
Alle Spalt- und Brutprodukte sind ebenfalls im flüssigen Salz gelöst. Manche gasen von selbst aus, vor allem technisch nutzbare Edelgase, die entsprechend einfach aufgefangen und ihrer weiteren Verwertung zugeführt werden können. Manche, etwa Jod 131, deren Produktion momentan auf komplizierte und teure Weise durch die Bestrahlung von Proben in dafür eingerichteten Forschungsreaktoren geschieht, können elektrolytisch oder durch eine Art Destillation aktiv herausgefiltert werden.
Ein neues Paradigma für die chemische Produktion
Der Thorium-Flüssigsalzreaktor, auch TMSR für Thorium Molten Salt Reactor oder Lifter für Liquid Fluoride Thorium Reactor genannt, ist vor allem eine chemische Fabrik. Er erfüllt den alten Traum mittelalterlicher Alchemisten, mittels des „Steins der Weisen“ Elemente ineinander umwandeln zu können, weil er gestattet, aus Thorium so ziemlich jeden Stoff auf der Nuklidkarte zu gewinnen. Dazu zählen Radionuklide für die Medizin wie eben Jod 131, aber auch Strontium 89, das gegen Knochenkrebs hilft, oder Erbium 169, das Linderung bei Arthritis verspricht, und viele, viele andere. Dazu zählen Energieträger wie Plutonium 238 für Raumsonden und Marsrover wie Curiosity. Dazu zählen Materialien für Sensoren aller Art, etwa Strontium 90 zur Schichtdicken-und Cäsium 137 für Strömungsmessungen. Dazu zählen Helium 4 als Inertgas und für die Tieftemperaturtechnik und Krypton 85 für leuchtstarke Xenon-Lichtbogenlampen. Dazu zählen Industriemetalle wie Molybdän, Palladium und Neodym als stabile, nicht mehr radioaktive Endprodukte vieler Kernreaktionen. Und dazu zählen zahllose andere Isotope, deren Potential mangels Verfügbarkeit bislang kaum erforscht ist. In einem Flüssigsalzreaktor könnte auch der bislang angefallene „Atommüll“ vollständig vernichtet und in Wertstoffe verwandelt werden. Die Suche nach einem Endlager hätte sich erledigt.
Mit der klassischen Chemie bis hin zur Gentechnik hat die Menschheit die Fähigkeit erworben, die Struktur von Molekülen zu verändern. Durch die Nanotechnologie gelingt es ihrmittlerweile sogar, einzelne Atome zu manipulieren. Die Kerntechnik ist die logische Fortsetzung dieser Kette, denn mit ihr ist die Möglichkeit verknüpft, den Aufbau des Atomkerns selbst zu beeinflussen und chemische Elemente ineinander umzuwandeln. Noch stehen wir an dieser Stelle ganz am Anfang. Der Thorium-Flüssigsalzreaktor als neues Werkzeug öffnet eine Schnellstraße in diese neue Welt der chemischen Produktion, wo bislang nur holprige Feldwege vorhanden waren.
Warum hat man diese Wundermaschine bislang nicht gebaut, werden sich nun viele Leser fragen. Man hat. Zumindest prototypisch, aber durchaus erfolgreich. Warum wurde dann dieses Projekt nicht fortgesetzt? Weil der US-Administration zu Beginn der 1970er Jahre die Fähigkeit schneller Brutreaktoren zur Herstellung waffenfähigen Materials wichtiger war. Und warum greift man dieses Thema nun nicht wieder auf? Man greift es auf. Aber das ist dann die nächste Geschichte …































Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein