Robert Spaemanns Tod hinterlässt eine schmerzliche Leere. Doch sein Denken wird auch in Zukunft als Schlüssel zum Verständnis der Moderne dienen.
Migration ungebremst, Wirtschaft schwach, Schulden steigen.
Noch nie war eine neue Regierung so unbeliebt, die Wähler so frustriert.
Darauf reagiert die Regierung Merz mit wachsenden Angriffen auf freie Medien:
Kontrolle, Gedankenpolizei, jeder Kritiker ist „rechts“ und wird vor Gericht gezerrt.
Danke, dass Sie uns als kritisches Medium unterstützen.
Nur scharfe Kritik bewirkt Veränderung.
Deutschland hat eine der letzten großen Denkergestalten des zwanzigsten Jahrhunderts verloren, auf die es für immer stolz sein kann. Robert Spaemann ist auf der ganzen Welt anerkannt als einer der bedeutenden Philosophen unserer Zeit, die über Jahrhunderte zementierte Einseitigkeiten und Sackgassen der Interpretation des Verhältnisses des Menschen zur Welt und seinem Leben radikal revidiert und ihnen gegenüber den ganzen Reichtum jener einzigartigen Lebensform neu erschlossen haben, die in der abendländischen Geschichte mit Sokrates, Platon und Aristoteles ihren Anfang genommen hat und bis heute lebendig geblieben ist.
Der unrelativierbare Kern dieser Lebensform ist das unerschütterliche Vertrauen auf Vernunft und Wahrheit als die Leitprinzipien unseres Daseins von seinem Anfang bis zu seinem Ende. Den bedeutenden Philosophen macht es aus, dass er sie nicht nur, wie Kant in seinem „Weltbegriff“ der Philosophie sagt, „als Lehrer der Weisheit in Lehre und Beispiel“ vorlebt, sondern dass er sie aus sich selbst heraus noch einmal auf eine Weise zu begründen vermag, die man so nur bei ihm findet. Das ist Robert Spaemann gelungen, indem er die denkerische Besinnung neu und wieder auf einen Leitbegriff gerichtet hat, von dem her die großen griechischen Denker den „Sitz im Leben“ bestimmt haben, der uns allein die Bedeutung zu verstehen erlaubt, die Vernunft und Wahrheit für uns haben. Dieser Leitbegriff ist der Begriff der Natur, den Spaemann wie kaum ein Zweiter im zwanzigsten Jahrhundert neu in der Mitte des philosophischen Denkens verankert hat.
So verstanden, hat der Mensch selbstverständlich eine, seine Natur; sie ist es, wodurch er sich von allen anderen natürlichen Wesen unterscheidet, ohne deshalb aus „der Natur“ herauszufallen oder ihr gegenüberzustehen. Das Natürliche am Menschen ist das, wodurch er sich von allen Tieren unterscheidet, und ihn in dieser Einzigartigkeit zu respektieren, das ist die Leitlinie, an der sich Gesellschaft und Kultur orientieren müssen, wenn Vernunft und Wahrheit unser Leben bestimmen sollen.
In diesem Rückgang auf den klassischen Naturbegriff hat sich Robert Spaemann immer als Verteidiger einer Tradition begriffen, die angesichts der Engführungen, die aus dem seit langer Zeit wirksamen Missverständnis des Natürlichen als des Tierischen am Menschen neu zur Geltung und begrifflichen Klärung gebracht werden muss.
In der, sei es zynisch betriebenen, sei es mitläuferhaft übernommenen Zurückweisung der Selbstverständlichkeit der dem Menschen natürlichen Lebensformen hat Spaemann die Macht am Werk gesehen, die er als die der radikalen Entgegensetzung zur Vernunft und Wahrheit vom griechischen Denken nicht adäquat eingeholte Macht begriffen hat, die Macht des Bösen. Die Sünde und die sie nachvollziehbar machende Geschichte von Urstand und Fall des Menschen sind für ihn Grenzmarkierungen gewesen, denen sich das philosophische Denken um seiner selbst willen anzunehmen hat und die insofern nicht schon Sache einer Offenbarung auslegenden Theologie sind. In seinem großen Buch über die Person hat er das für unser Dasein spezifische, das freie Verhältnis des Menschen zu seiner Natur zu dem Grundgesichtspunkt gemacht, unter dem man als eine der essentiellen Implikationen – nicht Voraussetzungen – des Menschseins die mögliche Entscheidung gegen die Natur und damit die unter Umständen sehr vernünftelnd und zungenfertig daherkommende Entscheidung gegen Vernunft und Wahrheit erkennen muss. Es gehört zu den Implikationen der humanen Natur, dass das sie habende Wesen inhuman sein und handeln kann. Auch das ist ein Spezifikum des Menschen.
Der Autor Walter Schweidler ist Professor für Philosophie an der Katholischen Universität Eichstätt. Er habilitierte sich und war Assistent bei Robert Spaemann. Sein Beitrag erschien zuerst in Die Tagespost. Katholische Wochenzeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur, der wir für die freundliche Genehmigung zur Übernahme danken.







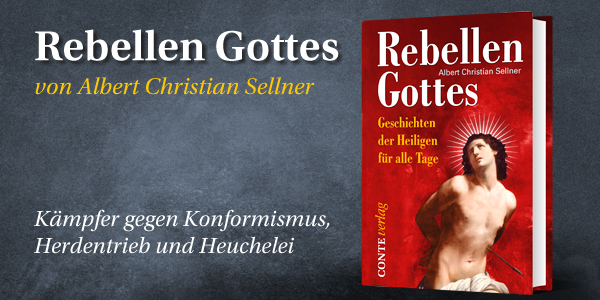






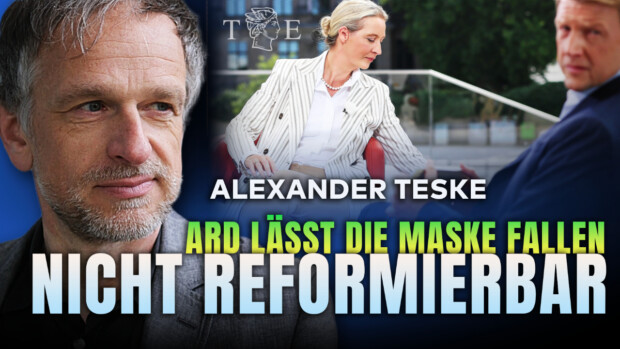






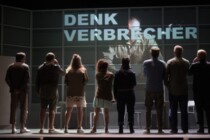

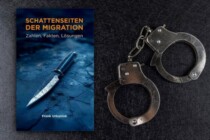








Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
Der dreieinige, zeitlos ewige Gott ist glücklicherweise nicht davon abhängig, was das jeweilige Menschenhirn sich so alles ausdenkt, um ihn unters Mikroskop zu legen und zu sezieren, damit man ihn endlich in den Griff kriegt. Ich meine, diese Versuche sind bis heute und für alle Ewigkeit gescheitert. Man muß auch nicht, er ist ja in Christus erkennbar und befragbar, soweit hat er sich aus seinem Absconditum für uns menschenoffenbart. Und das genügt. Daneben kann man durchaus zur Verstandesertüchtigung die philosophischen Modelle des „Anfangs“ studieren. Dabei kommt dann gelassene Heiterkeit durchaus auf. Zum Teil auch Schwindel. Und: Die Vernunft wird sich… Mehr
Ich habe keine religiösen Gefühle, nur Glauben. Insofern kein Problem. Und: Er kann, da bin ich bei Ockham. Aber er hat sich festgelegt und will nicht, da bin ich bei Christus. Darüber hinaus gibt es wohl nur Spekulation.
„Die SPD braucht dringend eine neue Lichtgestalt …“ – Aber woher nehmen? Z.Zt. sehe ich dort nur republikanische Wichtgestalten, die ihre Wähler verjagen, Abtreibungen bis kurz vor der Geburt befürworten und Deutschlands Zukunft zerstören. – An Brandt sollte vielleicht auch einmal das ziemlich unerträgliche Pathos seiner sich meist aufgeblasen dahinschleppenden Reden herausgestellt werden. Weltpolitik hat er bestimmt nicht gemacht und nach 1974 (Rücktritt) realpolitisch eigentlich nur noch quergeschossen und sich als Sozialistischer Internationalist inszeniert, der der Anti-Sadam-Hussein-Koalition dann (1990) auch noch als ‚Geiselbefreier‘ (Konzessionär eines üblen Geiselnehmers) in die geplante militärische Kuweit-Befreiung hineingrätschte.
Sorry, Kommentar versehentlich falsch plaziert! Richtig wäre die Zuordnung zum letzten Beitrag von Josef Kraus (Buchrezension Wolffsohn): https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/buecher/friedenskanzler-willy-brandt-nicht-vom-sockel-geholt-aber-einen-sockel-tiefer-gestellt/