An der Debatte zu den Übergriffen zu Silvester zeigt sich: Neuerdings verbindet etwas Gemeinsames Frauen- und Judenhasser. Und auffällig ist, dass Frauen mehr Mitleid mit den männlichen Tätern zeigen als mit ihren Geschlechtsgenossinnen.


Über die Silvesternacht in Köln ist inzwischen alles gesagt worden. Jetzt muss abgewartet werden, was die polizeilichen Ermittlungen ergeben, ob es zu Strafverfahren kommt und ob am Ende Urteile gesprochen werden. Das kann eine Weile dauern. Genug Zeit, um über eine Auffälligkeit nachzudenken, die bislang unbeachtet blieb: Wie kommt es, dass die absurdesten, gemeinsten und frauenfeindlichsten Kommentare von Frauen geschrieben wurden, die mehr Verständnis für die Täter als Mitgefühl für die Opfer der Attacken äußerten?
Die das Geschehen so lange eigenwillig interpretierten, fleißig kontextualisierten und radikal relativierten, dass man sich am Ende fragen musste: Wozu die ganze Aufregung? Passiert so etwas nicht überall und immerzu? Was war denn an Köln so besonders?
Die „Rape Culture“, die Kultur der Vergewaltigung, „die offenbar die Kölner Silvesternacht geprägt hat“, so konnte man zum Beispiel im Berliner „Tagesspiegel“ lesen, sei doch „auch Teil der deutschen Kultur“. Denn: „Die weitaus meisten sexuellen Übergriffe und Vergewaltigungen sind nicht Taten von Bahnhofshorden, sondern werden von den eigenen Männern und Freunden begangen.“
Noch bemerkenswerter als diese Logik, die man mühelos auch auf Mord und Totschlag anwenden könnte, war der Umstand, dass dieser Beitrag von zwei Frauen geschrieben wurde. Die eine hat sich auf Umweltberichterstattung mit den Schwerpunkten Klimawandel und Energiewende spezialisiert, die andere auf Migration, Minderheiten, Bürgerrechte und Geschlechterpolitik.
Die Zusammenarbeit führte zu einer Hypothese, die mitnichten ironisch gemeint war: „Womöglich sind aber auch Frauen dabei, die gar nicht Opfer geworden sind, sondern aus politischer Überzeugung der Meinung waren, dass die Täter mit Migrationshintergrund oder die Flüchtlinge, die das Chaos auf der Domplatte für sexuelle Übergriffe ausgenutzt haben, abgeschoben gehören. Das hoffen sie womöglich mit einer Anzeige zu beschleunigen.“
Nicht die Männer hatten es also auf die Frauen abgesehen, sondern die Frauen auf die Männer, um den Behörden einen Grund zu geben, die mutmaßlichen „Täter mit Migrationshintergrund“ abschieben zu können. Offen blieb nur, ob die Frauen tatsächlich sexuell belästigt worden waren oder die „Übergriffe“ erfunden hatten, um ihr Ziel zu erreichen. In diesem Fall muss die Vernetzung optimal gewesen sein, anders wäre eine „konzertierte Aktion“ in zwölf Bundesländern nicht zu erklären.
Nicht Ausländer, „Arschlöcher“ waren es
Der „Tagesspiegel“-Artikel war womöglich der krasseste seiner Art, aber bei Weitem nicht der einzige. Das Wort von der „Rape Culture“ zog sich wie ein Leitmotiv durch die Beiträge, unterfüttert mit dem Hinweis, dass Vergewaltigung in der Ehe erst vor Kurzem zur Straftat erklärt wurde. Sehr beliebt war ebenfalls die Feststellung, dass auch im Karneval und beim Oktoberfest sexuelle Übergriffe an der Tagesordnung wären. Die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali fasste alle diese Erkenntnisse auf ihrer Facebook-Seite in einem Satz zusammen: „Nicht Ausländer, sondern Arschlöcher belästigen Frauen“, was man durchaus als eine neue Variante des Generalverdachts, diesmal gegenüber der bisher unbescholtenen Spezies der Arschlöcher, verstehen konnte.
Und, wie gesagt, alle diese Beiträge, in denen bis zur Selbstverleugnung differenziert wurde, trugen die Signatur von Frauen. Männer, die zu der Horrornacht Stellung nahmen, distanzierten sich derweil vorbehaltlos von den Tätern. (Ausnahme: Jakob Augstein, der von einem Flashmob fantasierte.) Ein grüner Politiker in Hamburg ging sogar so weit zu sagen, jeder Mann sei „ein potenzieller Vergewaltiger, auch ich“.
Um das Bild abzurunden, soll hier noch ein weiteres Beispiele für ein Verhalten genannt werden, das alle Grenzen der Fürsorge überschreitet. Amelie Fried, erfolgreiche Autorin, Fernsehmoderatorin und bei Bedarf auch Feministin, schrieb in einem kurzen Essay, wie sie vor Jahren mit ihrer Familie ein Weihnachtsfest für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ausrichtete. Es gab Lebkuchen, Obst und Süßigkeiten, und man hat zusammen „Stille Nacht, heilige Nacht gesungen“. Allerdings: „Am Ende der Feier war unsere Gitarre verschwunden.“
Amelie Fried und ihre Gitarre
Zuerst, erinnert sich Frau Fried, sei sie „enttäuscht“ gewesen, dann „belustigt“ und schließlich „beschämt“. Wie „um Himmels Willen“ habe sie nur annehmen können, „die Jugendlichen müssten uns dankbar sein“?
Es war genau andersrum. „Wir hatten Grund, ihnen dankbar zu sein. Sie haben uns mit einem Schlag die Relationen wieder zurechtgerückt, die uns verrutscht waren.“ Und: „Wir waren froh, dass die Jungs unsere Gitarre behalten hatten. Die Lektion, die wir dadurch gelernt haben, war deutlich mehr wert als das Instrument.“
So lägen die Dinge auch heute. Es müsse demütigend sein, „von uns nehmen zu müssen“. Aber, wir könnten „diesen Menschen ein Stück ihrer Würde zurückgeben, indem wir keine Dankbarkeit erwarten“. Und uns immer sagen: „Wenn wir es schaffen, diese Menschen gut in unser Land zu integrieren, wird eines Tages mehr von ihnen zurückkommen, als wir ihnen jemals gegeben haben.“
Auch Frau Frieds Menschlichkeit ist nicht frei von Kosten-Nutzen-Überlegungen. Die Flüchtlinge als Humankapital, in das man investieren muss, damit die Rendite stimmt. Sonst könnte man gleich griechische Staatsanleihen kaufen. Ist das alles, was Amelie Fried gelernt hat, nachdem die Jungs „ihre Gitarre“ behalten haben?
Frauen und Juden
Es steht ihr frei, ihren iPad, die iPods ihrer Kinder und das iPhone ihres Mannes herzugeben, in ihrem Wohnzimmer eine Suppenküche einzurichten und so viele Benefiz-Abende auszurichten, wie es ihr Terminkalender zulässt. Sie möge bitte nur nicht behaupten, sie habe irgendeine Lektion gelernt. Denn sie hat, wie viele ihrer Mitstreiterinnen, bis heute nicht begriffen, was in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar in Köln und an anderen Orten passiert ist.
Es war ein Pogrom. Erstaunlich nur, das bis jetzt niemand auf diesen Begriff gekommen ist, wo doch alle, die sich ungerecht behandelt fühlen, von den Vegetariern bis zu den „KZ-Hühnern“, darum wetteifern, „die Juden von heute“ zu sein.
Armlänge zeigen
Nun sind Frauen, anders als die Juden, keine Minderheit. Und niemand bereitet die „Endlösung der Frauenfrage“ vor. Aber der Hass auf Juden und der Hass auf Frauen sind nahe Verwandte. (Wer es genauer wissen möchte, sollte „Geschlecht und Charakter“ von Otto Weininger lesen.) Altes Kulturerbe, das nachwirkt, allen Erfolgen der Emanzipation und den Bemühungen der Gleichstellungsbeauftragten zum Trotz.
Dass der ewig wandernde Jude inzwischen in Israel sesshaft geworden ist und so manches Land und manche Institution von Frauen regiert wird, hat weder an dem einen noch dem anderen Ressentiment etwas geändert. Sowohl Frauen- wie Judenhasser fühlen sich von den Objekten ihrer Wut herausgefordert, provoziert. Kein Antisemit, der nicht „dem Juden“ die Schuld dafür geben würde, was er ihm antun musste; und kein Vergewaltiger, der die Frau, die er vergewaltigt hat, nicht dafür verantwortlich machen würde, was ihr zugestoßen ist.
Es gibt noch mehr Parallelen. Der Vorsitzende des Zentralrates der Juden, Josef Schuster, hat vor Kurzem rhetorisch angefragt, „ob es tatsächlich sinnvoll ist, sich in Problemvierteln, in Vierteln mit einem hohen muslimischen Anteil als Jude durch das Tragen der Kippa zu erkennen zu geben – oder ob man da besser eine andere Kopfbedeckung trägt“. Die Kölner Oberbürgermeisterin, Henriette Reker, hat den Frauen in ihrer Stadt geraten, „eine Armlänge“ Abstand zu Fremden zu halten und „sich in Gruppen zusammenzufinden, sich nicht trennen zu lassen, auch nicht in Feierlaune“.
Frauen und das Stockholm-Syndrom
Sich unsichtbar zu machen, nicht aufzufallen taugt als Vorsichtsmaßnahme ebenso wenig wie die Flucht in die Gruppe. Der Frauenhasser wird ebenso wie der Judenhasser immer einen Grund finden, seinen inneren Schweinehund von der kurzen Leine zu lassen. Wenn es nicht das Aussehen ist – Kippa und Schläfenlocken da, Minirock und bauchfreies Top dort – dann ist es eben das freche Auftreten und ganz am Ende der Argumentationskette die Tatsache, dass der Jude ein Jude und die Frau eine Frau ist. Das reicht.
Bleibt am Ende die Frage, warum es ausgerechnet manchen Frauen der gebildeten Stände schwerfällt, diesen Zusammenhang zu begreifen, warum sie in dem Aggressor jemand sehen, den sie therapieren wollen.
Ist es der Ausdruck unterdrückter Mütterlichkeit? Oder ein Akt vorsorglicher Unterwerfung? Also das Verhalten von Sklaven, pardon: Sklavinnen, eine frauenspezifische Variante des Stockholm-Syndroms?
„Wir sind … eine Einwanderergesellschaft“, verlautbarte nach der langen Kölner Nacht eine links-alternative Kommentatorin im Deutschlandfunk, mit und unter uns würden „nun auch Einwanderer mit einem archaischen, sexistischen Frauenbild“ leben. „Die müssen in die Verantwortung genommen und nicht weggeschoben werden. Das ist übrigens auch die einzige Art, wie man die Angst vor dem Fremden los wird: ihn zu einem Bekannten zu machen.“ Notfalls um Mitternacht auf dem Platz vor dem Hauptbahnhof.
Jetzt müssen wir es nur noch schaffen, diese Menschen in unser Land zu integrieren, damit wir eines Tages mehr von ihnen zurückbekommen, als wir ihnen jemals gegeben haben. Und wenn alles gut geht, wird auch eine neue Gitarre für Amelie Fried dabei sein.
Dieser Beitrag ist auf WeLT.de und der Achse des Guten erschienen.


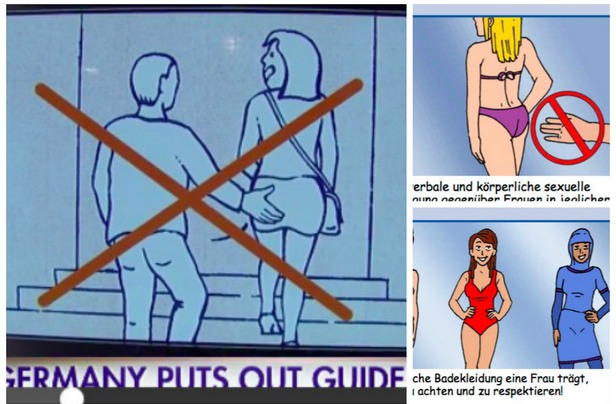
























Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein