Fünf Jahre nach Beginn von Corona sind die Gräben in unserer Gesellschaft tiefer denn je. Dr. Friedrich Pürner setzt sich mit den Folgen von Ausgrenzung, mangelnder Aufarbeitung und der schwierigen Frage auseinander, ob Vergebung möglich ist, nachdem Kritiker vielfach vernichtet worden waren..
 picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt
picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt
Der 5. Jahrestag der Corona-Pandemie steht vor der Tür und erinnert uns an die tiefen Risse, die in unserer Gesellschaft entstanden sind. Diese Risse sind nicht einfach nur physikalische Distanzierungen. Sie haben sich zu Gräben moralischer, sozialer und politischer Natur ausgeweitet, die schwer zu überbrücken sind. Es ist ein Moment der Reflexion, ein Zeitpunkt, in dem ich mich frage, wie wir als Gemeinschaft weitergehen können, nachdem wir so viel durchgemacht haben. Wir, die Ausgegrenzten. Die Ungeimpften. Die Ausgestoßenen. Die Hinterbliebenen von Covid-Toten. Selbst habe ich keinen mir nahestehenden Menschen in meiner engeren Familie durch COVID verloren. Andere schon.
Am eigenen Leib habe ich erfahren müssen, wie es ist, ausgegrenzt und von der Gesellschaft verstoßen zu werden. Die volle Härte des Staates, des Systems bekam ich zu spüren. All dies nur, weil ich das sagte und schrieb, was nun durch die offenen Protokolle des RKI für jeden sichtbar ist. Doch wie geht man damit um? Ja, ich wurde in dieser Zeit verletzt. Nicht körperlich. Vielmehr im Inneren. Meine Seele, mein Herz wurden von Menschen, die mir nahestanden und denen ich vertraute, beschädigt. Beruflich und privat.
Es ging nie um Solidarität
Während ich mit vielen anderen Mitstreitern für die Demokratie und die Grundrechte eintrat, wollten andere nur ihre Freiheit zurück. Urlaub, Freiheit, Spaß. Es ging nie um echte Solidarität. Es war der pure Eigennutz, der viele unter Masken und in die Impfung trieb. Genau von diesen Menschen kamen der größte Druck, die größten Anfeindungen, die schlimmsten Vorwürfe sowie die schrecklichsten beruflichen Einschnitte für mich, die ich jemals zu erdulden hatte. Doch wie geht man damit um? Es ist schwer. Sehr schwer. Je mehr Zeit vergeht und je deutlicher zum Vorschein kommt, dass viele Antreiber und Verantwortliche dieser Maßnahmen kein ehrliches Interesse an einer Bitte um Verzeihung oder an Wiedergutmachung haben, umso schwerer wird es für mich, meine buddhistische Gelassenheit und den inneren Frieden zu bewahren. Für mich stellt sich öfter die Frage: weshalb sollte ich weiterhin moralisch und ethisch besser handeln als die, die es nicht tun. Ich merke, wie mir die Kraft schwindet, meinen moralischen Kompass in dieser Sache aufrecht zu halten.
Vor Corona mochte ich einen bestimmten Showmaster. Ich fand ihn und seine Quiz-Sendung genial. Voller Vorfreude wartete ich auf die nächste Sendung. Dann, in der Corona-Zeit, warb er dafür, daheim zu bleiben, sich impfen zu lassen. Mit seinem Gesicht und Bekanntheitsgrad setzte er damit andere Menschen sozial unter Druck. Dabei stellte sich heraus, dass er zum Zeitpunkt der Werbung wohl selbst gar nicht geimpft war. Neulich sah ich ihn wieder im TV. Ich wollte sehen, ob ich ihn wieder ertragen kann. Es gelang nicht. Er war wie immer. Charmant, witzig, klug. Aber das half alles nichts mehr. Ein düsterer Schleier umgibt seine Aura. Ich kann ihn nicht mehr ertragen. So geht es mir mit vielen Menschen. Tolle Schauspieler beispielsweise. Nun kämpfe ich mit mir selbst, dass ich meinen Anspruch an mich selbst haltend, Werk und Mensch trennen kann – aber es gelingt mir kaum mehr.
Ebenso ist es mit Zeitungen – hier namentlich die Süddeutsche Zeitung. Als junger Mann und Student war ich verrückt nach diesem Blatt und verschlang es regelrecht. Was wäre ein Frühstück am Wochenende ohne ausführliche Lektüre dieser Zeitung gewesen? Unvorstellbar. Jeder Tag musste mit dem sog. „Streiflicht“ beginnen. Und nun? In der Corona-Zeit habe ich diese Zeitungslektüre eingestellt. Ich ertrug diese schlechten Artikel über Medizin nicht mehr. Es war nicht mehr auszuhalten, dass die Schreiberlinge so ungeheuerlich auf Menschen, die nur Kritik übten, eindroschen.
Verzeihen ist ein großes Wort
Immer wieder wurde ich gefragt, ob ich das alles verzeihen könne. Gemäß meiner inneren Einstellung antwortete ich mit „Ja“. Ich hoffe, ich habe mich nicht getäuscht und mir selbst nichts vorgemacht. „Vergessen würde ich jedenfalls das alles nicht“, war meine ständige Antwort.
Doch weshalb bin ich mir plötzlich nicht mehr sicher, ob ich verzeihen kann? Ob ich tatsächlich verziehen habe? Der zunehmende Groll zeigt mir, dass ich darüber nicht hinweg bin. Wie wird es wohl dann den Menschen in der Gesellschaft gehen, die niemals vor hatten, zu verzeihen?
Woran liegt es, dass mir nun öfter der Gedanke kommt, nicht mehr den Dialog mit den damaligen Ausgrenzern zu suchen? Mit denen, die mich isolierten, diffamierten, verspotteten und betrogen? Woran liegt es, dass ich plötzlich nicht mehr zwischen Künstler und Werk differenziere und allgemein einfach den Künstler samt seiner Kunst ablehne? Womöglich, weil ich es leid bin. Denn das Thema Aufarbeitung, zu der ganz sicher das Eingeständnis von Schuld und Übernahme von Verantwortung gehört, ist selbst nach fünf Jahren der Pandemie nicht ernsthaft zu spüren. Kein Wort des Bedauerns.
Erst in den letzten Wochen begann in den Medien und bei ein paar Politikern ein leichtes Zucken. Wie so oft wird es auch wieder verebben. Besonders auffällig ist die plötzliche Wende bei denjenigen, die einst die strengsten Maßnahmen befürworteten – Politiker und Medien, die jetzt eine Aufarbeitung und Vergebung fordern. Aber warum jetzt? Warum verlangen dieselben Personen, die uns in diese Krise führten, nun Frieden und Versöhnung?
Diese Wende könnte auf politischem Kalkül beruhen. Vielleicht haben die Corona-Hardliner erkannt, dass ihre einstigen Entscheidungen jetzt ein selektiver Stolperstein sind. Die Menschen, die durch die Maßnahmen hart getroffen wurden – sei es durch Jobverlust, soziale Isolation, psychische Belastungen oder persönliche Tragödien – sind nicht bereit, einfach hinzunehmen, was geschehen ist. Sie wollen Antworten, sie wollen Gerechtigkeit, und das könnte die politische Landschaft drastisch verändern. In einem Versuch, das Vertrauen zurückzugewinnen oder zumindest den Schaden zu begrenzen, sprechen sie nun von Vergebung und Versöhnung, doch diese Worte klingen für viele Betroffene wie leere Versprechungen.
Eher Strategie als ehrliche Reue
Für mich ist es vielmehr eine Strategie, die auf der Hoffnung basiert, dass die Zeit die Wunden heilt und die Wähler ihre Unzufriedenheit vergessen oder verzeihen.
Die Medien, einst die Lautsprecher der Pandemiepolitik und willfährige Moralapostel und Scharfrichter von Kritikern, erkennen, dass sie maßgeblich zur Spaltung der Gesellschaft und in Einzelfällen zur beruflichen sowie sozialen Vernichtung von Personen beigetragen haben. Ihre Berichterstattung war oft dramatisch, schürte Angst, ließ wenig Raum für differenzierte Diskussionen und stellte Personen, die Kritik übten, an den öffentlichen Pranger. Die Medien haben in vielen Fällen mehr auf Schlagzeilen als auf wissenschaftliche Nuancen gesetzt. Dies führte zu einer Polarisierung, die bis heute nachwirkt.
Nun fordern sie – wenig glaubhaft – eine Aufarbeitung, vielleicht in der Hoffnung, ihre Glaubwürdigkeit zu bewahren oder wiederherzustellen. Doch wie kann man Glaubwürdigkeit wiedergewinnen, wenn man selbst ein Teil des Problems war?
Nun fordern sie, dass man sich bitteschön verzeihen möge, um die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden. Wie kann das jemand fordern, der selbst die Axt anlegte und bislang nicht die geringste Übernahme von Schuld und Verantwortung zeigt?
Das Staatsziel wurde auf vielen Schultern verteilt
Die Forderung nach Aufarbeitung und Vergebung ist mit tiefen ethischen und philosophischen Problemen behaftet. Wer trägt die moralische Schuld, wenn Entscheidungen im Namen des Gemeinwohls getroffen wurden, die doch so viel Leid verursacht haben? Der absolute Gesundheitsschutz war plötzlich das Staatsziel. Alle Erkrankungs- und Todesfälle in Bezug auf Corona sollten verhindert werden. Der Preis: ein ständig andauernder Ausnahmezustand und die Verletzung von Grundrechten. Doch zu keinem einzigen Zeitpunkt waren diese strikten Regelungen verhältnismäßig.
War es nicht auch die Wissenschaft, die unsicher war? Ja, eine gewisse Unsicherheit stehe ich der Wissenschaft zu. Doch nach einem kurzen Moment der Schockstarre hätte sich die Wissenschaft wieder auf das konzentrieren müssen, was Wissenschaft ausmacht: valide Daten erheben, Diskussionen anregen und führen sowie Hypothesen entwerfen, überprüfen und auch wieder verwerfen, wenn es keine Evidenz dafür gibt.
Und was war mit den Individuen, also den einzelnen Menschen, die entweder die Regeln befolgten oder sie missachteten? Sie hätten alle die Pflicht gehabt, sich umfassend zu informieren. Es ist nicht ausreichend, sich nur auf die Beiträge einzelner Personen, die die Deutungshoheit für sich beanspruchen, zu verlassen und alles unreflektiert zu glauben und aus Angst vor Repressalien hinzunehmen.
Die Last der Verantwortung scheint auf viele Schultern verteilt zu sein. Das macht die Aufarbeitung zu einem komplexen, schmerzhaften Prozess. Oft frage ich mich, ob es wirklich möglich ist, eine klare Schuld zuzuweisen – angesichts der Fülle an Faktoren und Vielzahl an involvierter Akteure. Meine Antwort: Ja, es ist möglich. Denn die Verantwortlichen, die Regierenden, der Gesetzgeber, die Verordnungsgeber, die Experten und die, die öffentlich andere diffamiert und ausgegrenzt haben, sie alle haben Namen.
Wie gehen wir als Gesellschaft um?
Die Frage nach Gerechtigkeit und Wahrheit stellt uns vor ein Dilemma: Haben wir das Recht, die Wahrheit zu verlangen und Fehler offenzulegen oder haben wir das Recht, diese schmerzhaften Erinnerungen zu vergessen? Beides steht in einem unversöhnlichen Spannungsverhältnis. Die Wahrheit zu suchen, könnte alte Wunden aufreißen, während das Vergessen uns daran hindert, aus unseren Fehlern zu lernen. Die Leidtragenden werden dann damit alleine gelassen. Es ist eine Balance zwischen der Notwendigkeit, Verantwortung zu übernehmen, und dem Bedürfnis nach Heilung und Frieden.
Bleibt noch die Frage nach Vergebung und ich bin wieder am Anfang. Kann man wirklich vergeben, wenn das Vertrauen so tief erschüttert wurde? Vergebung erfordert ein ungeheueres hohes Maß an moralischer Disziplin. Die Spaltung, die die Pandemie verursacht hat, macht es schwer, diese Position zu erreichen.
Für viele ist die Verletzung zu tief, der Schmerz zu groß, um Worte der Versöhnung einfach hinzunehmen. Viele haben ihre Lebensgrundlagen verloren, ihre sozialen Kontakte verloren, haben psychisch gelitten und einige sind aufgrund der Impfung schwer geschädigt worden – für sie sind die Worte der Politiker hohl und unbefriedigend. Wie kann man vergeben, wenn man das Gefühl hat, dass diejenigen, die Vergebung fordern, nie wirklich verstanden haben, was sie angerichtet haben?
Die Forderung nach Versöhnung stößt daher auf Widerstand, weil sie von vielen als zu spät, zu opportunistisch oder als nicht ausreichend empfunden wird. Das Vertrauen in diejenigen, die nun Frieden predigen, ist verloren. Es wird schwer, diese Kluft zu überwinden. Die Gesellschaft müsste sich selbstkritisch auseinandersetzen, aber dafür sind wir zu sehr in unseren Überzeugungen verankert. Es gibt eine tief verwurzelte Angst, dass ein ehrliches Eingeständnis kollektiver Fehltritte nur weitere Spaltungen fördern könnte.
Diese Aufarbeitung wird Zeit brauchen, wahrhafte Ehrlichkeit und vor allem die Bereitschaft zur Selbstreflexion. Es ist nicht nur eine Frage der Politik oder der Medien, sondern eine Aufgabe für jeden Einzelnen von uns. Wir müssen bereit sein, unsere eigenen Rollen in dieser Krise zu hinterfragen und zu verstehen, dass diese letzten fünf Jahre nicht nur eine gesundheitliche, sondern auch eine moralische und philosophische Herausforderung war.
Nur durch ein tieferes Verständnis für die angerichteten Schäden bzw. Verletzungen und die Bereitschaft, die Fehler der Vergangenheit zu erkennen sowie zu akzeptieren, können wir hoffen, eine Gesellschaft zu formen, die weniger gespalten und verständnisvoller ist.
Die Heilung wird nicht über Nacht kommen, aber mit jedem ehrlichen Gespräch, jedem Moment der Selbstreflexion, jeder Handlung des Verstehens machen wir einen Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen uns daran erinnern, dass wahre Vergebung und Versöhnung nicht durch Worte, sondern durch Handlungen und echte Veränderung erreicht werden kann.
Ich hoffe für uns alle das Beste. Fünf Jahre nach den ersten nachgewiesenen COVID-Fällen in Deutschland bin ich immer noch tief erschrocken über das Ausmaß der staatlichen Maßnahmen. Nach fünf Jahren bin ich immer noch betroffen, wie sehr mich einige Menschen enttäuscht haben. Diese Kerbe in meinem Herzen – so fürchte ich – werde ich den Rest meines Lebens zu tragen haben.
Dr. med. Friedrich Pürner, MPH
Mitglied des Europäischen Parlaments, MdEP



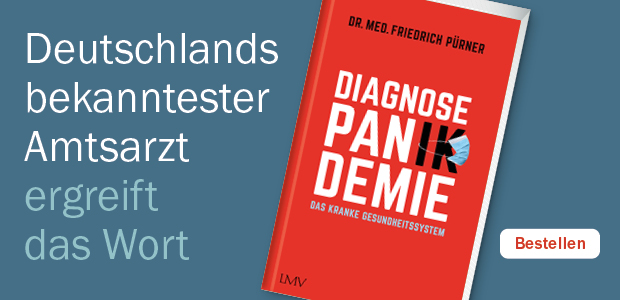

























Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
Woran liegt es, dass ich plötzlich nicht mehr zwischen Künstler und Werk differenziere und allgemein einfach den Künstler samt seiner Kunst ablehne? Tolle Schauspieler beispielsweise. Nun kämpfe ich mit mir selbst, dass ich meinen Anspruch an mich selbst haltend, Werk und Mensch trennen kann – aber es gelingt mir kaum mehr. Es gibt Bereiche in der Kunst , in denen Künstler und Werk untrennbar miteinander verschmolzen sind und daher gar nicht auseinandergehalten werden können. In der Musik trifft das vor allem auf jene zu , die Freiheit, Rebellion, Widerstand, wider den Gleichschritt etc. zu ihrem Thema gemacht haben. Ich bin aber… Mehr
Vergebung für kriminelle und Gangster ?
Von mir nicht – niemals
Verzeihen? Niemals. Um Entschuldigung bitten? Wird nicht passieren. Die einzige Genugtuung die mir bleibt ist die, dass ich alles richtig gemacht habe und die Geimpften ewig in der Angst leben müssen, dass es sie doch noch erwischt.
Ein äußerst persönlicher Bericht, der trotzdem sicher die Gefühle vieler Menschen widerspiegelt. Dennoch geht es meiner Meinung bei den Geschehnissen während der Coronajahre nicht nur darum, wie jeder persönlich mit Vergebung oder Reue umgeht. Allerdings ging es nicht nur um das Verhalten von Einzelpersonen, sondern darum, ob und wenn ja unter welchen Umständen, die fundamentalsten Grundgesetze von einer Regierung aufgehoben werden dürfen. Was noch schwerer wiegt als die unzähligen persönlichen Schicksale, ist deshalb die Frage, ob wir als Bürger in Zukunft erwarten können, dass unser Staatsapparat wieder ein integrer und verlässlicher Partner sein wird oder ob es erneut zu derartigen… Mehr
Auf Europa bzw. Deutschland werden wir nicht warten müssen. Interessant wird es, wenn Kennedy in den USA tatsächlich “Handschellen klicken” (Peter Hahne) lässt. Das Beben dort wird dann auch hier “Stühle wackeln” lassen, vermute ich.
Nichts wird vergessen! Niemand wird vergessen! Warum sollte ich den Tätern Gewissenserleichterung gewähren? Zumal sie zum Teil heute, nachdem sich fast alle ihrer Gewissheiten als falsch herausgestellt haben: die modRNA verbleibt nicht lokal im Muskel, sondern wird über den ganzen Körper verteilt (bis ins Gehirn, Rückenmark und Keimzellen) die modRNA wird nicht nach einigen Tagen zersetzt, sondern ist wesentlich länger nachweisbar es wurde genau deswegen eine modRNA eingesetzt, weil diese schwerer vom Körper abbaubar ist (Ersetzung des Nukleosids Uridin durch Pseudouridin) usw. Ich wurde ausgegrenzt, durfte an Veranstaltungen nicht teilnehmen, wurde von der Familie zu den Feiertagen ausgeladen, …, einzig der Supermarkt war… Mehr
Verzeihen, vergeben ist etwas, was immer die ganze Person mit allen Verletzungen und deren Beziehungen betrifft. Ich glaube auch, dass Vergebung nur schwer möglich ist, wenn die Verletzer (Täter) keinerlei Reue zeigen, sondern in ihrem Agieren einfach weiter machen und bestreiten, dass es notwendig ist, Verhalten und Täter und deren Schuld zu benennen. Das wollen Alena Buyx, Lauterbach und viele Behördenleiter aber nicht – aus für sie verständlichen Gründen. Sie sehen dabei nicht, dass mit ihrem Agieren das Vertrauen in das medizinische System und die politischen Akteure immer weiter untergraben wird. Auch viele Ärzte haben diese Bewährungsprobe nicht bestanden und… Mehr
Ja. Sicher. Genau so ist es im Land der „jüdisch-christlichen“ Wurzeln. Entrechtet, beraubt und nach der Beichte der Täter vergeben. Danach weitere Entrechtung und Enteignung durch dieselben Täter(gruppen). Seine Feinde bekämpfen statt sie zu lieben, wäre ja…rational. Aufgeklärt. Klug.
Ich habe mal zu einer Freundin gesagt, der hat die Staatsmacht zu Coronazeiten die Tür eingetreten, dass alles wie am 9. Mai 1945 verlaufen werde. Sie sah mich an und warum ich das meine. Meine Antwort war: “ Ganz einfach, damals war dann auch keiner dabei, man hatte nichts gewusst, man war eh dagegen oder hat dagegen gekämpft…“
Mittlerweile ist der Satz ein running Gag zwischen uns…
Versöhnung? Pfeif ich drauf. Die Konsequenz ist, dass es alleiniger um einen herum wird. Ist das schlimm, wenn man wie ich nicht mehr jung ist, aber auch noch nicht alt? Der Mensch soll ja ein soziales Wesen sein, so tönt es aus allen Rohren. Wer keine Beziehungen unterhält, soll gefährlich ungesund leben. Was also tun, wenn diese durch unterschiedliche Meinungen zerstört sind? Ich stelle mir schon die Frage, ob der Mensch ein soziales Wesen ist? Die vergangenen Jahre lassen doch andere Schlüsse zu. Solange die Zeiten harmlos dahinplätschern, soziale Krisen die Mehrheit wenig tangieren, ist es einfach das Miteinander zu… Mehr