Das Döp-dödö-Döp-Meme hat, wie bereits der "Stolzmonat" im Vorjahr, gezeigt, welche Kraft von effektiver Metapolitik ausgehen kann. Dabei handelt es sich keineswegs um Graswurzelbewegungen, sondern gezielte Kampagnen, die politisch relevanter sein können als die meisten Wahlprogramme.


Döp-dödö-döp ist noch nicht verhallt, da steht schon wieder – pünktlich zur anstehenden Europawahl – der „Stolzmonat“ vor der Tür. Nachdem monatelang diverse Kampagnen gegen Rechts™ mühsam versuchten die Stimmung im Land gegen die AfD zu kippen, scheint im Endspurt zur Wahl wieder eine metapolitische Wende stattgefunden zu haben, und die vermeintliche, sich in Döp-dödö-döp manifestierende Stimme des Volkes macht ihrem Ärger über linke Bevormundung lautstark Luft.
Diesmal wurde neben der lautmalerischen Imitation des Anfangsmotivs des Liedes vor allem das Schlagwort vom Streisand-Effekt populär. Erst mit der medialen Aufmerksamkeit und Empörung wurde das Lied fast über Nacht zum angeblichen Sinnbild des geballten Widerstands. Wie ein Lauffeuer ging es durch die sozialen Netzwerke: „Die Leute stehen auf“, „Die Menschen lassen es sich nicht mehr bieten“ usw. usf.
Die Sehnsucht nach solchen kathartischen Moment ist groß und das ist auch nachvollziehbar. Auch wenn nicht jedermann es verbalisiert, spüren instinktiv wohl die meisten Menschen, dass sie nur wenig Mittel haben, die angeblich demokratische Politik mit ihrer Stimme zu beeinflussen. Es braucht ein reinigendes Gewitter, koste es was es wolle. Und so wird jede Gewitterwolke mit hoffnungsvollen Augen willkommen geheißen, auch wenn sie sauren Regen bringt.
Der Zweck heiligt die Fakes?
Wie man aber mittlerweile aus Dubai weiß, muss man sich selbst bei Gewitterwolken mitunter fragen, ob diese natürlichen Ursprungs sind, oder nicht. Das gilt auch für metapolitische Phänomene und Hypes. Denn ja, der empörte Aufschrei der etablierten Medien, sowie die Doppelmoral mit der man den Sylter Grölern begegnete, während andernorts weggesehen wird, trugen sicherlich dazu bei, dass die Gesangseinlage überhaupt erst wahrgenommen wurde. Was aber passierte danach?
In Windeseile verbreiteten sich im Internet Aufnahmen von vermeintlichen Nachahmern. Sylt-Autosticker mit einem hinzugefügten Döp-dödö-döp, Einspielungen von Gigi D’Agostinos „L’amour toujours“ an der Orgel, sowie die mittlerweile berühmt berüchtigte bebende Straßenbahn.
Doch bei genauerem Hinsehen entpuppten sich viele dieser Aufnahmen als nachträglich in diesen Kontext gestellt. Ob der Autosticker außerhalb von Photoshop bereits innerhalb weniger Tage existierte, darf bezweifelt werden. Die Aufnahme einer Organistin mit dem Hit von Gigi D’Agostino stammt vom Februar und somit bereits aus der Vor-Döp-Ära und die im Netz verbreitete vor Döp-bebende Straßenbahn erweist sich wenig überraschend nicht als politisches Zeichen des Ungehorsams, sondern als das typische Verhalten von Fußballfans im Köln des Jahres 2018.
Schöne neue Meme-Welt
Auch eine andere Aufnahme einer Straßenbahn, in der tatsächlich „das Lied“ gespielt wurde, dürfte – gemessen an der winterlichen und kostümierten Kleidung – aus der Karnevalszeit stammen und ist somit nicht aktueller Ausfluss einer Rebellion gegen die Bevormundung durch einen übergriffigen Staatsapparat.
Das mag retrospektiv lapidar erscheinen, denn wie auch bei der Kritik an der eigentlich nicht so feiernswerten Vorlage aus Sylt, wird auch bei den Nachahmern gerne erklärt, dass es „ja gar nicht darum geht“ ob das echt ist, oder nicht, sondern um das Gefühl, dass Menschen, die das im Internet verfolgen, damit verbinden. Aber wie ungehörig ist ziviler Ungehorsam, den man vor allem im Internet konsumiert?
Es wäre aber falsch zu glauben, es gäbe gar keine Nachahmer. Die in Magdeburg angehaltenen Autofahrer, deren Handys konfisziert wurden, werden echt gewesen sein, womöglich ermutigt von zahllosen Videos im Internet, die auf den ersten Blick wohl doch suggerierten, es ginge ein Ruck durch das Land, der sich auch außerhalb des Internets im öffentlichen Raum manifestierte.
Dann wird aber die Frage nach der Urheberschaft solcher Trends wieder von beachtlicher Relevanz. Wer auch nur einen Funken Romantik im Herzen trägt, kennt den Wunsch nach einer spontanen Graswurzelbewegung, die ausgelöst von einem Funken plötzlich die Menschen vereint, nur zu gut. Doch die Realität ist leider oftmals, dass dies wohl nur ein Traum von Romantikern ist und es – im Gegenteil – Kräfte gibt, die genau diese Anfälligkeit für Romantik ausnutzen um ihre eigenen Ziele voranzutreiben.
Die Väter des Stolzmonats
Was zunächst ein wenig verschwörungstheoretisch klingt, lässt sich relativ einfach anhand des Phänomens „Stolzmonat“ aufzeigen. Als im letzten Jahr der Pride Month wieder über das Land zog und Regenbogenverwüstung hinterließ, bildete sich im Internet – wiederum scheinbar spontan – die Gegeninitiative „Stolzmonat“, bei der Profilbilder statt in den Farben des Regenbogens mit schwarz-rot-goldenen Abstufungen eingerahmt wurden. Auch hier entstand zunächst der Eindruck, es „reiche den Leuten jetzt einfach“. Statt Anglizismus: deutsche Sprache. Statt Regenbogen: die deutschen Nationalfarben. Und damit einhergehend natürlich das in Deutschland immerzu sensible Thema des Stolzes auf die Heimat, die Vergangenheit und die Vorfahren.
Wer damals, angesichts des wenig zielgerichteten, aber dafür überbordenderen Stolzes, darauf verwies, dass Stolz mit Vorsicht zu genießen sei und womöglich ein wenig Demut besser zu Gesicht stünde, wurde vehement angefeindet. Darin ähnelte die Kritik frappierend jener, die jetzt erklingt, wenn man nicht darauf pocht, dass der Ruf „Ausländer raus“ vom Grundgesetz gedeckt und somit vollkommen in Ordnung sei.
Allerdings entpuppte sich der Stolzmonat als keineswegs spontaner Ausdruck der Frustrationen des Volks, sondern als konzertierte Aktion, die u.a. von Influencern aus dem ideologischen Umfeld des sogenannten Flügels der AfD stammt, wie z.B. von Shlomo Finkelstein (Pseudonym), der später selbst zugab, als Mitinitiator und Verstärker dieser Aktion tätig gewesen zu sein.
So überrascht es wenig, dass Shlomo auch in den letzten Wochen entscheidende Narrative der rechten Blase mittrug und befeuerte. Noch kurz vor dem „Skandalinterview“ von Maximilian Krah, das mittlerweile fast als Auslöser einer parteiinternen Palastrevolte des Flügels gegenüber der liberal-konservativen Fraktion rund um Alice Weidel gesehen werden kann, unterhielt sich Shlomo in seinem Podcast 3 Stunden lang mit dem Spitzenkandidaten der AfD zur EU-Wahl und freute sich eine Woche später, dass dieser den Skandal gut überstanden hatte. Kritiker des Verhaltens der Sylter Schickeria bezeichnete Shlomo in derselben Folge als „geistig behindert“ und eine Ankündigung für den demnächst beginnenden Stolzmonat durfte auch nicht fehlen.
Doch Shlomo ist damit nicht allein. Martin Sellner durfte zwar zwischenzeitlich nicht mehr nach Deutschland einreisen, doch zumindest Metapolitik konnte und kann er auch auf digitalem Weg in Deutschland betreiben. Nicht nur, dass Sellner Döp-dödö-Döp feierte und anfeuerte, er hatte sogar praktische Grafiken dazu parat, die zeigten, an wie vielen Orten angeblich „das Lied“ in den letzten Monaten subversiv gesungen wurde. Das Signal ist deutlich: Es tut sich was. „Die Leute wachen auf“. Ehrlicher wäre zu sagen: „Die Leute sprechen auf die Knöpfe, die wir drücken, an.“ Noch unverblümter brachte es Erik Ahrens – laut Kanal Schnellroda „der Kopf unter anderem hinter Maximilian Krahs TikTok-Offensive” – auf den Punkt, als er auf X schrieb, es sei “klar, welcher AfDler sich gut beraten lässt und so das digitale Vorfeld, den wichtigsten Teil der Bewegung, auf seiner Seite hat.”
„Alleine gegen die Welt“ statt „Schulterschluss“
Ob die gefälschten oder aus dem Zusammenhang gerissenen Videos zu Döp-dödö-Döp tatsächlich von Influencern oder Aktivisten erstellt und geteilt wurden, lässt sich wohl kaum verifizieren. Ebenso wenig wie die sich aufdrängende Frage, ob das Skandalinterview tatsächlich ein Ausrutscher, oder Kalkül war. Aber sie beide fügen sich dennoch als ein Puzzlestück in eine fatale binäre Wahrnehmung der Welt, in der nur noch „mit uns“ oder „gegen uns“ existiert. Dass dafür der linken Öffentlichkeit zentrale Schuld zukommt, ist mittlerweile eine Binsenweisheit und muss nicht ad infinitum wiederholt werden. Entscheidend ist aber, dass zumindest Teile der AfD und ihres Umfelds den Brückenschlag aufgegeben zu haben scheinen und sich damit begnügen, sich in ihrem Lager zu verschanzen.
Denn bereits die Reaktionen auf den Rauswurf aus der ID-Fraktion zeigten, dass man auch gut und gerne auf alte Ressentiments setzen kann. Ja, Marine le Pen mag aus Machtkalkül gehandelt haben, doch anti-französische und anti-italienische Stilblüten fielen bei der Anhängerschaft der AfD auch auf allzu fruchtbaren Boden. Die zunehmende Bereitschaft der deutschen Rechten, sich international zu isolieren, kam nicht nur im vielleicht-doch-nicht-Fettnäpfchen Krahs zum Ausdruck, sondern auch im Umgang mit dem Stolzmonat und dem Grundrecht auf „Ausländer raus“-Rufe.
Man kann sagen was man will, aber während das „Interview“ Krahs zunächst den Eindruck erweckte, dass dies der Todesstoß im Wahlkampf der AfD war, so zeichnet sich nach den zu erwartenden Verlusten vor allem eine Verhärtung der verbliebenen Anhängerschaft ab. Nach Monaten des passiven Ausharrens gegenüber den Kampagnen der etablierten Medien, sind die AfD und ihr metapolitisches Vorfeld wieder in die Vorhand gekommen. Das Magazin Compact, bei dem auch Martin Sellner schreibt, war noch nie um unsubtile Cover verlegen und platzierte Krah in James Bond Pose neben den Titel „Agent des Volkes“. Gemeinsam mit Döp-dödö-Döp und dem Stolzmonat bilden diese und ähnliche Aktionen den Endspurt einer Wahlkampagne, die wie aus der Feder eines (ehemaligen) Aktivisten wie Sellner stammen könnte.
Politischer Erfolg um jeden Preis?
Ob das die Wählerschaft anspricht? Nicht wenige loben auch die Effektivität solcher Kampagnen, die mittels ihres Bezugs auf den kleinsten gemeinsamen Nenner – ob nun „Stolz“ oder „Ausländer raus“ – weitaus mehr Gemüter bewegen, als Plädoyers für das Wahre, Gute und Schöne. Das mag stimmen, doch während es Politikern und Aktivisten vor allem um die Erzeugung einer kritischen Masse gehen mag, sollten normale Bürger sich nicht täuschen lassen und entweder denken, es handle sich um die Stimme des Volkes, die da spricht, oder sich gar damit bescheiden, sich jedem Widerstand gegen den Status quo, ungeachtet inhaltlicher Fragen, anzuschließen.
Die Frage nach Wahrheit und Moral wurde auch in den verschiedenen Kommentarspalten nach der letzten Folge des Redaktionsschlusses diskutiert. So las man, z.B., die Meinung, „Wahrheit“ wäre relativ und obliege unterschiedlichen Definitionen. Oder die Feststellung, Moral sei etwas „für Versager“. Spätestens solche Ansichten offenbaren, dass hier einem moralischen Relativismus gehuldigt wird, der dem der Linken in keinster Weise nachsteht, nur halt eben von der anderen Seite, und der – wie jeder Relativismus – bei entsprechender Gelegenheit zu ähnlich katastrophalen Auswüchsen führen könnte. Es ist Ausdruck einer fatalen Spaltung der Gesellschaft in zwei Lager, die sich unversöhnlich gegenüber stehen.
So wie auch die seit Januar andauernde und offensichtlich unter Einbeziehung des Bundesamts für Verfassungsschutz geplante Kampagne gegen die AfD kein Zufall war, so sind auch die metapolitischen Themen der Rechten in Deutschland kein Zufall. Und während manche behaupten, entscheidend sei nicht das Phänomen Döp-dödö-Döp, sondern das Parteiprogramm, so fehlt bislang jeglicher Beweis, dass Parteiprogramme der AfD besser und konsequenter umgesetzt würden, als bei anderen Parteien, bei denen das Parteiprogramm das Papier nicht wert ist, auf dem es gedruckt steht. Allerdings hat die Brandmauer auch verhindert, dass dieser Beweis geführt werden kann. Hier zeigt sich eine weitere Gefahr: Ausgrenzung radikalisiert, Brücken zwischen den Lagern werden verbrannt statt aufgebaut. Die Spaltung wird vertieft, den gemäßigten Kräften in der AfD die Chancen verbaut.
Das radikale Vorfeld der AfD, ob nun in Wiener Kaffeehäusern, Internetpodcasts oder mitteldeutschen Rittergütern, hat vollkommen richtig die Kraft der Metapolitik erkannt und setzt diese gezielt ein. Auch ein Referent von Tino Chrupalla fabulierte in einem Kaplaken-Band offen über die „Rückeroberung der Geschichte“ und die „schlafende Geschichte“ Deutschlands, die in „Büchern oder Wäldern, in den Bergen oder im Boden“ schlummert, nur um mit einem „Zauberwort“ aufzuwachen. Das hat nichts mit Parteiprogramm zu tun, sondern mit der bewussten Zielsetzung eben jenes „Zauberwort“ zu finden, mit dem man die Menschen „erwachen“ lassen könne, womit zweifelsohne auf die Mobilisierung der Massen für die eigene Sache gehofft wird.
Nur: Wer glaubt, die offensichtlichen Probleme Deutschlands – über die hier bei TE täglich ausführlichst berichtet wird – ließen sich mit einem „Zauberwort“ und einem „Erwachen“ aus dem Schlummer lösen, wird wohl eher ein raues Erwachen erleben. Denn die Probleme sind weniger ursächlicher Natur, als viel mehr Symptome einer tiefer liegenden Problematik des kulturellen und identitären Niedergangs. Für die rechten Metapolitiker der Gegenwart scheint die Lösung vor allem im völkisch-ethnischen Volksbegriff zu liegen, während andernorts (geographisch wie ideologisch) eher die kulturelle und religiöse Identität, sowie die daraus resultierende Kompatibilität der Bürger (egal welcher Ethnie), im Vordergrund steht.
Doch zu welchem neuen Morgen soll Deutschland denn aufbrechen, wenn erstmal das Projekt der Remigration, das so im Herzen der ganzen Debatte steht, abgeschlossen wäre? „Deutschland den Deutschen“, nun gut, aber wofür stehen diese denn noch? Aus dem Land der Dichter und Denker von einst, wo selbst im Angesicht des 30-jährigen Kriegs „Musikalische Friedens Seufftzer“ erklangen und das Leid von Deutschland poetisch besungen wurde, würde dann das von Ausländern befreite Deutschland werden, in dessen Mitte man endlich wieder stolz sein und Döp-dödö-döp grölen könnte.
Diese Überspitzung will hervorheben, dass Kultur und moralische Inhalte eben keine Nebensächlichkeiten sind, die nach der politischen Wende sich von selbst regeln würden. Die Verlockungen allzu einfacher metapolitischer Versuchungen haben ihren Preis. Die jetzige Parteienlandschaft bietet leider wenig zufriedenstellende Alternativen, aber ein jeder muss für sich selbst entscheiden, ob „Hauptsache Revolution“, ungeachtet der Folgen, zu verantworten ist. In Anlehnung an das metapolitische Pathos der neuen Rechten: Es ist eine Entscheidung von potenziell historischer Tragweite. Und zeigt gleichzeitig das eigentliche Problem Deutschlands. Die Gruppe der alten Parteien hat weder Ideen noch Bereitschaft für eine konstruktive Kurskorrektur der Politik. Ihr kommt die Radikalisierung auf der anderen Seite der Brandmauer gerade Recht, denn sie verhindert die Entstehung einer konstruktiven Alternative zum Status quo.
Hinweis der Redaktion: Liebe Leser, leider haben wir momentan technische Probleme bei den Kommentaren. Unser Team arbeitet daran, dass Sie schnell wieder wie gewohnt Kommentare schreiben können.
























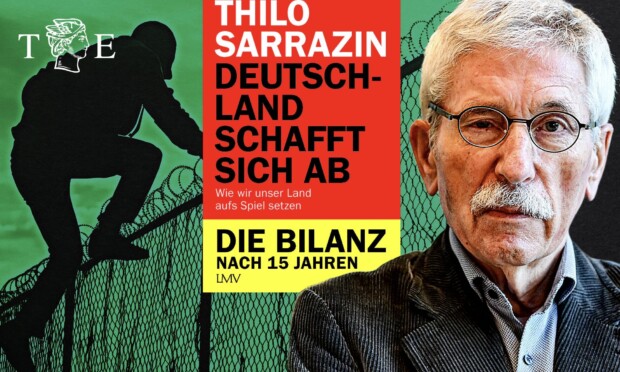




Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
Was Marcel Seiler sagt. Es ist frustrierend, jahrelang gegen eine Wand zu reden. Der Zustand des Grundgesetzbruches seit 2015 durch die CDU/CSU besteht weiter fort, die Destabilisierung durch Migration ist meiner Ansicht nach offensichtlich, eine Fehlerkultur existiert nicht in der politischen Klasse. Nero spielt Flöte, während Rom brennt. Da hat man irgendwann einfach keine Lust mehr, gibt sich also gänzlich dem Nonsens hin. Sinnbildlich dazu steht die Clownswelt. Die Politiker benehmen sich als verantwortungslose Clowns, also machen wir Dissidenten dann das Gleiche. Daher kommt dann auch ein Tim Kellner, der mit seinen rosa Outfits und Love-Slogans in die gleiche Kerbe… Mehr
Autor Boos hat irgendwie recht. ABER: Ich selbst habe in den letzten 10 Jahren für eine im Ton moderate Opposition gegen Merkel und Ampel gekämpft. Erfolg: NULL. Die links-grüne Hass-Propaganda („alles Nazis“), die Gutmenschen-Inklusions-Illusion und die Straßen-Gewalt der Antifa waren stärker.
Jetzt schlagen die AfD-Radikalen mit den gleichen Mitteln zurück, mit denen Grün-Rot-Merkel-Ampel dieses Land beherrscht, nämlich mit Holzschnitt-Propaganda. Ich finde das in Ordnung, auch wenn ich die Naivität dieser Propaganda nicht teile. Aber mit Subtilitäten ist das Wahlvolk nicht erreichbar.
Sehr geehrter Herr Boos, ich oute mich hier mal als AfD Sympathisant. Ich finde die AfD wichtig, weil sie einzige Partei ist die konservativen Wähler (wie weiland die CDU der Kohl Zeit) vertritt. Jede Partei hat Mitglieder und Repräsentanten, die mal etwas Ungeschicktes oder Dummes sagen. So weit so gut. Mir ist die Programmatik wichtig nicht, ob ich Herrn H oder Frau W sympathisch finde. Zum Thema „Ausländer raus“ das Sylter Party Gegröle war vermutlich weniger Zeichen einer politischen Überzeugung als eher dem alkoholisierten Drang nach Sangesfreuden und Aufmerksamkeit geschuldet. Generell geht es m. E. konservativen Bürgern nicht um die… Mehr
Ich stimme sowohl Holzdrache wie auch Marcel Seiler vollumfänglich zu, dennoch muss man zu Krahs Äußerung Charles Maurice de Talleyrand zitieren, der diese Äußerung wohl so kommentiert hätte: „Es war schlimmer als ein Verbrechen, es war eine (politische) Dummheit.“ Bei aller sachlichen Richtigkeit und Infamität der Fragestellerin kann man nicht so breitfüssig durch ein politisches Minenfeld stapfen, schon gar nicht in Italien oder Frankreich, gerade in Anbetracht des Wissens wie Gauland und Frau Petry von den Medien sinnentstellend diffamiert wurden.