Monika Marons Essays und Briefe zeigen die Autorin mit Texten aus vier Jahrzehnten als skeptische und scharfsichtige Intellektuelle, wie es sie in der deutschen Gegenwart nur selten gibt


In ihrem Essay „Links bin ich schon lange nicht mehr“, erschienen 2017 in der NZZ, schrieb Monika Maron, sie gehöre nicht mehr zum heutigen linken Milieu. Vor allem werde von ihren Kritikern nicht mehr so wahrgenommen, und das, obwohl ihr Blick auf die Welt sich nicht grundsätzlich verändert habe. Offenbar wandelte sich die Welt vor ihren Augen stärker als die Autorin, die natürlich auch nicht über vier Jahrzehnte lang die gleiche geblieben ist. Wer kennt nicht Brechts Geschichte vom erbleichenden Herrn K., dem jemand bescheinigt, er sei ganz der Alte?
Trotzdem gibt es einige große Konstanten im Leben der heute 81jährigen Autorin: ihren skeptischen, distanzierten Blick auf ideologische Gebäude. Und zweitens die Lakonie ihrer Sprache, der Wille, zu beobachten. Maron gehörte nie zu dem im intellektuellen Deutschland (hauptsächlich bei anderen Intellektuellen) populären Typus der anklagenden moralischen Instanz.
Von beiden Qualitäten können sich die Leser in dem gerade erschienenen Band „Essays und Briefe“ auf gut 600 Seiten überzeugen. Er versammelt viele Texte, die sich schon in „Was ist eigentlich los“ finden, ergänzt um einen Essay zur deutschen Debatte um den Russlandkrieg von 2022 – und eben ihre Briefkorrespondenz. Schon, dass eine Autorin einem Autor (Joseph von Westphalen in den achtziger Jahren) schreibt, mutet heute in angenehmer Weise antik an. Zwei Schriftsteller teilen einander mehr als jeweils 260 Twitter-Zeichen mit, jeder bemüht sich, seine Gedankengänge dem anderen nahezubringen, keiner der beiden versucht, den anderen mit seinen Argumenten zu missionieren.
Maron, geboren am 3. Juni 1941 in Berlin, Enkelin eines jüdischen, aus Polen stammenden Großvaters, wuchs in einem kommunistischen Elternhaus auf. Ihr Stiefvater Karl Maron amtierte bis 1963 als Innenminister der DDR. Von der kommunistischen Orthodoxie löste sie sich früh, was zu einem jahrelangen, später aber wieder geheilten Bruch mit ihrer Mutter führte.
Wer ihren Essay- und Briefband liest, kann dieses Urteil durchaus als Auszeichnung für die Autorin verstehen. Bei Hoffmann und Campe fand sie schnell wieder eine literarische Heimat. Die damalige S. Fischer-Chefin sitzt nicht mehr auf ihrem Posten.
Durch ihre Lebensgeschichte gehört Maron weder ganz zu den ost- noch den westdeutschen Autoren, und überhaupt hielt sie sich von literarischen Kollektiven, Bewegungen, Verbänden und Großideen immer fern. Das macht ihre oft jahrzehntealten Texte gut haltbar, die zwar immer in der jeweiligen Gegenwart anknüpften, etwa ihr Essay „Warum bin ich selbst gegangen?“ von 1989 über die DDR-Ausreiser der später Achtziger und ihre eigene Ausreise, die aber immer weiterreichen als der Tag und die damals gerade aktuelle Lage.
In einem Stück über die Krise des (westdeutschen) Verbandes Deutscher Schriftsteller, damals Anhängsel der Mediengewerkschaft, schrieb sie 1989: „Ich frage mich, ob Schriftsteller in einer Massenorganisation, die ihrer Natur nach von Ideologen und Pragmatikern regiert wird, überhaupt etwas zu suchen haben.“
Diese instinktive Distanz schützte die Autorin vor allen großen Irrtümern. Kurioserweise meinten viele, die Maron von in den Neunzigern für ihre nüchterne Sicht auf die DDR lobten (dass sie damit richtig gelegen hatte, merkte spätestens dann jeder), die Autorin sei abgedriftet und habe sich verirrt, als sie nach 2015 die aufkommende Erwachtheitsideologie im Westen kritisierte, die Verklärung des politischen Islam, den Paternalismus der politisch-medialen Eliten.
In ihrem Essay „Zeitunglesen“, der im Untertitel die Frage „bin ich vielleicht verrückt geworden?“ stellt (erschienen 2013 im SPIEGEL, der jetzt vermutlich keinen Text mehr von ihr drucken würde), schreibt sie über die die neuen medialen Begriffe, die ein bestimmtes Denken nicht mehr erklären, sondern pathologisieren, etwa mit der Wendung „Islamophobie“. Das, so erfährt sie beim der Zeitungslektüre, sei kein legitimer Standpunkt, sondern eine Angststörung, also etwas Behandlungsbedürftiges.
„Hätte ich es nicht wenigstens hundertmal schwarz auf weiß gelesen, wüsste ich wahrscheinlich heute noch nichts von meiner Krankheit“, schieb Maron damals. „Das ist eben das Gefährliche an der Krankheit: man hat sie, ohne das Geringste zu bemerken. Deshalb halten es die Zeitungen für ihre Pflicht, Menschen wie mich darüber aufzuklären, dass sie, ohne es zu wissen, längst von dieser sich seuchenartig verbreitenden Krankheit infiziert sind.“ Wenn sich jemand fragt, ob er verrückt sein könnte, muss das kein schlechtes Zeichen sein. Wirklich Verrückte fragen sich das nie.
Neben ihren politischen Texten gibt es in „Essays und Briefe“ auch viel lebensweltliches im lakonisch-gelassenen Maron-Stil. Etwa, wenn sie über Berliner und Hunde schreibt. Aber Vorsicht: Als ihr Band über ihre Hündin Bonnie Propeller erschien, stocherte eine Deutschlandfunk-Redakteurin ausgiebig darin herum, weil sie versteckte politische Botschaften darin vermutete. Einmal als Autorin etikettiert und verdächtig, immer verdächtig.
Mehrmals kommt sie auch auf ein anderes Grundmotiv, das in ihren späten Büchern eine Rolle spielt: das Landleben. Nur wenige deutsche Autoren entwickelten dazu einen Bezug ganz ohne Herablassung, niemand sicherlich besser als Fontane. Aber auch bei Maron findet sich dieser Gelassenheitston ohne jede Anwandlung von Kitsch.
In „Schreiben auf dem Lande“ heißt es: „Unser Nachbar ist Bauer. Er liest die Zeitung und ab und zu ein Buch über Tiere. Dass ich Bücher schreibe, weiß er und findet es nicht weiter schlimm. Abends fragt er, ob ich etwas geschafft habe. Wenn ich in der glücklichen Lage bin, die Frage zu bejahen, sagt er: ‚Dann is jut.‘ – ‚Bist bald fertig, wat?‘, fragt er vielleicht noch und sieht mich dabei an wie einen Menschen, der sein Tagwerk ehrlich hinter sich gebracht hat wie er selbst.“
In Beobachtungsdistanz zu sich selbst beschreibt sie das „Süßliche und Milde, das Betörende und Verdächtige, von dem ich die Bezeichnung nicht kenne und von dem ich befürchte, dass es auf einem Irrtum beruht.“ Das Codewort, das sie etwas abergläubisch umkreist, heißt Glück.
Als Glück bezeichnete sie es ganz direkt, als sie nach ihren Erfahrungen mit S. Fischer bei Hoffmann und Campe ankam, und der Verlag sich entschied, alle ihre Bücher aus 40 Jahren dort noch einmal herauszubringen.
Das beruht nicht auf einem Irrtum, zur Freude ihres Publikums.
Monika Maron, Essays und Briefe. Hoffmann und Campe, Hardcover mit Schutzumschlag, 608 Seiten, 34,00 €.
Empfohlen von Tichys Einblick. Erhältlich im Tichys Einblick Shop >>>



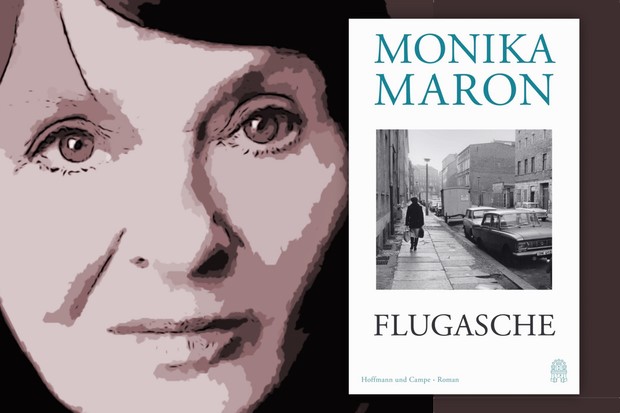
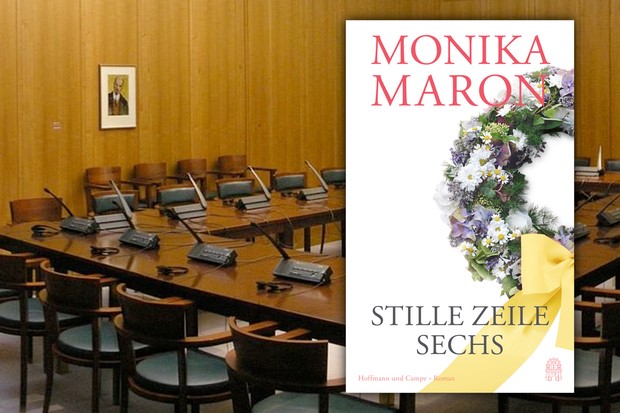
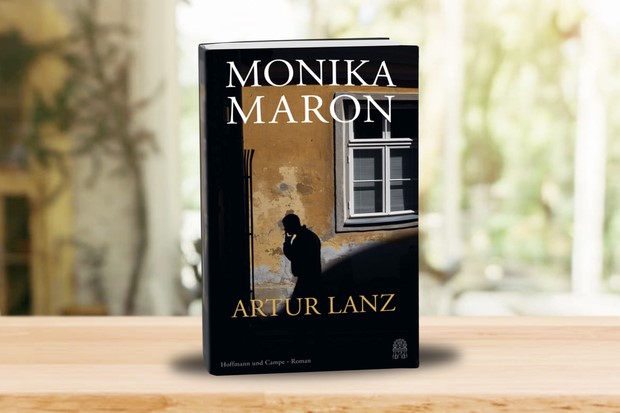

























Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
Was die üblichen Verdächtigen heute etikettieren, ist meisten eine unbedingte Lese-, Seh-, Wahl- etc Empfehlung.
Der Dumme oder schlechte Geschmack ist sich heute einig, was oder wer „falsch“ ist.
Niemand ist oberrichtiger als unser Zeitgeist und niemand penetriert diesen mehr als „unsere“ Grüne, überzeugte oder gefühlte.
Grün sein ist daher kaum mehr als Zeichen von Dummheit und oder schlechten Geschmacks.