Michael Wolski hat die Rechtsprechung nach dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz AGG analysiert und zeigt, dass Deutschland – offenbar als einziges der 28 EU Länder – Muslimen bei der Religionsausübung sehr weitreichende Rechte am Arbeitsplatz einräumt, zu Lasten der Arbeitgeber. Sollten die Richter am EuGH der Sicht der Generalanwältin in einer anhängigen Klage folgen, kippt in Deutschland die Rechtsprechung.

Kopftuchverbot am Arbeitsplatz – Schlussantrag der EU Generalanwältin vom 31.05.2016: Die belgische Niederlassung der britischen Sicherheitsfirma G4S – mit mehr als 1⁄2 Million Mitarbeitern – verbot 2006 ihren Mitarbeitern das Tragen religiöser Symbole am Arbeitsplatz. Eine an der Rezeption tätige Muslima klagte dagegen, da sie nicht ohne islamisches Kopftuch arbeiten wolle und schließlich landete der Fall vor dem EuGH. Die verklagte belgische Niederlassung der weltweit agierenden Sicherheitsfirma G4S, beschäftigte, wie wir inzwischen wissen – auch den Attentäter von Orlando als Wachmann.
Wie argumentierte die Generalanwältin?
Im Vorabentscheidungsverfahren vor dem Gerichtshof haben G4S, das Centrum, die Regierungen Belgiens und Frankreichs sowie die Europäische Kommission schriftlich Stellung genommen. Dieselben Beteiligten waren auch in der mündlichen Verhandlung vom 15. März 2016 vertreten, außerdem hat sich das Vereinigte Königreich an dieser Verhandlung beteiligt. In der Rechtssache C‐188/15 wurde am gleichen Tag mündlich verhandelt.
Frankreich weist mit Nachdruck darauf hin, dass der Geltungsbereich der Richtlinie 2000/78 gemäß dem einleitenden Halbsatz von Art. 3 Abs. 1 nur im Rahmen der auf die Gemeinschaft (heute: Union) übertragenen Zuständigkeiten eröffnet ist. Nach Ansicht Frankreichs ist deshalb die Richtlinie nicht dazu bestimmt, auf Situationen Anwendung zu finden, welche die nationale Identität der Mitgliedstaaten berühren. Insbesondere vertritt dieser Mitgliedstaat die Auffassung, die Geltung der Richtlinie für den öffentlichen Dienst („service public“) unterliege wegen des in Frankreich geltenden Verfassungsprinzips des Laizismus („laïcité“) Einschränkungen. In diesem Zusammenhang beruft sich Frankreich auf die in Art. 4 Abs. 2 EUV verankerte Pflicht der Union, die nationale Identität der Mitgliedstaaten zu achten, wie sie in deren grundlegenden politischen und verfassungsmäßigen Strukturen zum Ausdruck kommt.
Im Mittelpunkt des Interesses steht für das vorlegende Gericht die Frage, ob es sich bei dem streitgegenständlichen Verbot um eine religiöse Diskriminierung unmittelbarer oder mittelbarer Art handelt.
Während G4S davon ausgeht, es liege überhaupt keine Diskriminierung vor, wohingegen Frankreich und das Vereinigte Königreich eine mittelbare Diskriminierung annehmen, halten Belgien und das Centrum eine unmittelbare Diskriminierung für gegeben. Die Kommission spricht sich in der vorliegenden Rechtssache C‐157/15 für die Feststellung einer mittelbaren Diskriminierung … aus.
Die Verfahrensbeteiligten sind sich zutiefst uneinig, ob ein Verbot wie das hier streitige ein legitimes Ziel verfolgt, geschweige denn ein legitimes Ziel im Sinne einer der beiden genannten Richtlinienbestimmungen, und ob es einer Verhältnismäßigkeitsprüfung standhält. Während G4S dies bejaht, sprechen sich das Centrum, Belgien und Frankreich dagegen aus. Auch die Kommission äußert eine gewisse Skepsis. Die Praxis der nationalen Gerichte zu dieser Fragestellung ist uneinheitlich.
Dabei ist dem Arbeitgeber ein unternehmerischer Beurteilungsspielraum zuzu- gestehen, welcher letztlich im Grundrecht der unternehmerischen Freiheit seine Grundlage findet (Art. 16 der Charta der Grundrechte). Zu dieser Freiheit gehört es, dass grundsätzlich der Unternehmer bestimmen darf, in welcher Art und Weise sowie unter welchen Bedingungen die im Betrieb anfallenden Arbeiten organisiert und erledigt werden sowie in welcher Form seine Produkte und Dienstleistungen angeboten werden.
Vor diesem Hintergrund erscheint es bei objektiver Betrachtung und unter Berücksichtigung des unternehmerischen Beurteilungsspielraums keineswegs als abwegig, dass eine Rezeptionistin wie Frau Achbita ihre Tätigkeit unter Einhaltung einer bestimmten Kleiderordnung – hier: unter Verzicht auf ihr islamisches Kopftuch – auszuüben hat. Ein Verbot wie das von G4S ausgesprochene kann als wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung im Sinne von Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78 angesehen werden.
Im vorliegenden Fall ist das Kopftuchverbot Ausfluss der Politik der religiösen und weltanschaulichen Neutralität von G4S, die sich das Unternehmen selbst auferlegt hat.
Eine solche Neutralitätspolitik geht nicht über die Grenzen des unternehmerischen Beurteilungsspielraums hinaus. Dies gilt umso mehr, als es sich bei G4S um ein Unternehmen handelt, das bei verschiedensten Kunden aus dem öffentlichen wie privaten Sektor u. a. Bewachungs-und Sicherheitsdienste, aber auch Rezeptionsdienstleistungen erbringt und dessen Mitarbeiter bei allen diesen Kunden flexibel einsetzbar sein müssen.
Wie Frankreich in diesem Zusammenhang zu Recht hervorgehoben hat, gilt es nicht zuletzt, den Eindruck zu vermeiden, dass die von einer Arbeitnehmerin durch ihre Kleidung öffentlich zur Schau gestellte politische, philosophische oder religiöse Überzeugung von Außenstehenden mit dem Unternehmen G4S bzw. mit einem von G4S versorgten Kunden in Verbindung gebracht oder gar diesem zugerechnet werden könnte.
Anders als beim Geschlecht, der Hautfarbe, der ethnischen Herkunft, der sexuellen Ausrichtung, dem Alter und der Behinderung einer Person handelt es sich aber bei der Religionsausübung weniger um eine unabänderliche Gegebenheit als vielmehr um einen Aspekt der privaten Lebensführung, auf den die betroffenen Arbeitnehmer zudem willentlich Einfluss nehmen können. Während ein Arbeitnehmer sein Geschlecht, seine Hautfarbe, seine ethnische Herkunft, seine sexuelle Ausrichtung, sein Alter oder seine Behinderung nicht „an der Garderobe abgeben“ kann, sobald er die Räumlichkeiten seines Arbeitgebers betritt, kann ihm bezüglich seiner Religionsausübung am Arbeitsplatz eine gewisse Zurückhaltung zugemutet werden, sei es hinsichtlich religiöser Praktiken, religiös motivierter Verhaltensweisen oder – wie hier – hinsichtlich seiner Bekleidung.
Zum anderen sollte aber speziell mit Blick auf ein Kopftuchverbot nicht voreilig und pauschal behauptet werden, dass eine solche Maßnahme die Integration muslimischer Frauen in das berufliche und gesellschaftliche Leben über Gebühr erschwert. Gerade der Fall von Frau Achbita zeigt dies besonders plastisch: Die Betroffene ging rund drei Jahre lang bei G4S ihrer Tätigkeit als Rezeptionistin nach, ohne am Arbeitsplatz ein islamisches Kopftuch zu tragen, war also als Muslima trotz Kopftuchverbot voll in das Erwerbsleben integriert. Erst nach mehr als drei Jahren Berufstätigkeit für das Unternehmen G4S bestand sie darauf, dort mit Kopftuch zur Arbeit erscheinen zu dürfen, und verlor daraufhin ihren Arbeitsplatz.
Insgesamt kann also ein Verbot wie das von G4S verhängte als wesentliche, entscheidende und legitime berufliche Anforderung im Sinne von Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78 angesehen werden, die grundsätzlich geeignet ist, Ungleichbehandlungen – gleichviel, ob unmittelbarer oder mittelbarer Natur – wegen der Religion zu rechtfertigen, vorausgesetzt, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wird beachtet.
Ergebnis
Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen schlage ich (die Generalanwältin) dem Gerichtshof vor, auf das Vorabentscheidungsersuchen des belgischen Hof van Cassatie (Kassationshof) wie folgt zu antworten:
- Wird einer Arbeitnehmerin muslimischen Glaubens verboten, am Arbeitsplatz ein islamisches Kopftuch zu tragen, so liegt keine unmittelbare Diskriminierung wegen der Religion im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2000/78/EG vor, wenn dieses Verbot sich auf eine allgemeine Betriebsregelung zur Untersagung sichtbarer politischer, philosophischer und religiöser Zeichen am Arbeitsplatz stützt und nicht auf Stereotypen oder Vorurteilen gegenüber einer oder mehreren bestimmten Religionen oder gegenüber religiösen Überzeugungen im Allgemeinen beruht. Das besagte Verbot kann jedoch eine mittelbare Diskriminierung wegen der Religion gemäß Art. 2 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie darstellen.
- Eine solche Diskriminierung kann gerechtfertigt sein, um eine vom Arbeitgeber im jeweiligen Betrieb verfolgte Politik der religiösen und weltanschaulichen Neutralität durchzusetzen, sofern dabei der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet wird. In diesem Zusammenhang sind insbesondere zu berücksichtigen:
- die Größe und Auffälligkeit des religiösen Zeichens,
- die Art der Tätigkeit der Arbeitnehmerin,
- der Kontext, in dem sie diese Tätigkeit auszuüben hat, sowie
- die nationale Identität des jeweiligen Mitgliedstaats.
Mein Fazit:
Sollten also die Richter am EuGH dieser Sicht der Generalanwältin folgen, dann kippt in Deutschland die Rechtsprechung zu religiöser Diskriminierung. Das hätte auch zur Folge, dass dann die Unternehmen viel freier wären, Muslime einzustellen. Ohne zusätzliche Kosten zu befürchten.
Ich beziehe mich auf den Kommentar zum AGG: „Diskriminierung aufgrund der islamischen Religionszugehörigkeit im Kontext Arbeitsleben – Erkenntnisse, Fragen und Handlungsempfehlungen“. Wir lesen dort auf Seite 20:
In der Konsequenz können unmittelbare Diskriminierungen im Bereich der Arbeit in Deutschland nicht auf Sicherheitsgesichtspunkte oder sonstige Rechtspositionen Dritter gestützt werden, wenn die Gründe nicht im Zusammenhang mit der Ausführung der geschuldeten Arbeitsleistung stehen. Die generelle Nichteinstellung von afghanischen Musliminnen und Muslimen bei Behörden des Verfassungsschutzes wegen Sicherheitsbedenken wäre unzulässig, ebenso bei einer privaten Sicherheitsfirma, die mit den Flughafenkontrollen befasst ist.
Michael Wolski hat das Buch Gebetspausen am Arbeitsplatz geschrieben. Er war viele Jahre im Außenhandel tätig, zuletzt in Bosnien.
















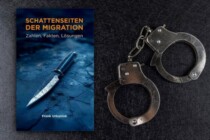









Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein