»Bestände sind geworden und werdend, niemals planbar und geplant. Sie sind etwas Errungenes, aber auch Übernommenes. Sie enthalten einen unverfügbaren Kern, etwas, das der Willkür entzogen und nicht messbar ist.« Michael Esders


Bei der Positionsbestimmung des konservativen Denkens, das durch eine megalomane Sozialtechnologie herausgefordert wird, hilft der kleine, kaum neun Buchseiten umfassende Aufsatz »Status quo als Argument« von Niklas Luhmann. Das Erscheinungsjahr – 1968 – des Textes, der statt vom Bestand vom Status quo des Bestehenden ausgeht, verweist auf den Anlass. In der Auseinandersetzung mit der Studentenbewegung entfaltet der Systemtheoretiker eine funktionalistische Auslegung und Begründung des Konservatismus.
Der Aufsatz richtet sich nicht nur gegen den revolutionären Überschwang der Umstürzler und Weltverbesserer, sondern ist auch ein Dokument der konservativen Ernüchterung. Formuliert wird ein Minimum des Konservatismus, der sich von Wertbindung und Traditionalismus lossagt, eine Privilegierung des Alten ablehnt und seinen Frieden mit dem Relativismus macht. »Er vertritt weder Wahrheit noch Werte. Er ist daher in solchen Prämissen nicht angreifbar. Er schließt keine Änderungen mehr aus und kann einen vollständigen Relativismus aller Werte konzedieren. Sein Argument ist nur, daß für grundlegende strukturelle Verbesserungen die Rechenkapazitäten nicht ausreichen.«
Der Status quo, wie Luhmann ihn denkt, ist vor allem eine Ressource zur Komplexitätsverarbeitung. Die anerkannte Maßgeblichkeit des Gegebenen enthebt von der Anstrengung, immer wieder aufs Neue zwischen einer unüberschaubaren Fülle von Handlungsmöglichkeiten abwägen und in komplexen Beziehungsgeflechten Entscheidungen treffen zu müssen, deren Folgen kaum zu ermessen, geschweige denn zu beherrschen sind. Vieles ist vorentschieden und disponiert, muss vorentschieden sein, weil es unmöglich ist, das Ganze der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu überblicken und zu vergegenständlichen.
Über Luhmanns Überlegungen hinausgehend, ließe sich der Status quo als Gesamtheit bewährter Verfahrens-, Steuerungs- und Problemlösungsroutinen verstehen. Der Status quo ist ein Bestehendes, das kein Argument für sein So-sein benötigt, weil er das Argument ist. Solange dieser Grund trägt, braucht er keine Gründe, Erklärungen und Rechtfertigungen. Die Pauschalkritiker und -veränderer blenden nicht nur die Komplexität der Verhältnisse und die möglichen Nebenfolgen ihrer Eingriffe, sondern auch die Geschichtsimplikation des Status quo aus.
Die Forderung, alles Bestehende zu hinterfragen oder gar zu ändern, ist eine blinde Augenblicksfixierung mit totalitärer Tendenz. Ignoriert wird, dass die Reflexivität, die diese Forderung geltend macht und voraussetzt, keine unbegrenzte Ressource ist, sondern eine hochentwickelte institutionelle Bestandssicherung voraussetzt. Reflexion ist die Ausnahme einer Regel, die sich in ihrem Vollzug nicht andauernd in Frage stellen muss. Erst die institutionell gefestigten Handlungsroutinen eröffnen die Freiräume, um sie auf den Prüfstand und in Frage zu stellen.
Diese Voraussetzungen blenden diejenigen aus, die sich anmaßen, alles und jedes augenblicklich zur Disposition zu stellen. Ihre Geringschätzung des Vorgegebenen, das als unnötiger historischer Ballast, als zu überwindendes Hindernis der Rationalisierung oder als Hemmschuh auf dem Weg zu einer gerechten Einrichtung der Gesellschaft erscheint, beruht auf einer Verkennung der eigenen Abhängigkeit von ihm.
Luhmann qualifiziert sein Konzept eines »Konservativismus aus Komplexität« auch als »Konservativismus wider Willen«, weil er ein hohes Maß an Flexibilität, Zukunftsoffenheit und Veränderungsbereitschaft einschließt und ihm jede Feier oder Verklärung des Althergebrachten fernliegt. Kern ist eine implizite Beweislastregelung, die den Begründungszwang auf der Seite des Veränderers sieht und das Gegebene von Rechtfertigungspflichten entlastet. »Der Status quo braucht nicht begründet zu werden, es sei denn als unentbehrliche Rechnungsvereinfachung«, schreibt Luhmann – und wird an anderer Stelle noch deutlicher: »Der Status quo hat die Vermutung rechtlicher Geltung, zumindest faktischen Konsenses hinter sich. Die Erhaltung des Status quo ist die Grundlage, auf der das Verhandeln über seine Modifikation beginnt.« (…)
Offenkundig unterschätzten Luhmann und die bundesrepublikanischen Neokonservativen nicht nur die Ausdauer und Marathonqualitäten der aus der Studentenbewegung hervorgegangenen Linken, sondern auch deren ideologische Flexibilität. Sie ahnten nicht, dass es ihr gelingen würde, den zunehmend obsolet gewordenen neomarxistischen Begriffsbestand identitätspolitisch zu erneuern und zu erweitern. Mit langem Atem durchdrang die Linke, die 1968 Ungeduld zum politischen Programm erhoben hatte, Bildungssektor, Kulturszene, Behörden und Medien. Mit diesem neuen Status quo ließ sich nicht einmal ein minimalistischer Konservatismus begründen. (…)
Der Systemtheoretiker [Luhman] fragte nicht nach den Gründen. Insgeheim machte er die öffentliche Verwaltung jener Zeit zum Modell aller Systeme und den Status quo dieser Jahre zu deren Urbild. Dabei blendete er die historische Bedingtheit des Status quo aus und sah darüber hinweg, dass seine Maßgeblichkeit gewachsen, erarbeitet und verlierbar ist, dass sie geistige, kulturelle und soziale Bestände voraussetzt. Er erhob den Status quo zu einer sozialontologischen Kategorie, schwächte damit aber zugleich den konservativen Kern seines Arguments. In seiner rein funktionalistischen Lesart ist es der utopischen Sozialtechnologie des »Great Reset«, die sich anschickt, im Weltmaßstab Tabula rasa zu machen, nicht gewachsen.
Digitale Sozialtechnologie
Das größte Problem in Luhmanns Argumentation ist, dass sie den Konservatismus auf ein kalkulatorisches Problem der »Rechenkapazität« zusammenschrumpfen lässt. Dieser Reduktionismus unterscheidet seinen »Konservativismus aus Komplexität« von der oben angeführten lebensweltlichen, existenziellen Interpretation der Beweislastumkehr. Das Leben sei schlicht zu kurz für Totalrevisionen, variiert Odo Marquard sein zentrales Argument: »Darum muß man, wenn man – unter den Zeitnotbedingungen unserer vita brevis – überhaupt begründen will, nicht die Nichtwahl begründen, sondern die Wahl (die Veränderung): die Beweislast hat der Veränderer.«
Luhmann vermeidet diese lebensweltliche Fundierung und weist mit der Rechenkapazität ein funktionales Äquivalent für den Status quo aus, das auf keine Vorgeschichte angewiesen ist. In der Konsequenz bedeutet dies, dass die Maßgeblichkeit des Gegebenen, der Ankerpunkt des funktionalistischen Konservatismus, ersetzbar ist. Die rasante Zunahme der Rechenleistung in den vergangenen Dekaden gab zu berechtigter Hoffnung Anlass, sie tatsächlich auch ersetzen zu können.
»Das digitale Nervensystem schafft eine umfassende Transparenz, welche die Lücke zwischen Werten und Verhalten verringert hat«, heißt es in der Studie. »Individuen können in der realen und virtuellen Welt eindeutig identifiziert werden, ihre Absichten können prognostiziert und ihre Handlungen transparent gemacht werden.« In solchen Formulierungen zeigt sich, dass es um sozialtechnologische, digitalpanoptische Äquivalente für sozialen Zusammenhalt, letztlich um die rückstandslose Substituierung des Sozialen selbst geht.
Es komme zu »einer weitgehenden Homogenisierung der Wertesets unter den am Punktesystem aktiv Teilnehmenden«, stellen die Autoren der Studie in Aussicht. Konflikte werden nur zwischen den Befürwortern und den zunehmend marginalisierten Gegnern des Systems erwartet. Das in der Coronakrise etablierte biopolitische Klassifizierungssystem lässt sich als primitive Vorstufe eines solchen Punktesystems deuten. Erweitert werden könnte diese durch die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung, eines vorgeblich bedingungslosen, in Wahrheit an fortwährende Konformitätsnachweise geknüpften Grundeinkommens sowie einer globalen digitalen Identität.
Auf die Orientierungsfunktion des Gegebenen, das immer ein Vor-Gegebenes einschließt und den »Einbau von erinnerter Geschichte« voraussetzt, sind die Sozialingenieure des »Great Reset« nicht angewiesen. Das Vorhaben, in globaler Dimension bei null anzufangen und den Status quo durch eine »Neue Normalität« zu ersetzen, lässt den Utopismus der 68er-Bewegung, mit dem sich Luhmann auseinandersetzte, als bieder und engstirnig erscheinen.
Auch in der Ökonomie verleihen die neuen Möglichkeiten von Big Data und Künstlicher Intelligenz der Idee Auftrieb, eine gesamtwirtschaftliche Steuerung zu etablieren, die eine effizientere Allokation von Gütern und Kapital ermöglicht als das freie Spiel der Kräfte auf dem Markt. Wenn Empfehlungsalgorithmen schon heute die Wünsche von Konsumenten ›lesen‹ und vorhersagen, dann könnten, so die Erwartung, bald schon prädiktive Algorithmen Knappheit, Bedarf und Nachfrage sowohl granular als auch gesamtgesellschaftlich ermitteln und antizipieren. Der Markt hätte sich in diesem Fall als Signalsystem und Allokationsinstrument erübrigt. (…)
Wer auf das sozialtechnologische Vorbild China verweist, sollte die kalifornischen Einflüsse nicht ausblenden. Der Digitalkonzern Google, alias Alphabet, forscht schon seit Jahren an neuen datenbasierten Regierungsformen und Konzepten einer digitalisierten Polis. »Staaten sind für Google überkommene Konstruktionen, die mit der richtigen Software programmiert werden müssen«, bemerkte Adrian Lobe bereits 2015 und machte auf Pläne für ein »Government Innovation Lab« aufmerksam. Der weißrussische Medienforscher und Netztheoretiker Evgeny Morozov charakterisiert ein Denken, das auf die digitale Lösung von Problemen zielt, ohne diese hinterfragt, begrifflich durchdrungen und in ihrer Tragweite ermessen zu haben, als »Solutionismus«.
Diese Haltung erscheint zunächst als Extremform der instrumentellen Vernunft, wie Horkheimer sie auf den Begriff brachte. Die technische Lösung lässt Zweck und Ziel ihrer Anwendung nicht nur in den Hintergrund treten, sondern verdrängt sie und tritt an ihre Stelle. Verknüpft ist dieser »Solutionismus« jedoch mit maßlosen Ansprüchen der Selbst- und Weltverbesserung, die eher als übersteigerte Formen objektiver Vernunft zu charakterisieren wären und nicht selten mit transhumanistischen Utopien einer Verschmelzung menschlicher und maschineller Intelligenz verbunden sind. Es geht nicht nur um Funktionen und Funktionieren. Die technische Lösung gewinnt Erlösungsqualität – am deutlichsten in der eschatologisch erwarteten »Singularität«, in welcher der Mensch mit Hilfe Künstlicher Intelligenz seine natürlichen, biologischen Grenzen überschreiten werde. Ziel ist der Abschluss, die Überbietung der Menschheitsgeschichte.
Um die im Buch enthaltenen Fußnoten und Quellenangaben bereinigter, leicht gekürzter Auszug aus:
Michael Esders, Ohne Bestand. Angriff auf die Lebenswelt. Manuscriptum, Klappenbroschur, fadengeheftet, 284 Seiten, 24,00 €
Mit Ihrem Einkauf im TE-Shop unterstützen Sie den unabhängigen Journalismus von Tichys Einblick! Dafür unseren herzlichen Dank!! >>>



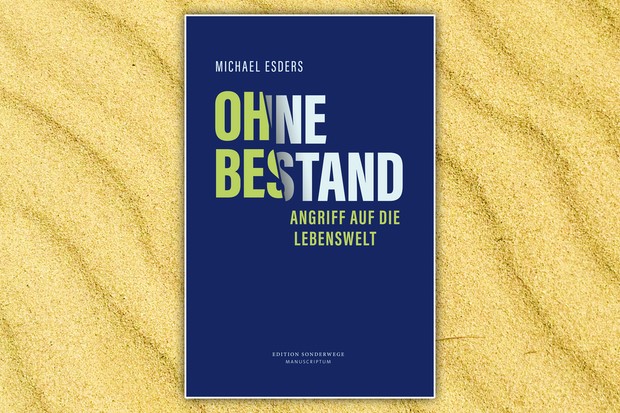
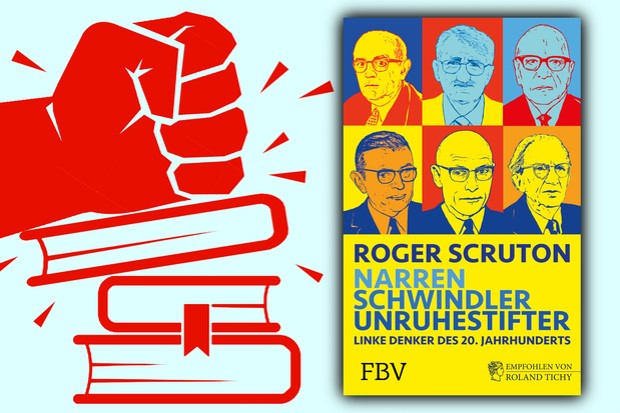


























Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
Der Autor beschreibt, wie totalitäre Sozialtechniker mit Hilfe von kybernetischer Software [Algorithmen der Simulierten Intelligenz = ‚Künstliche Intelligenz‘] in einer von durch Netzwerke verbundenen und computerisierten Gesellschaft die Herrschaft über Bürger ausüben.
Was will mir der Autor dieses Textes sagen?