Man erzählt sich, ein Wiener Philosoph habe einmal einen Vortrag über Heidegger gehalten und nachher geäußert, er habe offensichtlich klar genug gesprochen, denn ein Bäuerlein in der ersten Reihe habe ihn die ganze Zeit über verständnisinnig angeschaut. Am Ende habe sich herausgestellt: Das Bäuerlein war Heidegger.

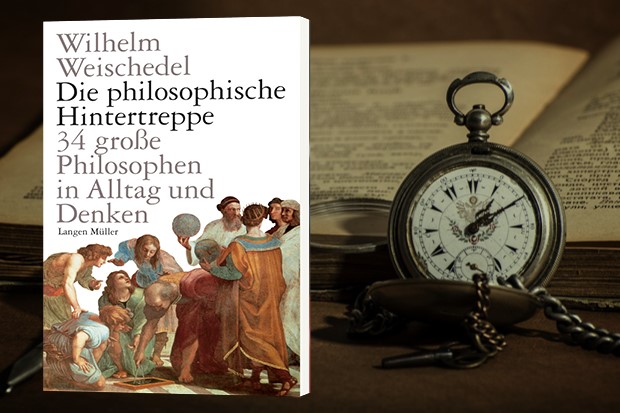
Wer einen Denker verstehen will, tut gut daran, auch die Welt zu bedenken, aus der er stammt. Das ist bei Martin Heidegger von besonderem Gewicht; seine Herkunft begleitet ihn sein Leben lang. Er kommt aus dem alemannischen Raum, ist 1889 in Meßkirch geboren. Er bringt sein Leben fast ohne Ausnahme im Schwarzwald oder zu dessen Füßen, in Freiburg, zu. Oben, am Hang des Feldberges, besitzt er eine Hütte, kärglich ausgestattet mit Holzbänken und Betten von spartanischer Einfachheit; das Wasser muss man aus einem nahegelegenen Brunnen schöpfen.
Auf der Bank vor der Hütte sitzt Heidegger oft lange und betrachtet die Weite der Berge und das schweigende Ziehen der Wolken, indes in ihm die Gedanken reifen. Oder er unterhält sich im »Wirtschäftle« mit den benachbarten Bauern über deren Dinge, in der tropfenden Weise des Gesprächs, die den Menschen dieses Landstrichs eigen ist. Doch das Alemannische zeigt sich nicht nur in Heideggers Hang zu Landschaft und Menschen des Schwarzwaldes. Es kommt auch in seiner geistigen Wesensart zum Vorschein: dem schweren, bedächtigen Denken, dem grüblerischen Tiefsinn, der Einsamkeit, die ihn umgibt, der leisen Schwermut, die von ihm ausgeht.
Auch das Äußere dieses Mannes hat etwas Bäurisches an sich. Man erzählt sich, ein Wiener Philosoph habe einmal einen Vortrag über Heidegger gehalten und nachher geäußert, er habe offensichtlich klar genug gesprochen, denn ein Bäuerlein in der ersten Reihe habe ihn die ganze Zeit über verständnisinnig angeschaut. Am Ende habe sich herausgestellt: Das Bäuerlein war Heidegger. Das mag eine Legende sein. Aber wenn man auf Fotografien sieht, wie Heidegger, nicht groß von Gestalt, in einem nach folkloristischen Ideen der Jugendbewegung entworfenen Anzug, mit der Zipfelmütze auf dem Kopf, über die bergigen Wiesen stapft, dann spürt man unmittelbar etwas von der Erdverbundenheit dieses Philosophen. Sie auch veranlasst ihn, zweimal einen ehrenvollen Ruf an die Berliner Universität auszuschlagen; er scheut den Lärm und den Kulturbetrieb der Großstadt und will lieber in dem einstmals stillen Freiburg bleiben oder auf dem »Feldweg« gehen, dessen »Zuspruch« er in einer besinnlichen Schrift beschreibt.
Als Lehrer nicht so sehr des Skilaufens, als vielmehr des Philosophierens übt Heidegger einen großen Einfluss aus. Er spricht ohne jedes Pathos, ohne rhetorische Mätzchen und ohne überflüssige Redensarten, mit einer angestrengten, etwas rauen und kehligen Stimme, jedes Wort einzeln betonend, oftmals auch in abgerissenen Sätzen. Doch von seinen Worten geht eine starke Faszination aus. Wenn er Vorlesungen oder Vorträge hält, ist jeder Hörsaal zu klein. In seinen Seminaren lernen die Schüler die Anstrengung eines Denkens kennen, das immer bei der Sache bleibt, keinem Problem ausweicht und jede voreilige Antwort verschmäht.
So wirkt Heidegger schon in jungen Jahren als Dozent in Freiburg, dann als Professor der Philosophie in Marburg und wieder in Freiburg. Vor allem in seiner früheren Zeit kümmert er sich intensiv um seine Studenten, die zu einem großen Teil heute die Lehrstühle der Philosophie, aber auch der Theologie und anderer Wissenschaften einnehmen. Sie erinnern sich auch an manches Fest im Hause Heidegger, mit Lampionumzug durch den Garten und mit Volksliedergesang, aber auch mit tiefdringenden Diskussionen.
Heidegger ist der Auffassung, der Gedanke dürfe nicht rein bei sich selbst bleiben, sondern er müsse verwandelnd in die Existenz eingreifen: sowohl in die private wie in die öffentliche. Das führt zu einer großen Lebendigkeit seines Denkens. Das bringt ihn aber auch dazu, dass er für eine kurze Zeit meint, im Nationalsozialismus sei sein Gedanke vom heroischen Ausstehen des auf den Tod zugehenden Daseins verwirklicht. Er büßt um dieses Irrtums willen sein Lehramt ein und hält sich von da an von der aktuellen Politik fern. In späteren Jahren zieht er sich fast völlig von der Öffentlichkeit zurück und tritt nur noch in esoterischen Kreisen auf, aber auch da noch immer Zeugnis ablegend von der Kraft und Tiefe seines Denkens.
Heideggers philosophische Wirksamkeit hat zwei Höhepunkte: einmal um die zwanziger Jahre, sodann in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg. Die erste Periode wird durch das Erscheinen von »Sein und Zeit« eingeleitet, eines Buches, das, obwohl nur in seiner ersten Hälfte herausgegeben, doch wie ein Blitz in die philosophische Landschaft einschlägt. Für Heidegger bedeutet es den Durchbruch zu seinem eigensten Denken, zu dem er sich, herkommend von der Katholischen Theologie und vom Neukantianismus, emporarbeitet, nicht ohne Einfluss des großen Phänomenologen Edmund Husserl, dem das Buch auch gewidmet ist.
Wie nun kann diese Frage in Gang gebracht werden? Und weiter: Wo wird dem Menschen das Sein zugänglich, nach dem er fragt? Heidegger antwortet: im Seinsverständnis; darin also, dass der Mensch immer schon irgendwie versteht, was Sein bedeutet. Dieses Seinsverständnis drückt sich in der Sprache aus, aber auch im alltäglichen Zutunhaben mit den Dingen und im Umgang mit den Mitmenschen.
Um das Seinsverständnis aufzuhellen, redet Heidegger in eingehenden Analysen vom Menschen als dem Ort des Verstehens von Sein. Dabei geht er nicht von einem abstrakten Begriff vom Menschen aus, sondern vom konkreten, empirischen Menschen und von dessen Selbstverständnis und Selbsterfahrung. Er betrachtet den Menschen auch nicht von einem Blickpunkt außerhalb seiner selbst, etwa von Gott oder von einem absoluten Geist her, sondern so, wie er sich selber, in seiner eigenen Perspektive, erscheint.
Unter diesem Gesichtspunkt zeigt Heidegger, wie der Mensch nicht einfach da ist wie ein Stein oder ein Baum, sondern wie er in und aus den Möglichkeiten lebt, auf die hin er sich entwirft. Heidegger belässt den Menschen auch nicht in der künstlichen Isolierung, in der ihn die neuzeitliche Philosophie seit Descartes zu sehen gewohnt ist. Er redet vielmehr davon, wie jeder Mensch seine »Welt« hat, wie er unter anderen Seienden und mit anderen Menschen existiert; er spricht von seinem »In-der- Welt-Sein« und von seinem »Mitsein mit anderen«.
In dieser Konzeption besitzt der Mensch vor allem anderen Seienden die Auszeichnung, dass sich durch ihn hindurch die Welt, die ohne sein Eingreifen verschlossen bliebe, auftut, dass sie geschaut, erkannt, gefühlt wird. Durch seinen »Einbruch in das Ganze des Seienden« geschieht es, dass dieses »offenbar« wird.
Das nennt Heidegger die »Transzendenz« des menschlichen Daseins. Dieser Ausdruck meint nicht, dass der Mensch sich auf ein übersinnliches Wesen oder auf eine übersinnliche Welt bezöge; im Sprachgebrauch Heideggers will Transzendenz vielmehr besagen, dass der Mensch alles Seiende immer schon im Hinblick auf das Sein überstiegen hat, das gleichsam den Horizont alles Verstehens, Fühlens und Erkennens bildet.
Das Gleiche bedeutet für Heidegger der Ausdruck »Existenz«, den er häufig in der Schreibweise »Ek-sistenz« verwendet. Existenz heißt nicht das nackte Dasein des Menschen: dass er also einfachhin vorhanden wäre, wie ein Stein oder ein Baum. Existenz besagt vielmehr: Der Mensch ist wirklich in der Weise des Existierens, des ex-sistere, des Hinausstehens aus sich selbst, nämlich des Hinausstehens in das immer schon verstandene Sein.
Auszug aus:
Wilhelm Weischedel, Philosophie über die Hintertreppe. 34 Philosophen in Alltag und Denken. Langen Müller, Klappenbroschur, 336 Seiten, 20,00 €.
Mit Ihrem Einkauf im TE-Shop unterstützen Sie den unabhängigen Journalismus von Tichys Einblick! Dafür unseren herzlichen Dank!!>>>



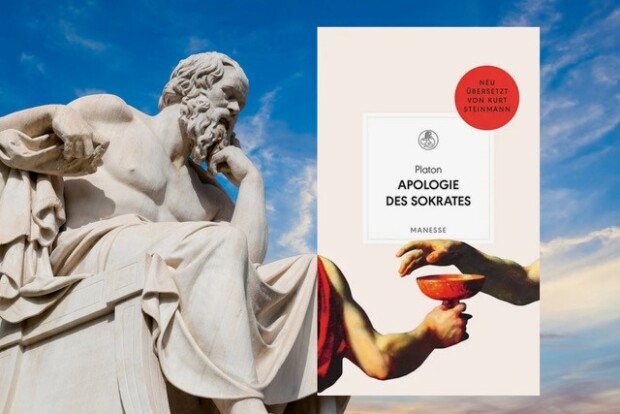
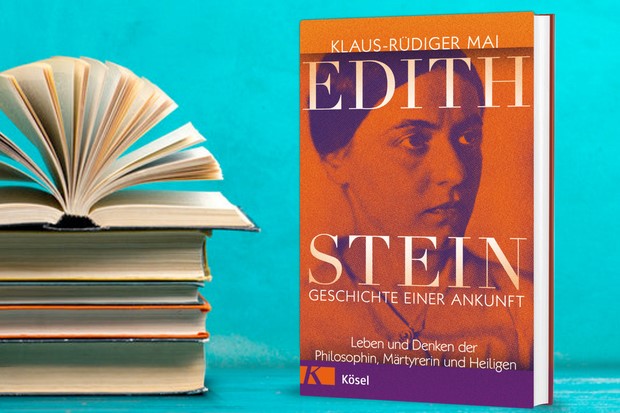





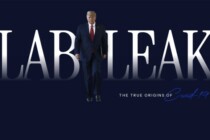
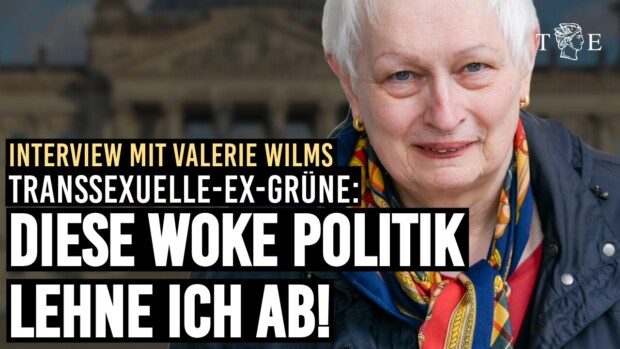








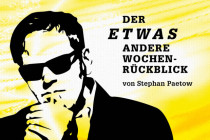








Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
Bei Heidegger stößt nicht zuletzt der „Verkündungsstil“ ab – wie einem bei Nietzsche das Pathos mit der Zeit auf die Nerven geht.
Heidegger wird gut analysiert bei E. Topitsch, Erkenntnis und Illusion
Wer Heideggers Wortmagie (Sprachspielereien) für tiefsinnige Philosophie hält,
dem empfehle ich die Parodie R. Neumanns auf den Denker oder auch P. Rühmkorfs Bemerkung, daß ihm die (kurze) Lektüre „noch heute“ leidtue.
Es ist „musica di vocaboli“ (Pareto)
Heidegger wurde schon früh ein Anhänger des Nationalsozialismus und auch Parteimitglied, blieb es bis zu Kriegsende. Was er als Rektor der Freiburger Universität „verbrochen“ hat, läßt die Mitgliedschaft eines W. Jens oder G. Grass in der Waffen-SS fast als Jugendsünden erscheinen.
Man muss Heidegger nicht nur lesen, man muss ihn unbedingt hören, um ihn ein wenig zu verstehen. Es gibt dafür immer noch zumindest antiquarisch Original-Tondokumente, die einem die Tiefgründigkeit seines Denkens näher bringen, als das geschriebene Wort es erreichen kann. Eindrücklich seine Art des Sprechens und sein ständiges Bemühen um Präzision des Begriffs. Es scheint mir eine Art der Musik der Worte zu sein. Besonders beeindruckend ein Vortrag zum Wesen der Sprache. Er muss damit nicht immer richtig liegen, aber selbst im Irrtum bleibt es ein Kunstwerk. „Sprache“, sagt er, „ist ganz bei sich selbst“.
Sehr geehrter Herr „Tallyrand“, vielen Dank für Ihren Hinweis.
Hochachtungsvoll
Zur NS-Zeit wurde Heidegger von einem Psychologen als „„einen der größten Wirrköpfe und ausgefallensten Eigenbrötler“ bezeichnet. Das erscheint ein ganzes Stück weit glaubhaft und nicht wegen der Superlative.
Das kann man vermutlich für viele der im vorgestellten Band aufgeführten Leute so stehenlassen, egal ob man es mit Superlativ als Lob oder ohne als Ablehnung versteht.
Der erste Halbsatz der Aussage von Marx gilt jedenfalls auch für Heidegger: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert…..“ und man mag eher lapidar ergänzen, dass es schon viele Philosophen gab, selbst wenn man nicht die ganzen Dr. phil. als solche mitzählt.
Der geniale Weischedel sollte nicht nur von studierten Philosophen rezipiert werden, sondern von allen halbwegs verständigen Bürgern. Er bringt in seiem Buch nicht nur Heidegger, sondern alle wichtigen Philosophen zur Sprache und das auf spannende, unterhaltsame und humorvolle Weise. Wem bisher die Phliosophie als dunkles, unergründliches Abstraktum erschien, kann durch die Lektüre dieses verständlichen Werks einen Zugang zum philosophischen Denken finden.
Schon in der griechischen Antike wurden durch die Vorsokratiker, Platon und Aristoteles die wichtigen Fragen des sterblichen Menschen und seiner gemeinschaftlichen Existenz abgehandelt. Alle entscheidenden Fragen wurden damals schon gestellt.
Danke, dass TE mit Weischedel an Martin Heidegger erinnert und damit an eine längst vergangene Zeit des letzten Jahrhunderts, als im deutschsprachigen Raum Denker und Philosophen von Weltrang unterwegs waren – ich nenne hier nur Wittgestein, Adorno, Bloch, Husserl oder Hannah Arendt. Wenn man heute in die philosophischen Fakultäten schaut, wird einem der völlige Abbruch dieser intellektuellen Tradition schmerzlich bewusst. Es ist schon bezeichnend, dass das heutige Deutschland philosophisch auf der Ebene eines TV-Entertainers Precht angekommen ist …
Dass er Hölderlin so mochte, verbindet mich mit Martin Heidegger. „Nah ist der Gott und schwäär zu fassen . … .“ Und er fragt doch glatt: und deshalb oder trotzdem? So schwär? O ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt … – Hyperion an Belarmin. So vergehen Sein&Zeit im Traum. Schaumermal, ob es noch einen Traum gibt, wenn die Zeit gekommen ist.
Eine überaus faszinierende philosophische Reminiszenz, welche die Mahnung an die irdische, volkstümliche Verbundenheit („Das Volk ist nicht tümlich„, Bertholt Brecht) enthält. Insofern nahm Heidegger avant la lettre und real lebend die Dialektik „Somewheres – Anywheres“ vorweg.
Die Hegelei und Heideggerei und Adornoerei ist Deutschlands Erbkrankheit. Von Kaiser Wilhelm über den Führer zur RAF und den Grünen – immer soll am deutschen Wesen die Welt genesen. Dabei ist dieses Wesen nichts weiter als Schall und Weihrauch. Deutsch zu sein, das ist diese ekelhafte Mischung aus Frömmigkeit, Größenwahn, Angst und Unterwürfigkeit, die nach der Vernichtung des Christentums durch die Aufklärung die schwäbische Theologie auf die Weltbühne gehoben hat, wo sie sich fortan Philosophie nannte, um weiter Geld verdienen zu können. Aber natürlich bleibt sie Theologie – dunkles Geraune mit dem Ziel, Universitätssekten zu gründen, die von Staatsknete leben.… Mehr
Genau: es ist Theologie ohne Gott. Heidegger mimt den Seher, den Erwählten. Es wird nicht argumentiert,´sondern gepredigt
„In seinen Seminaren lernen die Schüler die Anstrengung eines Denkens kennen, das immer bei der Sache bleibt, keinem Problem ausweicht und jede voreilige Antwort verschmäht.“
Eine Eigenschaft, die sich nicht mehr in der heutigen Politik durchzusetzt.
Das „Denken“ wird fuer uns von den einschlaegigen Framinganstalten vorgekaut und den
Non-Governmental-Organisations erzwungen.Ein beschwingtes und leichtes Leben fuer Waehler und Sektenmitglieder.