Er gehört zu den bekanntesten Autoren Deutschlands. Vor Kurzem verließ Harald Martenstein den „Tagesspiegel“ nach einem Streit um einen Text über Corona-Demonstrationen. Ein Gespräch über seine Einordnung als neuer Rechter, die autoritäre Linke und die deutsche Medienlandschaft


Tichys Einblick: Herr Martenstein, Sie sind Autor etlicher Bücher, Träger zahlreicher Preise, und Sie waren jahrzehntelang eine prägende Stimme beim „Tagesspiegel“. Bis es in diesem Jahr zum Bruch mit diesem Blatt kam, als Sie in einer Kolumne Demonstranten gegen Corona-Maßnahmen gegen den pauschalen Vorwurf des Antisemitismus verteidigt hatten. Sie schreiben gerade an einem Buch über diese Trennung und das politische Klima in Deutschland. Haben Sie schon genügend Abstand zu dem, was passiert ist?
Harald Martenstein: Ich habe 33 Jahre für diese Zeitung gearbeitet. Das ist schon viel. Und der Anlass war ein bescheidener, würde ich sagen. Diese Geschichte hatte viel mit Lügen und Intrigen zu tun, und sie ging mit menschlichen Enttäuschungen einher. Das, was auf jeden Fall bei mir bleibt, ist ein irreversibles Misstrauen. Ich glaube nicht, dass ich in diesem Gewerbe noch mal jemals jemandem vertrauen kann. Das tut mir leid für die vertrauenswürdigen Leute, die es ja gibt. Aber da ist etwas, was bleibt, fürchte ich.
Sie sind zur „Welt am Sonntag“ gewechselt, gleichzeitig schreiben Sie noch in der „Zeit“. Ist das Meinungsspektrum dort breiter?
Ich glaube, dass es bei der „Zeit“ so ist. Es gibt dort ein wirklich breites Spektrum, das weit in das woke Milieu hineinragt, wenn ich das mal so nennen darf. Es gibt aber auch Leute, die anders ticken. Es finden Debatten statt. Ich halte das Ressort „Streit“, das dort eingeführt worden ist, für ein ermutigendes Zeichen. Natürlich ist der Name „Streit“ ein bisschen defensiv. Er signalisiert gleich: Achtung, hier kommt die umstrittene Zone. Aber die „Zeit“ kommt meinen Vorstellungen von Meinungsvielfalt schon nahe. Wie lange das hält, kann ich nicht sagen.
Das hatte so ähnlich schon ein bürgerlicher Autor 1917 in Russland gesagt: Die bürgerliche Ordnung unterliegt, weil ihre Vertreter gegen Lenins Leute nicht zu den gleichen Mitteln greifen wollen, die sie benutzen.
Ja, aber was ist der Ausweg aus diesem Dilemma? Mir fällt keiner ein, außer dass ich auch Dogmatiker und Fanatiker würde. Und das will ich nicht. Also bin ich an dieser Stelle verwundbar.
Können wir ein wenig zurückblicken, bevor wir wieder zur Gegenwart kommen? Ihr Vater war Begleitmusiker des linken Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch. Sie selbst engagierten sich in jungen Jahren in der DKP, später waren Sie dann gemäßigt links. Ist damit der Weg zum Renegaten schon vorgezeichnet? Warum waren so viele, die heute als Rechte gelten, früher mal links?
Ich gebe Ihnen insofern recht, als auch ich bei vielen Leuten, die ich aus meiner Jugend kenne oder die eine ähnliche linke Biografie haben, einen ähnlichen Weg festgestellt habe. Was vielleicht damit zusammenhängt, dass das, was man damals als Ideal vor sich hertrug, viel mit persönlicher Freiheit zu tun hatte, mit Ideen wie Chancengleichheit und einem starken Individualismus. Bei vielen Linken, sogar wenn sie sich damals als Maoisten oder Anhänger einer ähnlich rigiden Denkrichtung verstanden, ging es in Wirklichkeit wild durcheinander. Man hatte keine Probleme damit, sich mit Ho Chi Minh zu identifizieren, amerikanische Musik zu hören und zu kiffen. Das ging ja alles irgendwie zusammen. Ich würde Ihnen aber widersprechen bei der Einschätzung, ich sei rechts.
Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass Leute sich als Rechte verstehen, weil das ja nun mal, spätestens seit 1789, glaube ich, die beiden Pole sind, an denen das politische Spektrum sich sortiert. Eine Demokratie, in der es nicht mehr links und rechts gäbe, wäre jedenfalls nicht mehr die Art von Demokratie, an die wir uns im Laufe der Jahrhunderte gewöhnt haben. Insofern ist es ganz in Ordnung, links oder eben rechts zu sein. Die Gleichsetzung von rechts mit rechtsradikal oder der Versuch, alles Konservative in eine Nazi- oder naziaffine Ecke zu schieben, ist ja nur aus zwei Motiven heraus zu erklären: entweder grenzenlose Bösartigkeit oder völlige Verblödung.
Aber ich selbst sehe mich als Liberalen und nicht als Rechten. Was beispielsweise damit zu tun hat, dass der patriotische Muskel bei mir unterentwickelt ist. Wobei ich nichts dagegen habe, wenn Länder ihre Interessen vertreten. Das sollten sie schon tun. Ich bin auch gesellschaftspolitisch in vielen Punkten nach wie vor einverstanden mit dem, was die Grünen oder die SPD machen. Ich befürworte zum Beispiel die Legalisierung von Cannabis und auch die Erleichterung einer Geschlechtsumwandlung für Erwachsene – wohlgemerkt für Erwachsene, nicht für Jugendliche. Wenn es die Grünen, die Sozis und die Liberalen nicht gegeben hätte, dann hätten wir den Paragrafen 175 womöglich immer noch. An solchen Punkten hat die Linke schon ihre Verdienste, das ist ganz klar. Sie ist aber, und das ist das Entscheidende, worauf ich hinauswill, autoritär geworden. Viele aus meiner Generation, die als Linke angefangen haben, wollten diesen autoritären Weg nicht mitgehen.
Nun kann man mit Simone de Beauvoir sagen: Ein Rechter ist man nicht unbedingt, zum Rechten werden manche auch gemacht. Die Bezeichnung ist ja oft vor allem eine Zuschreibung. Für viele Wohlmeinende gelten Sie als Rechter. Beziehungsweise, ich darf einmal zitieren, als „Mario Barth für ,Zeit‘-Leser“, jemand, der „stellvertretend für die sich schweigend haltende Mehrheit weißer, heterosexueller alter Männer“ steht, die „gegen ihren Machtverlust anschreiben“. Das alles wird Ihnen bescheinigt von Leuten, die offenbar keinen Machtverlust erleben, sondern einen Machtzuwachs.
Mich fasziniert, wie in den neueren Debatten der Spieß einfach umgedreht wird. Da wird ja wirklich mit vom Rassismus abgeleiteten Kategorien argumentiert. Sie sehen einen Menschen, ordnen ihn in eine bestimmte Kategorie ein und wissen dann, was Sie von dieser Person zu halten haben. Das ist rassistisches Denken, oder nennen Sie’s das Denken in Kasten, in Familien – ja, stimmt, die Mafia denkt auch so. Ich finde, wir sollten uns gegenseitig als Individuen sehen, die verschieden sind und über die sich erst dann irgendwas Verbindliches sagen lässt, wenn wir sie ein wenig kennen.
Die Frage bleibt, wie Sie und andere mit diesen Zuschreibungen umgehen. Sie können sie ignorieren – dann machen die allerdings demjenigen Platz, der Sie anklagt. Oder Sie wehren sich polemisch. Dann heißt es: Schau, ein Wutbürger. Oder man macht sich darüber lustig. Dann lautet der Vorwurf: Er verabschiedet sich aus dem ernsthaften Diskurs. Was tun Sie?
Sie beschreiben das richtig. Man kann es diesen Leuten nicht recht machen, außer indem man verschwindet. Das ist die einzige Art des Rechtmachens, die es für Leute wie mich gibt. Das werde ich aber erst dann tun, wenn dazu eine biologische Notwendigkeit besteht.
Das DKP-Milieu muss ja offenbar für etliche Leute eine Anziehungskraft besessen haben. Dieter Bohlen zum Beispiel war vor seiner Popkarriere auch Mitglied. Warum sind Sie damals Mitglied geworden? Und haben Sie dort auch etwas Nützliches gelernt?
Mit Dieter Bohlen hatte ich übrigens einmal ein sehr langes, sehr nettes Telefongespräch. Nicht damals in der DKP, da sind wir einander nicht begegnet. Ich hatte ihn mal in der „Zeit“ gegen irgendeinen blöden Vorwurf verteidigt, und Dieter Bohlen war so überrascht davon, dass er mich sogar zu sich nach Hause eingeladen hat, was aber leider an Termingründen gescheitert ist.
Was die DKP betrifft: Ich bin dort gelandet, weil ich im Haushalt meiner Großeltern in einem sehr stark von Arbeiterbewegung und Sozialdemokratie geprägten Milieu aufgewachsen bin.
Die damals weltberühmten K-Gruppen hatten ja kaum Arbeiter oder Lehrlinge in ihren Reihen. Die DKP in Mainz, wo sich das abspielte, war dagegen eine Partei, in der noch viele Arbeiter Mitglied waren. Teilweise auch Leute, die während des Nationalsozialismus im Widerstand gewesen waren. Die haben mir als Persönlichkeiten imponiert. Und ich dachte, ich gehe nicht zu den Imitatoren der kommunistischen Parteien, ich gehe gleich zum Original. Ich bin in dieser Zeit aber verschärft antiautoritär geworden.
„Man kann es den Leuten nicht recht machen. Außer dass man verschwindet. Den Gefallen werde ich denen nicht tun“
Wie das?
Wenn ich zurückblicke – es war ein unglaublicher Aufwand, der dort zur Demokratievorspiegelung betrieben wurde. Es gab jede Menge Wahlen und Diskussionen, die in Wirklichkeit keine Wahlen waren und auch keine Diskussionen. Die Ergebnisse standen ja schon vorher fest. Viel später habe ich dann den Satz von Walter Ulbricht gelesen, 1945, als er nach Deutschland kam: „Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.“ Damit hat er die kommunistische Politik wirklich auf den Punkt gebracht. Bei Putin ist es immer noch die gleiche Grundidee. Und so habe ich das auch in der DKP erlebt.
Und dann dagegen rebelliert?
Irgendwann gab es einen kleinen Aufstand in der Ortsgruppe. Wir hatten eine Reihe neuer Mitglieder gewonnen, Gewerkschafter. Und die fanden es nicht in Ordnung, dass bei den Vorstandswahlen immer nur über eine vom scheidenden Vorstand vorher festgelegte Liste abgestimmt wurde, mit Ja oder Nein. Da sagten diese neuen Leute: Das ist doch nicht demokratisch. Es muss doch eine Alternative geben. Es stellten sich einige Leute zusätzlich zur Wahl, zur Wut des scheidenden Vorstands. Diese oppositionelle Gruppe unterschied sich gar nicht so sehr von dem vorhandenen Vorstand, keiner hatte irgendwie konterrevolutionäre oder bürgerliche Vorstellungen. Trotzdem sind die Leute, die für diese alternativen Kandidaten die Hand gehoben hatten, dann nach und nach aus der Partei verschwunden. Man hat sie geschnitten, irgendwie gingen die dann alle, ich bin auch gegangen. Ich bin nie ausgetreten, seltsamerweise. Ich bin einfach nicht mehr hingegangen.
Und damit hatte sich für Sie das Abenteuer erledigt?
Was ich gelernt habe, lässt sich vielleicht am besten so zusammenfassen: Demokratie findet nur dort statt, wo verschiedene Auffassungen miteinander ringen und wo es für beide Seiten möglich ist, zu gewinnen. Demokratie ist ein Wort für die Möglichkeit, sich seiner Obrigkeit zu entledigen, ohne ein Schafott zu errichten oder die alte Führung ins Gefängnis zu werfen.
Wie haben Sie den Mauerfall erlebt?
Im „Tagesspiegel“, bei dem ich ja damals schon Redakteur war, hatte niemand auch nur im Entferntesten damit gerechnet. Man dachte, vielleicht gibt es ein bisschen Lockerung, eine erleichterte Reiseregelung für die Ostdeutschen oder so was. Beim „Tagesspiegel“ kursierte eine Anekdote, der zufolge am 9. November abends Kollegen in die Redaktion kamen und riefen: „Irre, die Mauer ist offen!“ In der Chefredaktion habe es geheißen: Das ist unmöglich, dpa hat es noch nicht gemeldet. Ich war nicht selbst dabei. Aber diese Geschichte passt gut zu der damaligen Zeitung.
Kurz darauf, 1990, gab es zwei große Richtungen, mit dem Epochenbruch umzugehen: die These von Francis Fukuyama, wonach das Ende der Geschichte gekommen sei, weil der liberale Westen gesiegt habe, und die Vorstellung vieler deutscher Linker, mit der deutschen Einheit käme das Vierte Reich. Was waren Ihre Vorstellungen?
Letztere Vorstellung war natürlich Unsinn. Wenn man sich die Westdeutschen anschaute, war klar, dass von denen bestimmt kein Viertes Reich ausgehen wird. Aber ich überlege gerade, inwieweit damals,1990, schon die gegenwärtige Zeit irgendwie ihre Schatten vorausgeworfen haben könnte. Und das kann ich rückblickend nicht erkennen. Man hatte wirklich das Gefühl, das liberale Zeitalter hat gewonnen. Das leuchtet insofern ein, weil das Ostblocksystem ja ohne den geringsten Widerstand in sich zusammengefallen war.
Und das wiederum erinnert mich auf eine paradoxe Weise an die heutigen Zustände: Wenn ich sehe, wie schnell alle den Schwanz einziehen, wenn irgendein aktivistischer Twitter-Angriff auf eine Redaktion, auf einen Prominenten oder ein Unternehmen gestartet wird. Wie wenig Widerstand geleistet wird. Wie selten es vorkommt, dass jemand in einer verantwortlichen Position sagt: Ich stehe zu meinen Leuten, ich gebe nicht nach; der Kollege oder die Kollegin muss sich nicht entschuldigen.
Der Unterschied ist nur: Damals traten erschöpfte Funktionäre eines Systems ab, das auch wirtschaftlich am Ende war. Heute halten Parteichefs, Universitätspräsidenten, Chefredakteure und Geschäftsführer einem Twitter-Sturm nicht einmal ein paar Stunden stand. Was ist da passiert?
Von diesen Eliten wird jedenfalls sehr wenig Widerstand geleistet. So wenig, als ob sie an das, was sie jahrzehntelang über Freiheit und das Aushalten von Widersprüchen erzählt haben, selbst nie geglaubt hätten. Beim Ende der DDR fragte man sich: Wo sind auf einmal die Kommunisten? Sie waren plötzlich fast alle weg. Sie konnten sich nicht mehr daran erinnern, was sie zwei Jahre oder auch nur zwei Wochen vorher noch gepredigt hatten.
Und was könnte der Grund sein? Es muss ja niemand wie in der DDR befürchten, abgeholt zu werden, wenn er den Mund zu weit aufmacht.
Ich glaube, dass viele Leute trotzdem Angst haben, um ihre Jobs, um ihre gesellschaftliche Position, man wird ja schnell zu einer Art Paria. Mit jedem, der verschwindet oder geht, ohne dass jemand für ihn den Finger krumm gemacht hätte, wissen die Übriggebliebenen, was ihnen möglicherweise bevorsteht.
„Heute frage ich mich: Wo sind die Liberalen in den Redaktionen,
in den Institutionen? Manchen hat es die Sprache verschlagen“
Als ich vom „Tagesspiegel“ weggegangen bin, bin ich ja nicht gecancelt worden. Ich bin gegangen, weil mir meine Selbstachtung keine andere Möglichkeit ließ. Die Chefredaktion hatte nicht nur meinen Text gelöscht, sondern zur Garnierung eine Erklärung veröffentlicht, in der sie mich zum Vollidioten und zu einer Gefahr für die Allgemeinheit erklärte. Für mich war das kein existenzielles Problem. Weil ich alt bin, weil ich ein paar Ersparnisse habe, weil ich einen Namen habe. Und weil ich hoffen konnte, dass sich woanders eine Tür für mich öffnen wird. Insofern bin ich wirklich kein Opfer.
Aber es ist eben ein Signal, wenn auch Leute, die relativ bekannt sind, die Preise gewonnen haben und sich bei einem nicht ganz kleinen Lesersegment einer gewissen Wertschätzung erfreuen, trotzdem aus bescheidenstem Anlass heftigsten Anfeindungen ausgesetzt werden. Das ist ein Signal an alle im Medienbetrieb, die in einer weniger starken Position sind. Deswegen wissen viele, was die Stunde geschlagen hat.
Und deshalb finden sich unter den jüngeren Journalisten und Autoren so wenige, die aus der Reihe tanzen?
Wenn ich noch einmal 20 wäre, würde ich nicht im Traum auf die Idee kommen, Journalist zu werden. Eher würde ich eine Nachtbar aufmachen. Das käme mir solider vor. Ich bewundere Leute wie meine Kollegin Anna Schneider bei der „Welt“, die jung sind und tatsächlich den Mut haben, neben der Spur einzusteigen in dieses Gewerbe. Da muss man Schneid haben.
Hätten Sie sich vor 30 Jahren vorstellen können, mal Journalist bei Springer zu werden?
Dort sammeln sich Leute, die anderswo nicht mehr passen?
Dort gibt es jedenfalls etliche renommierte alte Westlinke. Henryk Broder, der seit vielen Jahren für die „Welt“ schreibt, hat ja früher auch mal für den „Tagesspiegel“ geschrieben. Dort, bei Springer, herrscht für mich, nach meinen Erfahrungen der letzten Jahre, ein geradezu unbegreiflich offenes Meinungsklima.
Andererseits ist das Reizvolle für mich beim „Tagesspiegel“ gewesen, dass ich es dort ja gerade nicht nur mit Lesern zu tun hatte, die meine Weltsicht im Großen und Ganzen teilen. Es war schon so, dass ein Teil der Leserschaft die Dinge ähnlich gesehen hat. Aber es gab auch immer viele, die sich durch mich provoziert fühlten. Das ist eigentlich, finde ich, der Idealzustand einer Zeitung: ein breites Spektrum zu haben und Leute unterschiedlicher Grundüberzeugung zusammenzubekommen, die sich dann jeweils übereinander ärgern.
Ich habe ja im „Tagesspiegel“ auch immer viel gefunden, was mich ärgerte, so wie meine Texte natürlich auch wieder viele Leute in der Redaktion geärgert haben. Und genau so sollte es sein. Dass man diesen Ärger aushält und miteinander um irgendwas ringt. Einigkeit lässt sich manchmal nicht herstellen. Aber dass man eine Zeitung zum Schauplatz der gesellschaftlichen Debatten macht, das wäre der Idealzustand.
Der scheint heute allerdings fantastisch weit entfernt. Alles hat sich im politischen und medialen Bereich sehr sauber sortiert.
Ja, es gibt die Legion der Verdammten. Leute, die anderswo zu liberal geworden sind oder zu anarcho oder zu freiheitssüchtig oder zu sehr in den Widerspruch verliebt, landen früher oder später in der Legion der Verdammten. Einerseits ist es ja gut, dass es noch Inseln für die gibt. Andererseits ist das natürlich ein trauriger Zustand.
„Hat so ein deutscher Sonderweg
historisch eigentlich schon einmal Erfolg gehabt?“
Apropos trauriger Zustand: Es existierte ganz früher ja durchaus so etwas wie eine linke Lebensfreude als Teil der allgemeinen Lockerheit. Wo ist die Leichtigkeit geblieben?
Wenn man den Respekt zum wichtigsten Leitwert ernennt, also „Wir tun einander nicht weh“, dann haben Humor und Leichtigkeit es schwer. Humor ist nun mal respektlos. Respektvoll über jemanden Witze zu machen, ist zwar theoretisch denkbar. Man kann sich mit viel Mühe vielleicht das eine oder andere in dieser Richtung ausdenken. Aber im Großen und Ganzen, würde ich sagen, ist das schwer zu machen. Respekt und Humor gehen schlecht zusammen. Und natürlich haben wir heute auch die täglichen Askese-Predigten in den Ohren, eine Haltung, die Lebenslust und Lebensfreude generell unter Verdacht stellt. Wobei man, glaube ich, auch mit relativ geringem CO2-Ausstoß eine gute Party zustande bringt.
Vor allem, wenn man nicht lacht.
Ich habe ja, neben der linken, auch eine katholische Vergangenheit, weil ich aus Mainz komme, einer Stadt, die vom Katholizismus geprägt ist, auch wenn da viele Protestanten leben. Dem Katholizismus ist auch in seinen reaktionärsten Phasen schnell klar geworden, dass die Leute ein Ventil brauchen, egal wie streng die Regeln sind. Man muss ihnen gestatten, hin und wieder über die Stränge zu schlagen. Die Kirche hat sich anfangs schwer damit getan. Ich spreche jetzt als Mainzer. Die Kirche hat sich also schwer damit getan, dass die Leute einige Tage lang im Jahr zügellosen Sex haben, dass sie alles in sich hineinschütten, was sie kriegen können, und dass sie sich vorübergehend um fast kein Gebot scheren. Es hat eine Weile gedauert, bis die Kirche begriffen hatte, dass dieses Ventil nützlich ist. Ein Herrschaftssystem ohne Grauzonen, ohne Ventile, ohne Bereiche, in denen die Regeln nicht gelten, ist auf Dauer schwer aufrechtzuerhalten.
In puritanisch-korrekten Zeiten steht Humor unter Generalverdacht. Und wer selbst kämpfen und sich verteidigen muss, dem kommt möglicherweise diese Leichtigkeit abhanden. Ihnen manchmal auch? Wie halten Sie da die Balance?
Da sprechen Sie ein Problem an, das mich sehr beschäftigt. Ein Kollege, den ich sehr schätze, hat mir vor ein, zwei Jahren gesagt, dass ich aufpassen soll, nicht bitter zu werden. Ja, das ist wirklich die große Gefahr. Weil dann die Leichtigkeit verloren geht. Aber ich glaube, dass ich ein bisschen auf dem Rückweg ins Lockere bin, weil ich jetzt als Autor in einem freundlicheren Biotop gelandet bin.
Wenn ich versuche, etwas Humoristisches zu schreiben, was sehr stark stimmungsabhängig ist, was ich nicht jeden Tag machen kann, sondern nur, wenn es mir danach ist, dann empfinde ich es als eine schreckliche Bremse, mir immer die Frage stellen zu müssen: Wirst du dafür Ärger kriegen? Manche Kollegen kommen damit gut klar. Aber ich komme nicht gut damit klar.
Ihr Bruch mit ihrem früheren Medium geschah wegen eines Textes von Ihnen, in dem es um Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen ging. Jetzt erleben wir, dass die Länder rings um Deutschland ihre Maßnahmen aufgehoben haben; auch der US-Präsident erklärt die Pandemie für beendet. Der Bundesgesundheitsminister und etliche Deutsche, scheint es, wollen sich ihre Seuche nicht nehmen lassen. Was ist Ihre Prognose: Wie geht es hierzulande weiter?
Ich glaube, dass die Existenz so vieler Nachbarländer, in denen es freier zugeht, allmählich den Druck auf Deutschland wachsen lässt. Wenn jetzt der Winter kommt und es in verschiedenen Nachbarländern dabei bleibt, dass die Pandemie beendet ist, dann wird sich das auch hier auf Dauer nicht aufrechterhalten lassen. Deutschland macht sich damit in Europa lächerlich.
Das nehmen die Hundertprozentigen gern in Kauf.
Ja, tatsächlich. Wenn ich manchen Leute diese Frage stelle, bekomme ich oft die Antwort: Wir in Deutschland machen es halt richtig, die anderen machen es halt falsch. Es ist erstaunlich, mit welcher Unbefangenheit man immer wieder deutsche Sonderwege beschreitet. Hat so ein deutscher Sonderweg historisch eigentlich schon mal Erfolg gehabt?
Harald Martenstein, Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Optimistische Kolumnen. C. Bertelsmann, Hardcover mit Schutzumschlag, 224 Seiten, 18,00 €
Empfohlen von Tichys Einblick. Erhältlich im Tichys Einblick Shop >>>





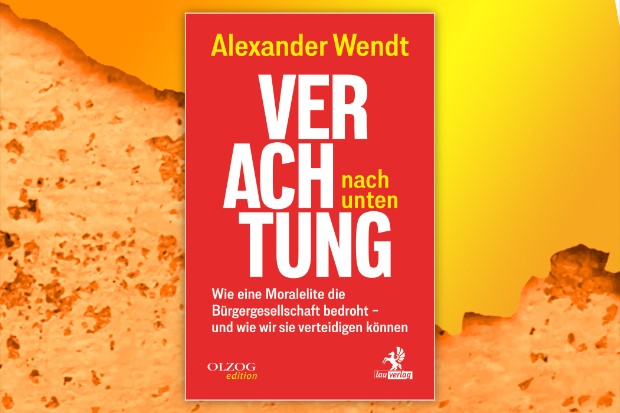

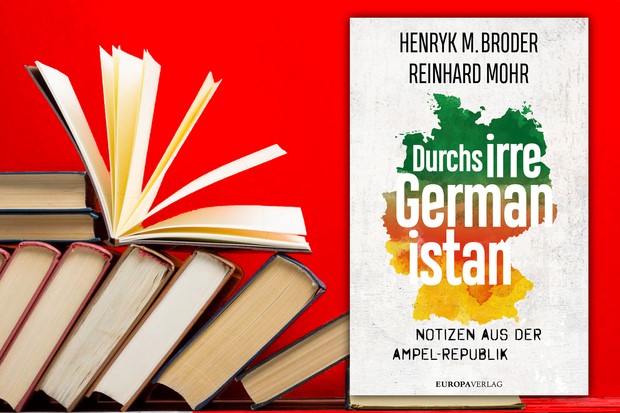



























Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
Ein interessantes Gespräch von zwei klugen Autoren, die ich beide sehr gerne lese. An einer Stelle hätte ich mir allerdings gewünscht, dass Wendt einmal nachhakt. Martenstein sagt: „Dort, bei Springer, herrscht für mich, nach meinen Erfahrungen der letzten Jahre, ein geradezu unbegreiflich offenes Meinungsklima.“
Wie passt das zu der Tatsache, dass Springer-Vorstandsvorsitzender Mathias Döpfner die Welt-Redakteure, die über den Aufruf „Schluss mit der Falschberichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“ zum Thema Transsexualität berichtet hatten, umgehend desavouiert hat? Zugleich hat Döpfner „einen besonders tiefen Kotau vor den Transfunktionären gemacht“ und jedem Kritiker dieser Haltung das Recht abgesprochen, sich im Springer-Verlag zu äußern.
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/das-jugendprogramm-des-oerr-als-dauerwerbesendung-fuer-geschlechtsumwandlungen/amp
Tja, sich durchwursteln, irgendwie halt, nur keine Stellung beziehen. „Irgendwie halt“ kann man die freie, offene Rede nicht retten.
Herr Martenstein ist einer der Vertreter aus dem liberalen/ bürgerlichen Lager, für die ein bekannter, hier leicht abgewandelter Werbespruch zutrifft:
Wenn bei dir die grün/ sozialistischen Widersacher zu stark sind, dann bist du zu schwach.
„Denn man sagt sich ja als Liberaler: So wie die willst du nicht werden. So willst du nicht sein. Ich möchte nicht, dass woke Leute keine Kommentare mehr schreiben dürfen. Ich würde die nicht aus Redaktionen rausdrängen wollen. Ich würde sie nicht zwingen wollen, gegen ihre Überzeugung irgendwas zu schreiben. Ich möchte niemanden unterdrücken. Ich möchte also nicht so werden wie die. Diese Tatsache, dass viele von uns, von den Liberalen, nicht so werden wollen wie die, ist deren Waffe.“ Sehr interessant, dass Herr Martenstein so reflektiert ist. Richtig, diese hoffnungsvolle Gemütlichkeit, wie ich sie nenne, ist der Grund, weshalb… Mehr
Man sollte Leute wie Martenstein, Fleischhauer oder Don Alphonso nicht überfordern. Es sind Kolumnisten, deren Aufgabe es ist, Denk- und Meinungskorridore offen zu halten und mit Humor und intellektueller Qualität ideologischen Schwachsinn zu demaskieren. Nicht mehr und nicht weniger…
Ein Highlight im deutschen Medienmüll: Ein kluger Journalist interviewt einen anderen klugen Journalisten und beide stellen nicht die Selbstdarstellung in den Vordergrund, sondern spielen sich Themen zu, die sie ohne dogmatische Scheuklappen analysieren, erkennbar persönlich kommentieren und einfach unverkrampft anfassen. Allein dafür nehme ich wieder ein Jahresabo.
Ist schon spät, will mir aber die Mühe noch machen. Als ehemaliger Zeitabbonent ist mir Harald Martenstein ein Begriff. Das erste was ich nach der Neuausgabe aufgeschlagen habe, war die wöchentliche Kolumne die im Zeitmagazin veröffentlicht wurde, und die mich immer wieder zum Schmunzeln brachte, gewissermaßen ein geistiger Spiegel, der mir sehr erleichtert hat mich besser zu erkennen. Harald schwamm da in den letzten Monaten auch schon nicht stromlinienförmig im Mainstream der Medien, in denen ich die Zeit noch bezog, obwohl seine journalistischen Beiträge gerade jene waren, die mich mein Abonnement nicht schon früher kündigen ließen. Er hat eine bedondere… Mehr