Sieht man sich die linke und linksliberale Reaktion auf Immigrationskritik in Deutschland oder auf das Brexit-Votum in England näher an, dann liegt Autor Guilluy mit der Vermutung, dass die Eliten eine gelenkte Demokratie dem jetzigen System vorziehen würden, wohl nicht ganz falsch.

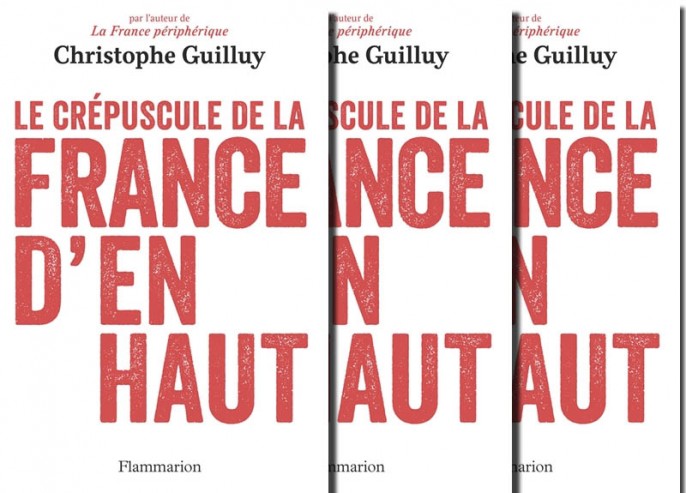
Christoph Guilluy ist in Deutschland anders als in seinem Heimatland kein sonderlich bekannter Autor, das sollte sich jedoch ändern, wenn wir unsere eigene Gesellschaft verstehen wollen, denn die Probleme des heutigen Frankreich werden womöglich auch die deutschen Probleme der Zukunft sein.
Guilluy (Jahrgang 1964) ist von Haus aus Sozialgeograph, gehört also einer Disziplin an, die in Frankreich anders als bei uns in den Geistes- und Sozialwissenschaften von jeher her eine prominente Rolle gespielte hat. Er ist in den letzten Jahren vor allem durch zwei Bücher hervorgetreten: Fractures françaises (2010) und La France périphérique: comment on a sacrifié les classes populaires (2014). Sein großes Thema ist das Frankreich der kleinen Leute, der unteren Mittelschicht, der Arbeiter oder gar der Arbeitslosen, die außerhalb der großen Metropolen leben, eben an der Peripherie des Landes, wo es wenig Arbeitsplätze gibt und die Chancen des sozialen Aufstiegs sehr begrenzt sind, gewissermaßen in der wirtschaftlichen Wüste. Es ist dieses Frankreich der Peripherie, das sich in den vergangenen Jahre immer mehr von den etablierten Parteien abgewandt hat. Die Wähler in der Provinz, soweit sie der von Guilluy beschriebenen einheimischen Unterschicht angehören, sind entweder gar nicht mehr zur Wahl gegangen, oder habe ihre Stimme dem Front National gegeben, der namentlich bei Regionalwahlen auch in jüngster Zeit erstaunliche Erfolge erzielt hat.
Dieses Thema der inneren Spaltung des Grande Nation hat Guilluy in seinem Werk über den Zerfall des Frankreichs der Eliten wieder aufgenommen, zum Teil auch um sich gegen die Kritik, die an seinen früheren Thesen von allem von Seiten der politischen Linken geübt wurde, zu verteidigen. Was sind seine entscheidenden Thesen und wie relevant sind sie für den Rest Europas, nicht nur für Frankreich?
Guilluy als Globalisierungskritiker
Zunächst ist Guilluy, hier durchaus in der Tradition der klassischen französischen Linken argumentierend, ein scharfer Globalisierungskritiker. Er sieht das französische Staatsmodell, zu dem eine Republik, in der es nur Staatsbürger und keine separaten ethnischen oder religiösen Gruppen mit Anspruch auf Autonomie gibt, genauso gehört wie ein funktionsfähiger Sozialstaat, durch die Globalisierung und durch eine Politik der offenen Märkte und der offenen Grenzen massiv gefährdet. Frankreich hat aus seiner Sicht in den letzten Jahrzehnten das republikanische Modell, das einen starken Sozialstaat bot, aber über die Schulen auch einen kulturell homogenen Bürgerverband schaffen wollte, längst aufgegeben. An seine Stelle ist eine amerikanisierte multikulturelle Gesellschaft getreten. Der große Verlierer dieses Prozesses ist die einheimische Unterschicht, ihre Arbeit ist zu teuer, sie beansprucht zu nachdrücklich den Schutz des Sozialstaates, deshalb werde sie zunehmend durch Immigranten ersetzt, die ein Reserveheer an Angestellten und Arbeitern darstellten, das man auch zur radikalen Liberalisierung des Arbeitsmarktes einsetzen könne. Und am Ende könne die neue Bourgeoisie ja immer noch ein gutes Gewissen haben, wenn sie einer Putzhilfe ein minimales Gehalt zahle, weil das dann eine Art Entwicklungshilfe für die ganz Armen sei.
Solche Thesen mögen einerseits polemisch überspitzt anmuten, andererseits auch wiederum ein wenig allzu vertraut wirken. Allerdings, Guilluy wäre nicht der solide Wissenschaftler, der er ist, wenn er sie nicht durch neue Erkenntnisse untermauern könnte. Er verweist vor allem auf den Wandel der großen französischen und europäischen Metropolen in den vergangenen Jahren, zu denen Paris ebenso gehört wie London. In diesen Metropolen lässt sich zunehmend ein Exodus der einheimischen unteren Mittelschicht und Unterschicht feststellen, der „classes populaires“. Einerseits sind die Immobilienpreise und Mieten so rasant gestiegen, dass sich in leidlich akzeptablen und sicheren Wohnvierteln nur noch recht wohlhabende Angestellte und Selbständige halten können (eine Entwicklung, die zur Zeit gerade auf Deutschland übergreift auch dank der Draghischen Geldschwemme, die zu einer Flucht in die Sachwerte führt), andererseits dominieren jetzt in den preiswerten Sozialwohnungen und billigeren Vorstädten die Familien von Einwanderern, oft nicht-europäischer Herkunft.
Durch die Immigranten fühlt sich die weiße untere Mittelschicht und Unterschicht marginalisiert, zum Teil auch bedroht, ob nun zu Recht oder zu Unrecht, das sei dahingestellt. Jedenfalls lehnt man es ab, zur bestenfalls geduldeten ethnischen Minderheit im vormals eigenen Wohnviertel zu werden und verlässt daher die Metropolen ganz. Eine solche Flucht der ärmeren Europäer („White Flight)“ lasse sich für das Jahrzehnt zwischen 2001 und 2011 z. B. für London durchaus im Umfang von mehr als 600.000 Personen belegen, wie Guilluy schreibt (101). Briten europäischer Herkunft sind damit, wie Guilluy betont, in London sogar zur Minderheit geworden (45 % der Gesamtbevölkerung im Jahr 2011 statt 58 % 10 Jahre zuvor – hier spielt natürlich auch die starke Zuwanderung von Immigranten eine Rolle), viele haben sich ganz an die Peripherie im weiteren Umkreis der Metropole oder sogar in andere Regionen zurückgezogen, wo sie aber zum Teil von den wirtschaftlichen Chancen, die das boomende London bietet, abgeschnitten sind. Für Paris lässt sich Ähnliches konstatieren.
Die soziale Schicht, die von Globalisierung und Masseneinwanderung hingegen per saldo profitiert und diese Entwicklungen daher auch lautstark begrüßt und unterstützt, ist ein kulturell liberales oder sogar dezidiert linksliberales neues Bürgertum; es sind, wie man sie in Frankreich nennt, die bourgeois bohèmiens, oder kurz bobos. Offiziell bekennt man sich zum Evangelium der multikulturellen Gesellschaft und brandmarkt jeden, der sich dieser Botschaft entgegenstellt, als Faschisten oder Rassisten, aber wenn es um das alltägliche Leben geht, sorgt man eben doch dafür, dass die eigenen Kinder nicht auf einer Schule landen, in der zu viele Schüler aus armen und wenig gebildeten Migrantenfamilien stammen, und entsprechend sucht man sich auch das eigene Wohnviertel aus. Dieser Vorwurf der Heuchelei ist nicht neu und wird von den Betroffenen sicherlich empört zurückgewiesen, dass er aber zumindest einen wichtigen Teilaspekt der Realität trifft, wird man nicht bezweifeln können.
Ethnische Identität als soziales Kapital
Wichtiger ist aber eine andere Beobachtung, die Guilluy macht. Er verweist auf die zunehmende Bedeutung ethnischer und religiöser Identitäten, aber auch der Bindung an den Herkunftsort (Stadt, Dorf, Region) in einer Gesellschaft hin, die ihren Bürgern nicht mehr jene wirtschaftliche Sicherheit zu geben vermag wie in der Epoche vor der Globalisierung, als der souveräne Nationalstaat als Sozialstaat zumindest in Frankreich noch unangefochten war. Sowohl die Migranten als auch – und das ist neu – die Einheimischen haben das Gefühl, in einer globalisierten Gesellschaft mehr auf eine Gruppensolidarität, die durch Herkunft, Kultur, Religion und Verwandtschaft begründet wird, setzen zu müssen als auf den Staat oder eine Bürgergesellschaft, in der politische Partizipation über die Parteien organisiert wird. Guilluy spricht in diesem Kontext von „empowerment identitaire“ (208). Definiert man sich nachdrücklich als Mitglied einer ethnischen oder kulturellen Gruppe, kann man einerseits die Solidaritäts- und Patronagenetzwerke dieser Gruppe für sich in Anspruch nehmen, zum anderen aber im Kollektiv auch Forderungen durchsetzen, die sonst ungehört verhallen würden. Immigranten haben immer schon bis zu einem gewissen Grade Sicherheit in solchen Netzwerken gesucht, jedenfalls in typischen Einwanderergesellschaften wie den USA, neu ist aber nach Guilluy, dass nun auch die Einheimischen, soweit sie eher der Unterschicht angehören, Zuflucht in solchen Identitäten suchen, um damit in einer als feindlich oder zumindest als unberechenbar empfundenen Umgebung soziales und kulturelles Kapital für sich zu mobilisieren.
Wir haben es gewissermaßen mit einem Prozess der Tribalisierung der „petits blancs“, der armen Weißen, zu tun. Dieser Prozess verbindet sich, wie empirische Studien gezeigt haben, mit einer zunehmenden Tendenz zur endogamen Ehe innerhalb der jeweiligen religiösen und kulturellen Gruppen. Das gilt in Frankreich nicht nur für Muslime, sondern auch für Juden und Katholiken, wobei die Juden in Frankreich bekanntlich auch eine besonders starke Tendenz aufweisen, Kontakte mit arabischen Einwanderern entweder durch den Umzug in andere, rein „weiße“ Stadtviertel oder durch die Auswanderung nach Israel ganz zu vermeiden, eine nachvollziehbare Reaktion auf den offenen Antisemitismus vieler Immigranten. Die einstmals kulturell stärker homogene Gesellschaft segregiert sich also nach religiösen und ethnischen Kriterien, man fühlt sich nur noch unter Seinesgleichen sicher, allen anderen misstraut man. Wie Guilluy in einem Interview mit Le Point (21/09/2016) festgestellt hat, sucht selbst das in den letzten Jahrzehnten entstandene Kleinbürgertum maghrebinischer Herkunft in den Vorstädten zu den mittlerweile zahlreichen Neu-Ankömmlingen aus Schwarzafrika einen Sicherheitsabstand zu wahren.
Dass Wähler, die sich so stark über ethnische Identität oder auch die Religion definieren, den etablierten französischen Parteien nicht mehr viel abgewinnen können, überrascht dann auch nicht mehr. In Frankreich wählen die abgehängten weißen „classes populaires“ überproportional stark den Front National, soweit sie überhaupt noch zur Wahl gehen, denn eigentlich erwartet man nichts mehr vom „System“ und vom Staat. Diese Sympathie für den FN findet man übrigens, wie Guilluy hervorhebt, nicht nur bei armen Franzosen ohne Migrationshintergrund, sondern noch stärker bei Immigranten aus anderen europäischen Ländern wie Italien, Spanien oder Portugal. Offenbar fühlen sich diese Immigranten subjektiv besonders stark durch die Konkurrenten aus der arabischen Welt oder Afrika bedroht. Entsprechende Beobachtungen könnte man in Deutschland vermutlich bei Einwanderern und ihren Nachkommen aus Südosteuropa und Russland machen.
Das Verschwinden der sozialen Frage im öffentlichen Diskurs und die „marronage“ der Abgehängten
Die bobos reagieren auf diesen Protest freilich, indem sie die von Guilluy angesprochenen Probleme einfach für nicht-existent erklären. Für die heutige Linke aber auch für Linksliberale steht, so Guilluy, immer und überall die wirkliche oder vermeintliche Diskriminierung von nicht-europäischen Immigranten im Vordergrund. Dass es auch darüber hinaus eine soziale Frage geben könnte, die sich nicht erschöpft in den Problemen der Vorstädte der Metropolen (Arbeitslosigkeit und Armut, mangelnde Bildung, aber in Wirklichkeit auch Aufstiegschancen, die man in der französischen Provinz nicht hat) wird schlechterdings ausgeblendet, davon zu sprechen ist politisch nicht korrekt. Die Spannungen zwischen den sozialen Klassen werden von der neuen Bourgeoisie bewusst weggeredet und verschleiert, indem man sie ethnisiert („Elle [la bourgeoisie] brouille les rapports de classe en les ethnicisant“, S. 145).
Auf Dauer droht damit freilich eine immer stärkere Eskalation ethnischer Konflikte, das liegt auf der Hand und kann man in der Realität in Frankreich ja auch zur Genüge erkennen. Eine Lösung für diese Probleme bietet Guilluy freilich nicht an. Primär ist sein Buch ein Misstrauensvotum, das sich gegen die etablierten Eliten und ihre Diskurse richtet. Er unterstellt ihnen sogar den geheimen Wunsch, ein neues Mehrklassenwahlrecht einführen zu wollen, das die städtischen, akademisch gebildeten Oberschichten privilegieren würde, während etwa der auf dem Lande lebende Rentner dann gar nicht mehr wählen dürfte. Das ist natürlich eine überzeichnende Darstellung, aber wenn man sich die linke oder linksliberale Reaktion auf Immigrationskritik in Deutschland oder auf das Brexit-Votum in England näher ansieht, dann liegt Guilluy mit seiner Vermutung, dass die Eliten eine gelenkte Demokratie dem jetzigen System eigentlich vorziehen würden, wohl doch nicht so ganz falsch. Und an dieser Stelle wird auch deutlich, dass seine Analyse nicht nur für Frankreich relevant ist, auch wenn die starke De-Industrialisierung des Landes in den letzten 20 Jahren und die enorme politische und kulturelle Zentralisierung die Peripherie hier besonders stark hat absinken lassen. Aber Ähnliches kann man letztlich auch in England beobachten, und der Aufstand der einheimischen unteren Mittelschicht und Arbeiter ist ja dann auch dort nicht ausgeblieben, wie das Votum gegen die EU vor einigen Monaten überdeutlich gezeigt hat.
Ein Blick über Frankreich hinaus
In Deutschland scheinen die Verhältnisse anders zu sein. Die Wirtschaft floriert, eine massive Deindustrialisierung hat es nie gegeben, außer vielleicht in den neuen Bundesländern, die ein wenig der französischen Peripherie oder Nordengland ähneln, die Steuereinnahmen sprudeln und die Arbeitslosigkeit ist niedrig. Indes, die weitgehende Entfremdung großer Teile der einheimischen Bevölkerung von den politischen und gesellschaftlichen Eliten ist durchaus auch in Deutschland zu beobachten und manifestiert sich spätesten seit der Massenimmigrationswelle von 2015/16 auch in einem entsprechenden Protest, für den der Aufstieg der AfD, aber auch von Bewegungen wie Pegida stehen. So verfahren wie in Frankreich, wo es auch eine lange Tradition der Revolte gegen den Staat gibt, mag die Lage hier noch nicht sein, aber wie dort glauben die liberalen oder linken Eliten – in England würde man von den „chattering classes“ sprechen – den Protest der „Abgehängten“ weitgehend ignorieren zu können, und unternehmen auch immer wieder Versuche, durch Diskussionsverbote bestimmte Probleme einfach unsichtbar zu machen.
Von daher sind die Thesen von Guilluy auch für Deutschland durchaus relevant. Jenseits seiner zum Teil berechtigten, in manchen Aspekten aber vielleicht auch überspitzten Kritik an den egozentrischen und selbstgefälligen bobos der Metropolen (in Deutschland wäre das vor allem das Milieu, in dem die Grünen ihre Wähler rekrutieren) ist aber vor allem eine Erkenntnis wichtig: Wenn Menschen sich in der heutigen Gesellschaft stark über ihre ethnischen oder religiöse Identität definieren, stärker jedenfalls als vor zwei oder drei Jahrzehnten, dann ist das eben nicht einfach ein Zeichen für den wachsenden Einfluss des religiösen Fanatismus auf der einen und einer intoleranten Fremdenfeindlichkeit auf der anderen Seite, nein es handelt sich zumindest zum Teil um durchaus zweckrationale Strategien der sozialen Selbstbehauptung, denn Identität ist hier ein kulturelles und soziales Kapital, das einem den Zugang zu wertvollen Netzwerken der Solidarität sichert. Gerade in Zeiten der wirtschaftlichen Unsicherheit, in denen sich zudem der Nationalstaat zunehmend auflöst, und von seinen eigenen Eliten abgeschrieben worden ist, kann man auf diese Form der Solidarität kaum verzichten, wenn man nicht zu den wirklich Wohlhabenden oder zu einer beruflich sehr flexiblen kosmopolitischen Elite gehört. Man braucht die Netzwerke der Moscheegemeinde oder den Freundeskreis in der heimischen Kleinstadt, um sich abzusichern, und zögert auch die gewohnte Umgebung zu verlassen, weil man dann auf sich gestellt ist, es gibt also, wie Guilluy zeigt, eine Tendenz zur abnehmenden Mobilität der einheimischen Bevölkerung der kleineren Städte und des ländlichen Raumes.
Wie freilich soll der Staat auf Dauer mit einer Gesellschaft umgehen, die zunehmend von einer umfassenden Kultur des Misstrauens gegenüber anderen ethnischen Gruppen und einer „Paranoia der Identität“ – ein Begriff den Guilluy in einem Interview verwandt hat – geprägt ist? In Amerika, das sich freilich auch in keinem guten Zustand befindet, mag es als Gegengewicht einen missionarischen Patriotismus, der immer noch die ganze Welt auf das Vorbild der USA ausrichten will, geben, Ähnliches fehlt in Europa weitgehend, selbst in Frankreich, wo es einmal verwandte Traditionen gab. Zunehmende ethnisch-religiöse Konflikte und zwar nicht nur zwischen Einheimischen und Immigranten. sondern auch zwischen unterschiedlichen Gruppen von Einwanderern scheinen damit unausweichlich zu sein. Immerhin wäre es vielleicht schon ein Gewinn, würfen die Eliten sich diesem Problem stellen, statt es einfach nur durch den hegemonialen Diskurs der heiß ersehnten Vielfalt und multikulturellen Buntheit für inexistent zu erklären. Spätestens seit dem Brexit-Votum in England wäre es Zeit gewesen aufzuwachen, statt nur laute Klagen über diesen „Bauernaufstand“ der Kleinbürger und vermeintlich rassistischen Proleten anzustimmen. Leider scheint jedoch der ideologische Schlummer der bourgeois bohèmiens durch nichts zu stören zu sein, das gilt für Deutschland genauso wie für Frankreich oder England.
Ronald G. Asch ist Historiker und lehrt an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
Christophe Guilluy, Le crépuscule de la France d’en haut, Paris, Flammarion 2016, 254 S.


























Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
[…] Christophe Guilluy : […]
Bis 2014 dachte ich noch dass unser Land großes Potential habe, und nur die bleierne Merkel-Ära zu Ende gehen müsse, um soziokulturell einen Schritt voran zu machen. Die soziale Frage, HartzIV, Abbau von Arbeit durch Digitalisierung, usw.. verlangen nach einer mutigen Antwort im Konsens aller Gruppen. Vielleicht durch ein „Grundeinkommen“. Ich wunderte mich nur dass die angeblich Linken, auch in den Medien, sich dafür so wenig einsetzen. 2015 war das alles dann schlagartig vorbei, statt eines Schritts hin zu einer nachhaltig humanen und gerechten Industrie-Gesellschaft sollte aus Sicht der deutschen Bobos nun die „bunte Republik“ geschaffen werden. Da explodierte deren… Mehr