Atomausstieg und Energiewende – die politischen Entscheidungen dazu waren von Emotionen statt sachlichen Argumenten geprägt. Doch die volkswirtschaftlichen Folgen sind nicht mehr zu übersehen: Industrie und Verbraucher leiden massiv, die Abwärtsspirale beschleunigt sich. Ist diese Entwicklung noch aufzuhalten?

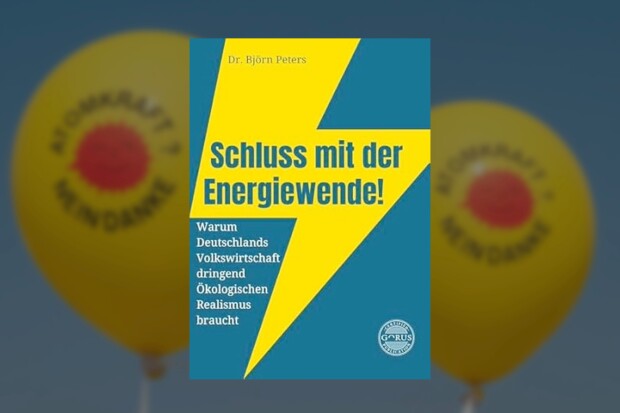
Der menschliche Blick auf die Natur und ihre Ressourcen ist (…) durch problematische Narrative verstellt. Diese haben sich seit der Aufklärung herausgebildet: So behauptete Jean-Jacques Rousseau, es existiere ein „Gleichgewicht“ in der Natur, das der Mensch nur stören könne. Und seit den Schriften des Nationalökonoms Thomas Malthus aus dem 18. Jahrhundert gilt als gesetzt, dass Rohstoffe endlich sind und die Menschheit auf eine Hungerkrise zusteuert, sobald mehr als eine Milliarde Menschen den Planeten bevölkern.
Ganze Ideologien sind aus dem Mythos der Knappheit heraus entstanden, unter anderem alle Spielarten des Sozialismus und des National-Sozialismus. Selbst im Jahr 1974 noch folgten Dennis Meadows und sein Team im Bericht des Club of Rome dieser alten Idee der Knappheit. Und 2022 rechnete die taz-Journalistin Ulrike Herrmann in ihrem Buch „Das Ende des Kapitalismus“ vor, dass Klimaschutz nur durch radikalen Verzicht zu erreichen ist. Als notwendige Folge von Klimapolitik stellt sie indirekt Großbritanniens Kriegswirtschaft, wirtschaftlichen Niedergang und Totalitarismus dar. (…)
Mit besonders vielen irreführenden Erzählungen ist die Kerntechnik behaftet. Das ist fatal, denn die Welt wird diese Technik brauchen: Wenn die fossilen Energieträger irgendwann zur Neige gehen, die Umgebungsenergien aber strukturell ungeeignet sind, eine moderne Zivilisation aufrechtzuerhalten, bleibt keine Alternative. Andere Energiequellen lässt die Physik nicht zu. (…)
Ressourcen: Knappheit oder Fülle?
Im Bericht des Club of Rome im Jahr 1974 rechnete das Team um Dennis Meadows vor, wie lange die wichtigsten Rohstoffe reichen sollten: Demzufolge hätten praktisch alle Rohstoffe bis zum Jahr 2000 schon zur Neige gegangen, die Menschheit in Kriegen um die letzten Rohstoffe verwickelt, unser Lebensstandard drastisch gesunken und die Biosphäre kollabiert sein müssen.
Nichts davon ist eingetreten, daher stellt sich die Frage, warum die Vorhersagen der Autoren so dramatisch danebenlagen. (…)
Es gibt drei Hierarchiestufen von Ressourcen:
• Die erste Stufe sind natürliche Ressourcen. Wind, Sand, Wellen, Felsen, Bäume, selbst Blütenduft im Frühling und Wolken sind natürliche Ressourcen. Welche dieser natürlichen Ressourcen tatsächlich vom Menschen genutzt werden können, ist eine Frage nach den Technologien für ihre Ausbeutung.
• Diese nutzbaren Ressourcen werden als technische Ressourcen bezeichnet. So wurde Sonnenlicht erst durch Einsteins Entdeckung des photoelektrischen Effekts energetisch verwertbar. Schon in der Antike kannte man ölige Schlammschichten in den Wüsten Arabiens, aber erst mit der Erfindung der Petroleumlampe wurden Ölschlämme nützlich, und erst durch die Erfindung des Verbrennungsmotors, der Bohr- und Pumptechniken, der Tankschiffe und Pipelines wurde Öl zu einem so zentralen Rohstoff, wie er es heute ist. Wasser- und Windkraft können seit mehreren Jahrtausenden genutzt werden, Wellenkraft erst seit kurzem.
• Ob aber eine technisch zugängliche Ressource auch genutzt wird, entscheidet sich über die Kosten, eine Einheit von ihr zu produzieren, im Verhältnis zum wirtschaftlichen Nutzen. Daher ist die wichtigste Kategorie die der wirtschaftlichen Ressourcen. Die gesellschaftliche Debatte um Rohstoffe kreist fast ausschließlich um diese Kategorie.
Welche technischen Ressourcen zu den wirtschaftlichen Ressourcen zählen, ändert sich mit der Zeit.
Beim Erdöl fragen beispielsweise viele Nachhaltigkeitsforscher verwundert, warum Ölförderer immer höhere Bestände ausweisen können, obwohl kaum neue Ölfelder gefunden wurden. Der Grund ist einfach, aber kaum bekannt: Die Grundgesamtheit an Erdöl, das in einem Ölfeld steckt, wird „Original Oil in Place“, kurz OOIP genannt. Von diesem konnten vor einem halben Jahrhundert nur ein kleiner Anteil – typischerweise zehn Prozent – gefördert werden. Dabei handelte es sich um die Menge, die durch Eigendruck nach oben strömte. Seither wurden etliche Verfahren der „Enhanced Oil Recovery“ (EOR) entwickelt, um mehr Öl aus den Lagerstätten zu fördern, wie das Verpressen von CO2 und Wasser in den Boden. Dar-über hinaus helfen bessere bildgebende Verfahren dabei, die exakte Lage der Ölblasen zu erkennen und punktgenauere Bohrungen zu verbringen. Techniken zum horizontalen Bohren erleichtern den Zugang. Mit diesen EOR-Technologien ist es heute möglich, über 30 Prozent des OOIP zu fördern.
Was an Rohöl in der Lagerstätte dann noch verbleibt, sind zähflüssiger Öle. Um auch diese fördern zu können, werden derzeit Technologien entwickelt, um im Boden die langkettigen Ölmoleküle aufzubrechen, die Masse dünnflüssiger zu machen und nach oben pumpen zu können. Diese Verfahren nennen sich „in-situ-Cracking“ und sollen helfen, bis zu 75% des OOIP zu fördern. Würde diese realisiert, stiegen die Welt-Ölvorräte auf mehr als das Doppelte der Ölmenge an, die bis dato gefördert werden kann.
Wie lange reichen Ressourcen?
Die Reichweite der meisten Rohstoffe wurde im Bericht des Club of Rome mit etwa zwei bis drei Jahrzehnten angegeben. Diese Schätzung beruht jedoch auf Zahlen, die dafür nicht geeignet sind. Diese Zahlen werden primär ermittelt, um betriebswirtschaftliche Aussagen zu treffen.
Die wirtschaftliche Messung
Der Grund ist, dass die meisten rohstoffproduzierenden Unternehmen Gewinne erwirtschaften müssen. Sie erwirtschaften diese Gewinne, indem sie Rohstoffe zu bestimmten Kosten aus der Erde holen und zu einem Marktpreis verkaufen. Dieser Marktwert muss im Mittel höher liegen als die durchschnittlichen Produktionskosten. Er schwankt jedoch je nach Nachfrage und ist für Rohstoffunternehmen ein wenig beeinflussbarer Faktor ihres Geschäfts.
Die Kosten für die Rohstoffproduktion dagegen hängen beträchtlich von den Energiepreisen ab. Und da bei einem Großteil der Abläufe in einem Rohstoffunternehmen die Ingenieure kontinuierlich hinzulernen, wie sie ihre Abläufe effizienter und effektiver organisieren, sparen sie Geld ein.
Daher sinken Kosten und Preise für Rohstoffe inflationsbereinigt und im langjährigen Mittel eher, als dass sie steigen.
Die rohstoffproduzierenden Unternehmen müssen ihre Produktion für einige Jahre im Voraus sichern. Dazu erkunden sie potenzielle Lagerstätten für einen prospektiven Zeitraum von 15 bis 30 Jahren. Sie führen darüber genauestens Buch, da die abbaubaren Reserven ein wichtiger Vermögenswert sind, der für Aktienanalysten und Bilanzprüfer eine wichtige Größe darstellt. Es gibt daher präzise Vorschriften, die international in guter Übereinstimmung festlegen, welche Art von Reserven in Statistiken und Bilanzen aufgenommen werden können.
Abbaubare Ressourcen werden nur gemäß ihres wirtschaftlichen Potenzials erfasst.
Weniger gut zugänglich sind „Bestimmbare Ressourcen“ (engl. „indicated resources“). Bei diesen wurden einige geologische Kenntnisse erworben, die Lagerstätten sind aber noch nicht in ihrer gesamten Ausdehnung, Qualität und Größe bekannt. Dennoch bestehen beispielsweise aus Probebohrungen hinreichend viele Erkenntnisse, um einen Geschäftsplan und einen Projektplan für die Erschließung des Rohstoffes aufstellen zu können, die plausible Schätzungen für die Methoden und Kosten des Abbaus und die eingelagerten Mengen enthalten.
Die dritte und letzte Kategorie ist die der „Vermuteten Ressourcen“ (engl. „inferred resources“). Hier kann aufgrund von geologischen Analogien abgeleitet werden, dass in einer Lagerstätte Rohstoffe einer bestimmten Mindestmenge lagern. Außerdem kann für die Konzentration des Rohstoffs im Erdreich bzw. Gestein eine Bandbreite angegeben werden. Weil jedoch wenig Exaktes über diese Reserven bekannt ist, dürfen vermutete Reserven nicht in die Statistiken der rohstoffproduzierenden Unternehmen einfließen. Sie spielen aber eine wichtige Rolle bei der langfristigen Sicherung der abbaubaren Minerale eines rohstoffproduzierenden Unternehmens.
Welche Lagerstätten zu welcher Kategorie zählen, hängt auch vom Preis für die Rohstoffe ab. Sinkt der Preis drastisch, kann eine bestimmbare Ressource mit zu hohen Abbaukosten wieder zu einer vermuteten Ressource werden. Überhaupt sind es wirtschaftliche Kategorien, die darüber entscheiden, ob ein Mineral als Ressource angesehen wird oder nicht.
Nur gemessene und bestimmbare Ressourcen fließen in die Statistiken ein.
Dass sie selten für länger als 30 Jahre reichen, ist einfach zu erklären.
Der wirtschaftliche Zeithorizont
Aktienanalysten sind zufrieden, wenn die Reserven eines rohstoffproduzierenden Unternehmens für länger als 15 Jahre reichen. Würde der Vorstandsvorsitzende eines solchen Unternehmens dennoch für beispielsweise 50 Jahresproduktionen Minerale erkunden lassen, geriete er in Schwierigkeiten. Er würde nicht nur wegen übermäßiger Explorationskosten angegriffen werden. Explorationsmethoden verbilligen sich dank technischen Fortschritts über die Jahre deutlich. Daher wäre es wirtschaftlich unklug, sich mehr als 25 Jahresproduktionen im Voraus zu sichern.
Die statistisch erfassten Reserven der Rohstoffunternehmen reichen daher seit Jahrzehnten nur für die nächsten 25 bis 30 Jahre.
Ressourcen werden nie ausgehen. Sie werden mal knapper und teurer (und dann vielleicht substituiert werden), mal billiger und besser verfügbar, aber der einzige Faktor, der die Verfügbarkeit von Ressourcen begrenzt, ist der menschliche Geist.
Ist nachhaltiges Wirtschaften überhaupt nötig?
Ein wichtiges Narrativ im Zusammenhang mit natürlichen Ressourcen ist, dass mit ihnen „nachhaltig“ umgegangen werden solle. Dies trifft aber nur für kurze Zeiträume zu, für längere ist der Anspruch geradezu unsinnig.
So war Salz vor tausend Jahren ein knappes Gut. Die frühen Salzlagerstätten wie Bad Hallein, Salzgitter, das Salzkammergut in Österreich wurden zunächst extrem reich, solange Salz kostbar war. Heute schüttet man es im Winter tonnenweise auf die Straße.
Aus Eibenholz wurden die Langbögen gefertigt, die im 14. Jahrhundert die militärische Überlegenheit der britischen Krone begründeten. Eiben benötigen 250 Jahre, um auf die nötige Größe zu wachsen. Dementsprechend stellte die englische Krone um das Jahr 1400 Eibenplantagen unter ihren Schutz. Als die so geschützten Bäume erntereif wurden, hatten aber längst Feuerwaffen die Langbögen in ihrer militärischen Bedeutung abgelöst.
Wer die Rolle von technischer Innovation versteht, braucht sich vor Rohstoffknappheit nicht zu fürchten.
Solange Menschen innovativ sind, werden sie für ihre Bedürfnisse Lösungen finden. Nachhaltigkeit bedeutet also nicht, den Status Quo und damit den Stand der Technik einzufrieren, und nur exakt so viel von einem Rohstoff zu verbrauchen, dass er anhand des existierenden Bedarfs „ewig“ hält. Späteren Generationen darf man zutrauen, mit technischer Kreativität Knappheiten aufzulösen.
Und was ist mit dem ökologischen Fußabdruck?
Was im Bergbau gelingen könnte, sollte Richtschnur für sämtliches Handeln des Menschen werden. Wer aus der Natur etwas entnimmt, sollte dies so umweltfreundlich wie möglich tun. Die Nachhaltigkeitsforschung hat hierzu einen Begriff eingeführt: den ökologischen Fußabdruck. Dieser schätzt die Belastung der Umwelt ab, die jeder von uns im Durchschnitt in Anspruch nimmt, und rechnet sie in ein Maß der Landnutzung um. Die Behauptung ist nun, dass der Mensch mehr und mehr Fläche in Anspruch nimmt.
Das Gegenteil ist der Fall.
Menschen, die steinzeitlich lebten, benötigten pro Kopf viele Quadratkilometer.
Seit der Jungsteinzeit sinkt die Fläche stetig, die zur Ernährung eines Menschen benötigt wird.
Dank immer besserer Landwirtschaftsmethoden und insbesondere der Erfindung des Kunstdüngers haben sich die Hektarerträge verzwanzigfacht.
Solch dynamische Entwicklungen verdankt die Menschheit ihrer Innovationskraft und dem technischen Fortschritt. Nichts von diesen dynamischen Betrachtungsweisen findet sich aber bei den Nachhaltigkeitsforschern und den Apologeten des Untergangs. Sie verkennen, dass neue Technologien nicht zum Produktivitätsfortschritt auf Kosten der Natur eingesetzt werden, sondern helfen, immer besser im Einklang mit der Natur und deren begrenzten Möglichkeiten zu leben.
Leicht gekürzter Auszug aus:
Dr. Björn Peters, Schluss mit der Energiewende. Warum Deutschlands Volkswirtschaft dringend Ökologischen Realismus braucht. Gorus Verlag, Hardcover mit Überzug, 144 Seiten, 25,00 €.
Mit Ihrem Einkauf im TE-Shop unterstützen Sie den unabhängigen Journalismus von Tichys Einblick! Dafür unseren herzlichen Dank!!>>>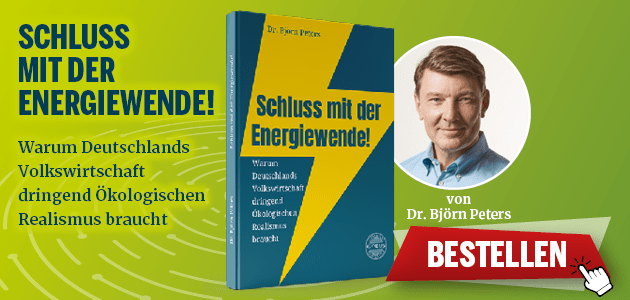




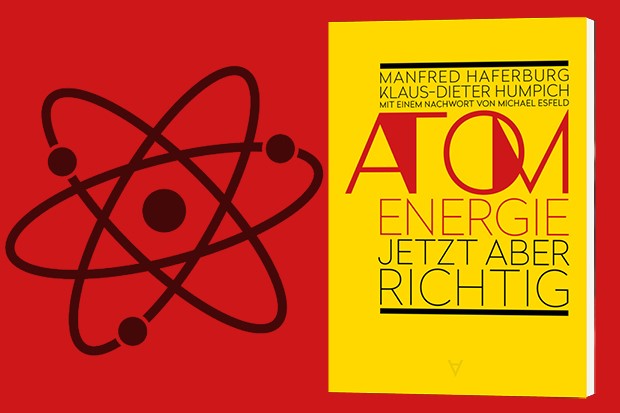
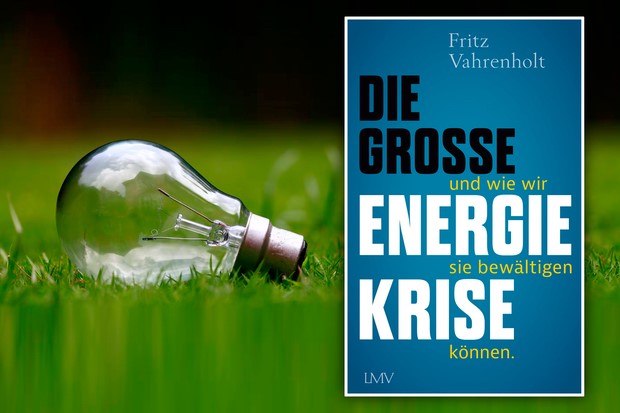




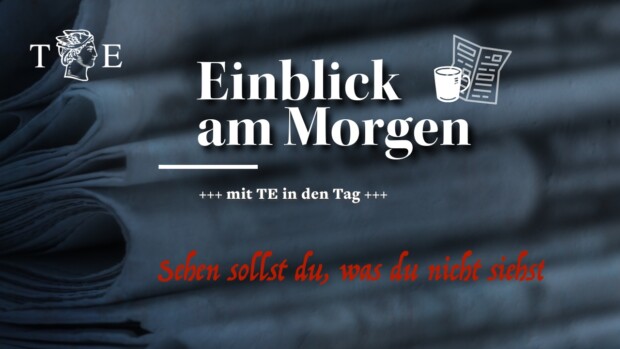



















Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
Im Universum gibt es keinen Stillstand und wir sind nur ein kleines Rädchen im Getriebe und alles ist ein Kommen und Gehen und wer im höheren Alter auf das Leben zurückblickt, wird feststellen, wie schnell die Zeit vergangen ist und so wie ständig konsumiert wird um das Leben auf Trab zu halten, so geht es für jeden zu Ende und der Gedanke an nachfolgende Generationen ist nur ein Hilfsmittel der Demagogen um das Märchen vom Verlust von Resourcen aufrecht zu erhalten, als ein hinterlistiges Druckmittel, den Leuten ein schlechtes Gewissen einzureden um sie auf ihre Seite der Unterdrückung zu führen.… Mehr
Neulich Marietta Slomka, die mit dem Silberblick in den „Tagesthemen“: Es kommen immer mehr „Klimaflüchtlinge“, die von dort weg müssen, weil WIR ihnen das Klima versaut haben. Mit unserer Industrie&so. So haben sie alles Recht, uns die Bude einzurennen und Ressourcen zu erheischen – die genau aus dieser Industrie kommen – infamer geht es kaum noch. Wir sollten die Industrie hier auf Null bringen, dann sind sie nicht mehr so affenscharf auf uns – für uns ist das billiger. Alle, die das nicht durchschauen, sollen blechen bis sie schwarz werden, geschieht ihnen recht. Da hüpft das Herz von Bude&Co, die… Mehr
Der Mensch als Krone der Schöpfung ist nicht „das Übel“, es ist lediglich seine viel zu große Zahl – also ein quantitatives Ding, kein qualitatives. Tendenz steigend: Echtzeit-Statistiken. Bevölkerungsuhr jeden Landes, auch beschleunigt durch Kinderheirat – Wikipedia und UNICEF prangert Kinderehen an – DW – 07.06.2019 und dies zeigt, dass man es weiß, aber nichts macht: Weltbevölkerungskonferenz: Neuer Anlauf für Frauenrechte – DW – 12.11.2019. Der Verständige setzt eigenen Nachwuchs nicht dem aus, was kommt bzw. schon da ist. Eine ganz neue Warnung hat ein Inder für uns: Weltbank-Chef Ajay Banga prognostizert weitere 800 Millionen Flüchtlinge – FOCUS online. Und… Mehr
Die meinen stets die anderen Menschen.
Sie wissen schon. Das sind die, die denen die Ressourcen stehlen, woraus sie doch selber so gerne Müll erzeugen.
Wir leben auf einem glühenden Feuerball mit durchschnittlich 1000 °C, das Problem ist: Wie da rankommen? Manchmal spuckt die Erde das aus, mit fast dieser Temperatur, als Lava. Energiequelle? Hauptsächlich die radioaktive Zerfallswärme, teils wohl auch Restwärme aus der Erdgeschichte. https://www.geothermie.de/geothermie/einstieg-in-die-geothermie
„Mit besonders vielen irreführenden Erzählungen ist die Kerntechnik behaftet. Das ist fatal, denn die Welt wird diese Technik brauchen: Wenn die fossilen Energieträger irgendwann zur Neige gehen, die Umgebungsenergien aber strukturell ungeeignet sind, eine moderne Zivilisation aufrechtzuerhalten, bleibt keine Alternative. Andere Energiequellen lässt die Physik nicht zu. (…)“. Also so bisschen Knappe gibt es wohl schon. Und wer soll euch die Kerne* machen, während vor allem der globale Süden nichts kann als Kindermachen? Dabei wäre alles so einfach: Weniger Kinder machen, so wie der globale Norden mit seinen 1.5-Kind-Frauen. It’s the demography, simply. Konkret: Wäre ich ein junger Mann, so… Mehr
> Industrie und Verbraucher leiden massiv, die Abwärtsspirale beschleunigt sich. Ist diese Entwicklung noch aufzuhalten?
Nicht wenn der Michel sich panische Angst vor CO2 und furzenden Kühen einreden lässt. Wirklich extrem suizidal.
Nichts ist unendlich (außer der Dummheit). Da Öl , Gas und Steinkohle mit großer Wahrscheinlichkeit aus dem Methan des Erdmantels in der heißen Biosphäre gebildet werden, sind die Mengen nicht abschätzbar. Sie haben mit „fossil“ wenig oder nichts zu tun.
Unsinn.
Welcher Ihrer Antworten ergäbe denn einen Sinn?
Ich frage für einen Freund.
Alle.
Könnten Sie bitte einen Link dazugeben. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Methan würden mich interessieren.
#metoo. Aber sage es gleich. Er hat nichts, weil … .
Erdgeschichtlich betrachtet gebe ich Ihnen recht.
Was die Entstehung betrifft, halte ich mich aber besser raus 😉
Methan sprudelt an den Rändern der Kontinentalplatten an sehr vielen Stellen
und sehr üppig.
Leider braucht man Habeck, Klingbeil, Merz, Söder et al nicht damit zu kommen. Denn die wissen das besser. Und im übrigen verbrennt der Globus wegen Klima, da müssen all die schönen fossilen und nuklearen Ressourcen im Boden bleiben. Ohne Zusammenbruch und Rausschmiss des Altparteienkartells wird es in D nichts mehr.
Headline!
Kein Märchen! Die Frage muss erweitert werden. … Recoucenmängel an Intellekt, mittlerweile Knowhow, innerer Antrieb, Finanzen also Liquidität und nicht zuletzt Kompetenzen.
Es gibt sicherlich noch mehr, muss aber hier nicht her.
Wenn diese Resourcen schon mal geklärt, beschafft wären, kommen auch die anderen haptischen Recourcen.
Und vielleicht, aber wirklich nur vielleicht, könnten wir noch mal gerade die Kurve kriegen.