In den Schatzkammern Roms verbirgt sich unter zahllosen Kostbarkeiten auch das schönste und älteste Bild Marias. Mit dieser Ikone verbindet sich seit Jahrhunderten ein geheimnisvolles Gerücht, das nicht verstummen will. In seiner jüngsten Reportage spürt Paul Badde ihm nach und macht uns zu Augenzeugen des Urknalls unserer Bilderwelt

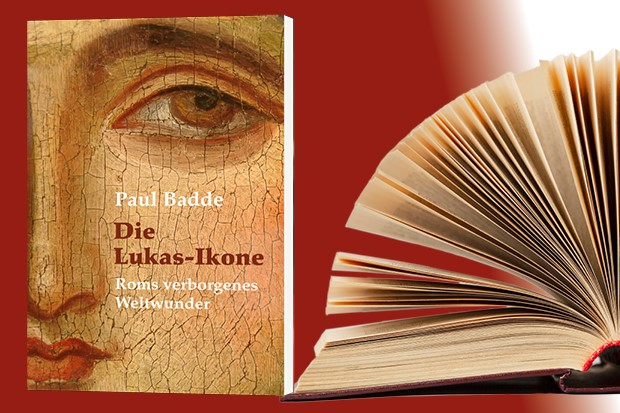
Kein Mensch der Weltgeschichte ist so oft dargestellt worden wie Maria, die Mutter Jesu aus Nazareth. Ihre Portäts haben weltweit in katholischen Kirchen einen Ehrenplatz, sie verschönern fromme Haushalte aller Länder bis heute und füllen die Museen der Welt als Zeugnisse der Kunstgeschichte. Im katholischen Herzland, in Rom, Neapel oder Palermo grüßen von zahllosen Häuserecken die „Madonelle“, kleine Madonnenbildnisse, in Form von Fresken, Mosaiken, Figuren, Reliefs, in Marmor oder Terrakotta.
Alle diese Mariendarstellungen entspringen der frommen Phantasie ihrer Schöpfer. Doch nach einhelliger Überzeugung in der orientalischen und orthodoxen Christenheit, aber auch in weit verbreiteten Traditionen der Volksfrömmigkeit im lateinischen Abendland, wurde Maria zu ihren Lebzeiten von zumindest einem Künstler im Original porträtiert: dem Evangelisten Lukas. Man glaubt hier, dass er von Beruf sowohl Arzt als auch Maler war. Deshalb nannten sich vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit Malervereinigungen „Lukasgilden“.
Paul Badde, ehemals Reporter der FAZ und Korrespondent der WELT, zuerst in Jerusalem und später in Rom, ist dieser Frage Jahrzehnte lang nachgegangen: Hat der Arzt Lukas tatsächlich im 1. Jahrhundert nicht nur das dritte Evangelium und die Apostelgeschichte verfasst, sondern das erste Bild Marias „geschrieben“ (wie man in der Ostkirche die Herstellung von Ikonen bezeichnet)? Hat womöglich Maria selbst ihm in Jerusalem Modell gesessen? Allein in Rom gibt es mindestens sieben Marienbilder, die dem Hl. Lukas zugeschrieben werden, sogenannte „Lukas-Ikonen“.
Am 10. Januar 2005 glaubt der „Indiana Jones des Katholizismus“ (wie er von vielen der Leser seiner Bücher genannt wird) in Rom die „Ur-Ikone“ entdeckt zu haben. Es handelte sich um das Gnadenbild der „Maria Advocata“, das von den klausurierten Dominikanerinnen behütet wird und gegenwärtig in ihrem Kloster auf dem Monte Mario seine Heimat hat. Und er identifiziert mehrere vorgebliche Lukas-Ikonen als offensichtliche Kopien des Ur-Bildes. Badde veröffentlichte am 3. Januar 2007 in der WELT einen ersten Bericht, der zahllose Leser erstmals mit diesem Schatz bekannt machte.
„Wahrheit wird nicht in erster Linie durch Argumente, sondern durch Evidenz vermittelt,“ schrieb der große Philosoph Robert Spaemann kurz vor seinem Tod an Badde, der auch ihn zur Advocata hinaufgeführt hatte. Diese Erkenntnis könnte ein Motto für Baddes neues Werk sein, in dem er mit allen Stilmitteln der von Hans Magnus Enzensberger wieder zu ihrem künstlerischen Recht erhobenen literarischen Reportage darlegt, dass die diese Ikone den großen Marienheiligtümern in Guadalupe, Fatima oder Lourdes nicht nachsteht, sondern sogar als eine ihrer vornehmsten gelten muss.
Baddes Langreportage liest sich spannend wie die Vorlage zu einer kriminalistischen Doku-Serie. Sie kann aus dem erlebnisreichen Journalistenleben des Autors schöpfen, der als langjähriger Korrespondent in Jerusalem und Rom und als Mitreisender bei Papstbesuchen in den Zentren der Weltkirche vor Ort zugegen war. Er berichtet über zentrale religiöse Orte und Schätze, bietet eine stupende Fülle an Mini-Stories, Anekdoten und Begegnungen mit kundigen Mönchen, Kunsthistorikern, Vatikantheologen und Archäologiespezialisten. Ergreifend und produktiv sind die Schicksale und Erkenntnisse gelehrter Frauen wie der Ägyptologin Hilde Zaloscer oder der Fuldaer Nonne Salesia Bongenberg. Badde sammelte im Laufe von zwanzig Recherchejahren viele Zeugen und plausible Argumente dafür, dass die Advocata niemand anderes als der Evangelist Lukas gemalt haben kann. Diese Ikone hält er deshalb für „die Matrix aller Marienikonen und ein verborgenes Weltwunder“.
Seit Jahrhunderten ist sie in der Obhut der Dominikanerinnen, seit 1931 ruht sie geschützt hinter Gittern, lange Zeit war sie unter späteren Übermalungen fast verschwunden. Kann es sein, dass dieses Bild, in der schon ab dem vierten Jahrhundert weitgehend verschwundenen enkaustischen Malweise gefertigt, als einziges christliches Meisterwerk aus dieser Epoche überdauern konnte? „Unmöglich“, lautet die Antwort der akademischen Kunstgeschichte darauf.
Zum einen haben sich von der antiken Malerei fast nur Gemälde erhalten, die durch Vulkanausbrüche (Pompeji), durch Erdbeben (Dura Europos) verschüttet oder wie die ägyptischen Totenbilder aus der Oase Fayum im Wüstensand konserviert wurden. Gewichtig ist auch die Tatsache, dass sich die frühen Christen ans mosaische Bilderverbot hielten. Außerdem verbot im römischen Reich Kaiser Theodosius 392 n.Chr. den Ahnenkult, der ein wichtiger Grund für personale Bildnisse gewesen war. Mit ihnen verschwand auch die aufwendige enkaustische Maltechnik, in der die Farbpigmente in Wachs gebunden heiß auf den Maluntergrund aufgetragen wurden. Nur für den goldenen Hintergrund wird diese Technik von der späteren Ikonenmalerei wieder aufgenommen.
Dafür kommen alle Apostel nach langer Vorbereitung zurück nach Jerusalem. Außer den Zwölfen, unter denen Judas durch Matthias ersetzt wurde, ist jetzt auch Paulus dabei, der ehemalige Todfeind der Urgemeinde. Er wird begleitet von seinen Gefährten Titus und Lukas. Johannes aber, der Liebling Jesu, hat Maria, dessen Mutter, aus Ephesus mitgebracht, wohin sie vor den Angriffen auf die Urgemeinde in Sicherheit gebracht worden war. Wichtige Streitfragen haben sie alle noch einmal auf den Zionsberg geführt. Doch in diesen dramatischen Stunden geschah Unglaubliches!“
Im Johannesevangelium wird von der Grablegung berichtet: „Sie nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihn in leinene Tücher mit den Spezereien, wie es bei den Juden Sitte ist, zum Begräbnis zuzubereiten.“ Als am ersten Wochentag zunächst Maria Magdalena ins Grab schaute und es leer fand, lief sie schnell zu den Jüngern. Petrus „ging hinein in die Gruft und sieht die leinenen Tücher liegen, und das Schweißtuch, welches auf seinem Haupte war, nicht bei den leinenen Tüchern liegen, sondern besonders zusammengewickelt an einem Orte.“
Dieses Schweißtuch zeigte das Antlitz Christi und wurde als „Schweißtuch der Veronika“ zu einer der kostbarsten Reliquien der Christenheit, die über die Jahrhunderte Millionen Pilger nach Rom zog. Als Bildnis, das „nicht von Menschenhand gemalt“, sondern von Jesus, dem Sohn Gottes selbst mit Blut und Schweiß geprägt worden war, und der damit faktisch das jüdische Bilderverbot aufgehoben hatte. Zunächst aber wurde das Schweißtuch von Maria in Gewahrsam genommen und vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Das geschah auch, um die Urgemeinde in Jerusalem zu schützen, wo solche Objekte im Herzen der jüdischen Welt unmöglich ohne Todesgefahr hätten verehrt werden dürfen:
„Das Allerunreinste waren nicht etwa Schweine oder Shrimps und glibbrige Austern“, schreibt Badde, „sondern alles, was mit Gräbern zu tun hatte. Es war die Stunde Null der Christenheit, in der Johannes als Augenzeuge ausdrücklich Tücher im leeren Grab erwähnt. Ein größerer Tabubruch als durch diese Bilder auf Grabtüchern war nicht vorstellbar. Es war ein doppelter Verstoß gegen das Bilderverbot und die Reinheitsgebote, mit Bildern eines Ebenbilds Gottes auf dem allerunreinsten Material, das sich nur vorstellen ließ!“
„Die schiere Existenz dieses höchst verbotenen Bildes“, so Badde weiter, „musste in der Ur-Gemeinde augenblicklich einen Geheimraum inmitten der jüdischen Welt begründen. Also ein so genanntes ‚Arcanum‘, in dem alle Grabtücher sogleich verborgen wurden. Das „Nichtbild“ des Turiner Tuchs und das Lichtbild des Veronika-Schweißtuchs sehen wir nach der ‚Entschlafung‘ Marias in Edessa auftauchen. Die hatte wohl der Apostel Judas Thaddäus dorthin gebracht, wie es eine gewisse Anzahl plausibler Legenden nahelegen. Judas Thaddäus stammte aus der ‚Familie‘ des Erlösers, jedenfalls sind die Tuchreliquien Christi nach allen Anzeichen in fast familiär-natürlicher Erbfolge in seine Hände gegangen.“
Der weitere Weg der Advocata durch die Geschichte ist verwickelt. Nach ihrer Entstehung verblieb sie lange im geheimen Besitz der Verwandtschaft Mariens, aus deren Kreis das Judenchristentum seine Anführer bezog. Im vierten Jahrhundert setzt sich allgemein jedoch das paulinische Christentum mit seiner Ablehnung des jüdischen Gesetzes (Beschneidung, Speisevorschriften, Reinheitsgebote, Bilderverbot) durch, und so kann das Marienporträt in die kirchliche Öffentlichkeit gelangen. Im fünften Jahrhundert taucht die Ikone in Konstantinopel auf und dient unter anderem als Beschützerin der Hauptstadt vor den Bedrohungen durch die kriegerischen Völker des Balkans, der russischen Steppe und der Perser.
Welche historische Bedeutung liegt in der Advocata? Badde hierzu: „Ohne die Kraft der Bilder und die imperiale Macht der Reichsidee wäre das Christentum wahrscheinlich früh in Tausende Sekten und Gurus zerfallen, die sich alle wild bekämpft hätten. Möglicherweise hat die direkte Kommunikation dieser Ikone in ihrem suggestiven Blickkontakt mit dem Betrachter ein Tor für die kommenden Jahrhunderte geöffnet.“
Es wäre deshalb vorstellbar, dass diese Ikone und keine Predigt eines großen Kirchenvaters zur wahren Mutter des „marianischen Prinzips“ (Hans Urs von Balthasar) innerhalb der Kirche wurde, das den entscheidenden Unterschied zwischen dem Katholizismus (wie teilweise auch der Orthodoxie) und den anderen Strömungen des Christentums markiert. Die in institutionalisierte Bahnen gelenkte Marienfrömmigkeit der römischen Kirche vermied dabei in überlegter Balance unkontrollierte Ausbrüche von Schwärmerei und Fanatismus, nicht zuletzt durch die umfassende Einbeziehung von Kunst und Musik in die geregelten Abläufe des Kirchenjahrs.
Das Besondere der religiösen Beziehung zwischen Gläubigen und Maria wird in der Herstellung des Auge-zu-Auge-Kontakts zu ihren Porträts gefunden und schließlich zum höchsten Ziel artifizieller Genialität. Mit dem in einzigartiger Virtuosität ausgeführten Porträt der Gottesmutter durch den Maler und Evangelisten Lukas fand die abendländische Malerei (und viele ihrer orientalischen Geschwister) ihr vornehmstes Thema bis in unsere Zeit.
Baddes gut zwanzig Jahre währende Spurensuche durch den Kosmos der Marienverehrung liest sich spannender als die meisten historischen Detektivromane, und er liefert mehr Hintergrundwissen über Theologie und christliche Archäologie, Kirchen- und Kunstgeschichte, als viele Jahre akademischer Seminarbesuche.
Ferdinand Wenzel, gebürtiger Wiener, arbeitet seit 30 Jahren in Süddeutschland als Bibliothekar einer privaten Stiftung
Paul Badde, Die Lukas-Ikone. Roms verborgenes Weltwunder. Christiana Verlag, Hardcover, 272 Seiten – inklusive 16 Seiten vierfarbiger Bildteil, 19,80 €
Mit Ihrem Einkauf im TE-Shop unterstützen Sie den unabhängigen Journalismus von Tichys Einblick! Dafür unseren herzlichen Dank!!>>>


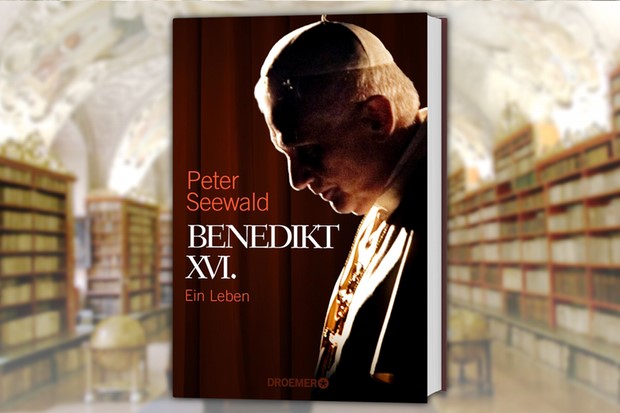
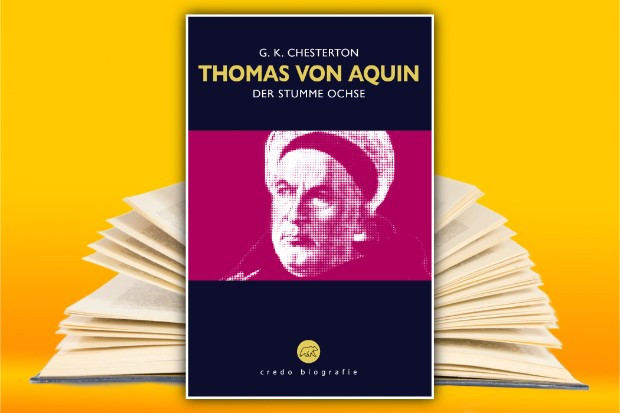
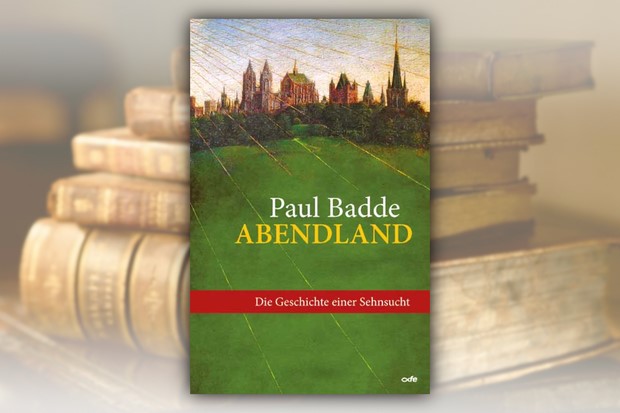























Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein