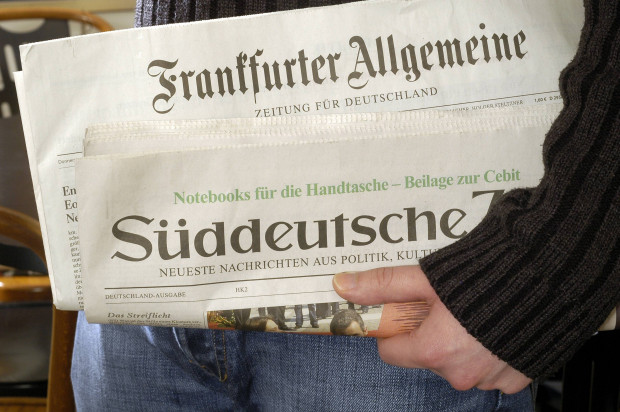Schon seit einiger Zeit ist nichts mehr zu sehen von der berühmten Anzeigenkampagne der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ): „Dahinter steckt immer ein kluger Kopf“. Immerhin seit 1960 lief diese Werbung; als Wort-/Bildmarken beim Deutschen Patent- und Markenamt registriert für die männliche Bildmarke unter der Nummer 755675 sowie 39702748 für die weibliche Fassung. Fehlt Geld, fehlt der Mut dazu oder hat die Erkenntnis um sich gegriffen, dass eine Neuauflage nur Kopfschütteln auslösen würde?
Wie die FAZ Fakten verdreht
Es ist ein Blattschuss, der das Ansehen zuletzt schwer getroffen hat. Sechs Wochen hat der vielfach ausgezeichnete und jüngst emeritierte Prof. Dr. Peter J. Brenner an einem offenen Brief an die Herausgeber gearbeitet, mit dem er sein Abonnement gekündigt hat. Fast 50 Jahre lang habe er das Blatt regelmäßig gelesen. Zukünftig wolle er die gegen jede Kritik immune Redaktion „nicht mehr stören“, spottet er, nachdem er die tatsächliche redaktionelle Leistung detailgenau und detailverliebt gegenrecherchiert hatte. Sein Befund: Weder werden die versprochenen „gründlich recherchierte(n) Fakten“ zuverlässig geliefert noch die „Klug geschriebene(n) Kommentare“; von „präziser Analyse“ könne ebenso wenig die Rede sein wie von einer Ansammlung „erstklassiger Journalisten“.
„Und so geht es weiter, Tag für Tag. Es gibt kein Entrinnen. Wer Erholung sucht vom alltäglichen Einerlei des Politik- und Wirtschaftsressorts und den Sportteil aufschlägt, kommt vom Regen in die Traufe.“
Eine Zeitung geht verloren: die Süddeutsche
Die Süddeutsche Zeitung wiederum leidet auch an verlorener Liebe. Während die FAZ die Liebe aus dem bürgerlichen Lager enttäuscht, frustriert die leichtere, früher lebenslustiger wirkende SZ ihre linken Leser. Jeder, der auch nur einen Schrittbreit gedanklich vom grün-rot dominierten Zeitgeist und der daraus abgeleiteten Redaktionslinie abweicht, hat sich von diesem Blatt ohnehin schon mit Grausen abgewandt. Jetzt verliert es auch die Bindungswirkung an die linken Leser.
Angefangen hat es mit dem sehr lesenswerten Buch von Birk Meinhardt „Wie ich meine Zeitung verlor“. Er ist einer der früheren Starreporter des Blattes, mit vielen der gleichförmigen und konformen, aber in der Branche hochangesehenen Journalistenpreise ausgezeichnet, von denen statistisch gesehen jeden Tag einer verliehen wird. Seine Liebe zur SZ begann nach der Wiedervereinigung; in der DDR hatte der überzeugte Parteigänger der SED vorher erlebt, wie eng Journalismus in echten Diktaturen geführt wird. Meinhardt war kein Dissident in der DDR, aber er lehnte es ab, stellvertretender Chefredakteur zu werden, weil er nicht die Parteianweisungen an seine Kollegen weitergeben wollte – der Idealismus zerbrach am sozialistischen Alltag.
Nach der Wiedervereinigung, als westdeutsche Redaktionen ostdeutsche Journalisten suchten, bekam Meinhardt mehrere Angebote; unter anderem beim Spiegel, der das höchste Gehalt bot.
Zum guten Schluss landete Meinhardt bei der Süddeutschen und, wie er dachte, im Siebten Himmel der journalistischen Liebe. Er beschreibt seine steile Karriere vom Sportressort zum Feuilleton als Starreporter. Endlich konnte er schreiben, was er für richtig hielt: kritisch, genau, präzise. Von ihm stammen lesenswerte Stücke über die Deutsche Bank und Finanzindustrie und ihre von der Bundesregierung gedeckten, von Lobbyisten wie Friedrich Merz geschönten Raubzüge.
Für Meinhardt waren solche Ereignisse schon vor der Finanzkrise keine einzelnen Fehlentscheidungen, sondern einen Systemfehler, der dadurch nicht kleiner wurde, dass sich die meisten großen Banken der Welt der Investment-Zockerei ergeben hatten. Der Chef des Wirtschaftsressorts der Süddeutschen verhinderte die Veröffentlichung. Vier Jahre später, mit der Bankenkrise 2008 stellte sich heraus, dass er mit seiner Einschätzung richtig gelegen hatte. So weit blieb Meinhardt seiner systemkritischen Linie treu.
Schreiben über die „rechte Gefahr“
Aber ihn begannen die Widersprüche zu stören zwischen dem Leben da draußen und dem, wie es in der Zeitung abgebildet wurde. Ab 2010 fiel Meinhardt auf, dass die Berichterstattung über Auseinandersetzungen zwischen angeblich „rechten“ Jugendlichen und Migranten ungleich behandelt wurden. Ihm schienen die lautstarken Schuldzuweisungen nach rechts nicht immer mit den Fakten in Übereinstimmung zu sein. Wieder begann er zu recherchieren und fand sich bestätigt. Er schrieb eine Reportage über gravierende Falschverurteilungen. Aber er blieb dabei nicht stehen. Ihm ist ein Stück zu verdanken, das das Zusammenspiel von Behörden, Politik und Medien zeigt, um eine „rechte Gefahr“ zu beweisen. Er zeigt „was geschehen kann, wenn im Kampf gegen Rechts der Blick auf die Tatsachen verloren geht“.
Es handelt sich um einen spektakulären Angriff auf einen Jamaikaner 2006 in Potsdam. Als die Polizei einen zerstückelten Handymitschnitt ins Internet stellte, auf dem zu hören war, dass eine hohe männliche Stimme „Oller Nigger“ sagt, glaubt ein Mann Björn Liebscher erkannt zu haben. Das reicht, um Liebscher mit äußerst brutaler Gewalt zu verhaften und ihn mit Foto als Täter in „Bild“ zu präsentieren. Mehr noch. „Weil Teile der Gesellschaft nur noch ihren Reflexen folgen. Und weil unter diesen Reflexen die Gewissheit lag, auf der richtigen Seite zu sein“, läuft ein Programm ab, das sich danach immer wieder wiederholen sollte, etwa bei den erfundenen Hetzjagden von Chemnitz:
Kanzlerin Merkel gab den Ton vor: „Mir liegt daran, dass dieser Fall schnell aufgeklärt wird und dass wir deutlich machen, dass wir Fremdenfeindlichkeit, Gewalt, rechtsradikale Gewalt aufs Äußerste verurteilen.“ Generalbundesanwalt Kai Nehm hörte die Signale und zog brav die Ermittlungen an sich. Er ließ Liebscher im Hubschrauber mit verbundenen Augen, Ohrenschutz und Handschellen nach Karlsruhe fliegen, wo er den Mann, gegen den er ermitteln wollte, bereits als Täter präsentierte. Liebscher wurde hinter Gitter gesperrt, obwohl die lokalen Ermittlungsbehörden sehr bald wussten, dass er nicht der Täter war.
Nur weil ein Kriminalbeamter den Mut aufbrachte, der Freundin Liebschers zu sagen, dass er unschuldig sei, kam es auf deren ebenso entschiedene Intervention irgendwann zu seiner Entlassung. Der Mann, der mit voller Namensnennung und Foto als Täter durch die Medien gezerrt wurde, leidet noch heute unter den Folgen. Doch Reinhardts Reportage erscheint nicht, weil sie den „Rechten in die Hände spielen“ könnte. Sie könne „als Testat dafür genommen werden, dass sie ungerechtfertigt verfolgt werden.“ In der DDR, so schreibt Meinhardt, hieß es übrigens, die Kritik möge ja berechtigt sein, aber sie könnte dem Klassenfeind nützen.
Haltung statt Journalismus und Erinnerung an drüben
Meinhardt analysiert, wie die gesamte Berichterstattung, nicht nur die der Süddeutschen, „nur noch in eine Richtung gebürstet“ ist. Es wird einer „Haltung“ Ausdruck verliehen, statt zu berichten und zu analysieren. Sehr bald geriet der Autor in der Süddeutschen immer weiter ins Abseits. Wer einmal zu zweifeln begonnen hat, ist für die Süddeutsche nicht mehr einsetzbar. Meinhardts Leiden ist die enttäuschte Liebe eines Journalisten, der nach der gelenkten Medienlandschaft in der DDR die Meinungsfreiheit schätzen lernte und dann feststellen musste, dass es jedenfalls bei der Süddeutschen doch nicht so weit her ist damit. Es ist ein lesenswertes Buch mit Innenansichten der Medienlandschaft und der Innenwelt von Journalisten. Doch jetzt erhält die SZ Kritik von ihren Kernzielgruppe, den erleuchteten Lesern mit rot-grüner Grundierung.
Die Kernleserschaft sieht sich bedroht
Anlass ist ein Beitrag ihres Musikkritikers über Igor Levit. Eigentlich nichts Besonderes; Musikkritiker kritisieren Musik wie Filmkritiker Filme, Literaturkritiker Bücher oder Autoredakteure neue Modelle, und dabei geht es aus Sicht der Betroffen selten gerecht zu. Levits musikalische Leistung fand der Autor in einem merkwürdigen Gegensatz zu seiner politischen Berühmtheit stehend, für die der Musiker kürzlich das Bundesverdienstkreuz erhielt. Jenseits von Musikfreunden ist Levit als Kritiker der AfD bekannt geworden; deren Wählern sprach er pauschal das „Menschsein“ ab. Nun hätte hier die Kritik einsetzen müssen; denn egal wie man zur AfD stehen mag: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Aber statt Kritik erfuhr Levit begeistere Anerkennung für das, was man sonst zu Recht als „Hass und Hetze“ brandmarkt – bis hin zum Bundesverdienstkreuz.
Doch nun erfährt die SZ bitterste Kritik via Twitter. Damit sollte man umzugehen gelernt haben. Twitter-Stürme sind meist Aufregungen im Lager der „woken“ Aktivisten, also der rot-grün Erleuchteten, die sonst kaum Job, Anerkennung oder Ansehen genießen außer im kurzen Blitzlichtgewitter eines Twittersturms. Auch Musikkenner sind eher selten, so wie Bildung ohnehin zu kurz kommt. Es sind abzählbare Teilnehmer, an die sich Heere von Opportunisten anschließen; oft unterstützt von politischen Aktivisten etwa von einer Hamburger PR-Agentur, die ihre Unterbeschäftigung und die daraus resultierende Tagesfreiheit durch heftiges Twittern kompensieren müssen.
Aber es lohnt nicht, sich darum zu kümmern – es sei denn, in der realen Welt reagieren Unerfahrene kopflos. Wie die Chefredaktion der SZ. Statt sich vor den Kollegen zu stellen, folgte eine peinliche Entschuldigung: „Das Meinungsbild, das wir auf dieser Leserbrief-Seite abbilden, entspricht auch in etwa dem Meinungsbild innerhalb der SZ-Redaktion. Viele Redakteurinnen und Redakteure empfinden etliche Stellen des Textes ebenfalls als antisemitisch – insbesondere jene, die sich über den jüdischen Künstler Levit lustig macht, weil er nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten vor einer Synagoge in Hamburg auf Twitter an mehreren Tagen schrieb, wie müde er sei… Harte Kritik gibt es in der Redaktion am Begriff „Opferanspruchsideologie“. „Auch die im Text thematisierte Frage, ob Levits Einsatz gegen Rechtsextremismus „nur ein lustiges Hobby“ sei, sorgt in der Redaktion, ebenso wie außerhalb, für großen Unmut.“ Die Wut entzündete sich am Begriff „Opferanspruchsideologie“, das auf Levit bezogen wurde, wobei der Autor tatsächlich das ewige Jammern auf Twitter über angebliche Benachteiligung benannt hat.
Chefredaktion gelobt Gehorsam
Die Chefredaktion gelobte Gehorsam in einem Ton, der aus Diktaturen bekannt ist inklusive dem Versprechen der Besserung. Aber es nutzt nichts. Die SZ wird in Zukunft keinerlei kritische Berichterstattung mehr pflegen, das ist die implizite Botschaft. Mehr denn je, so verspricht die SZ-Chefredaktion, wird sie sich auf die Seite der Guten und ihrer Regierung stellen und jeden auch nur ansatzweise kritischen Beitrag, der sich mit der Realität des Landes, der Musik, Politik, Wirtschaft und Kultur beschäftigt sorgfältig prüfen, ob er ins rot-grüne Meinungsklischee, in das immer kleinere Raster des noch Erlaubten passt.
Bleibt die Frage: Wer braucht so eine Zeitung? Ist es wirklich der richtige Weg zukünftig nur noch auf Subventionierung aus Steuermitteln zu hoffen? Eine Art Print-GZ, nur um nie mehr kritisch und gegen Widerstand schreiben zu müssen? Und plötzlich sind sich die Erzkonkurrenten unter den Leitmedien, die SZ aus München und die FAZ aus Frankfurt, doch sehr ähnlich. „Haltung“ ersetzt kritischen Journalismus; Fakten sind biegsam und Regierungsnähe Blattlinie.
Nur die Leser, die nehmen das nicht mehr unwidersprochen hin.