Unser Autor hat sich schon mal die Mühe gemacht, den Merkel-Text von 1999 zu aktualisieren – ohne Auftrag, aber mit mutigen Unionspolitikern im Blick.

 © Getty Images
© Getty Images
Vor 18 Jahren schrieb die damalige CDU-Generalsekretärin Angela Merkel in der F.A.Z. einen mutigen Artikel, in dem sie die Abnabelung vom Übervater Helmut Kohl forderte. Auch heute hält mancher in der CDU einen solchen Abnabelungs-Text für angebracht. Falls sich ein mutiger CDU-Mann oder eine mutige CDU-Politikerin findet. Merkels Nach-Nach-Nachfolger im Amt des Generalsekretärs, #FEDIDWIGUGL-Tauber ist nicht aus dem Holz, um einen solchen Scheidungstext zu schreiben. Wer aber den Mut dazu hätte, bräuchte im Original nicht allzu viel zu verändern. Unser Autor hat sich schon mal die Mühe gemacht, den Merkel-Text von 1999 zu aktualisieren – ohne Auftrag, aber mit mutigen Unionspolitikern im Blick.
Den 25. September 2017 haben viele als den Anfang vom Ende der Ära Merkel bezeichnet. Das war der Tag, an dem Angela Merkel nach den schweren Stimmverlusten der CDU/CSU sagte, sie sehe nicht, „ was wir anders machen sollten.“ Doch sofort hieß es auch, vielleicht liege in dieser schweren Wahlniederlage auch eine Chance – eine Chance auf eine neue schwarz-gelbe-grüne bürgerliche Mehrheit.
So schnell aber kann nur sprechen, wer das volle Ausmaß der Tragik des Wahltags nicht an sich heranlässt – der Tragik für Angela Merkel, der Tragik für die CDU. Was für eine Niederlage am 24. September 2017 – erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurde eine Kanzlerpartei vom Wähler so abgestraft. Noch nie hat eine Partei, die den Regierungschef stellt, so herbe Einbußen hinnehmen müssen, wie die CDU/CSU: der Rückgang von 41,5 auf 32,9 Prozent bedeutet den Verlust von einem Fünftel der Wähler.
Die von Merkel eingeschlagene Politik hat der Partei Schaden zugefügt. Nicht nur haben sich Mitglieder und Wähler abgewendet. Zugleich ist auch rechts von der Union das entstanden, was Franz Josef Strauß und Helmut Kohl stets zu verhindern gewusst hatten – eine demokratisch legitimierte neue Partei. Das war nicht nur das Ergebnis einer falschen „Flüchtlingspolitik”. Dazu haben der von Merkel forcierte Modernisierungskurs der CDU sowie die vielen Zugeständnisse gegenüber der SPD in zwei Großen Koalitionen ebenso beigetragen. Es geht um die Glaubwürdigkeit Merkels, es geht um die Glaubwürdigkeit der CDU, es geht um die Glaubwürdigkeit politischer Parteien insgesamt.
Merkel hat der Partei gedient. 17 Jahre war sie Parteivorsitzende, das ist die drittlängste Zeit nach Kohl und Adenauer. In vier Bundestagswahlen wurde die CDU/CSU mit ihr als Spitzenkandidatin stärkste Fraktion. Dennoch reicht es jetzt nicht mehr für eine zukunftsversprechende Koalition – nicht mehr für Merkel und nicht mehr für die CDU.
Spätestens jetzt ist klar, nichts würde mehr so sein, wie es war. Die Zeit der Parteivorsitzenden Merkel ist unwiederbringlich vorüber. Nie wieder wird sie die CDU als Kanzlerkandidatin in eine Bundestagswahl führen können. Seither wird von ihren Leistungen in der Vergangenheit gesprochen – von der Sanierung der Bundesrepublik nach dem finanziellen Desaster von Rot-Grün, von der Überwindung der Finanz- und Wirtschaftskrise, vom Zusammenhalten der EU in schwierigen Zeiten, von der mächtigsten Politikerin Europas.
Viele Menschen – in der Partei zumal – vertrauen Angela Merkel. Die siebzehn Jahre der Parteivorsitzenden Merkel werden mit dem Verweis auf die 32,9 Prozent vom 24. September 2017 mit Sicherheit nicht ausreichend beschrieben. Das reicht vielleicht für ein paar Redakteure, nicht aber für ein Mitglied der Gemeinschaft CDU. Wir haben ganz andere Erfahrungen mit und Erinnerungen an Angela Merkel. Die Partei hat eine Seele. Deshalb kann es für uns nicht die Alternative „Schuldzuweisungen“ oder „das Erbe bewahren“ geben. Wenn es um das Bild Angela Merkels, um ihre Leistungen und um die CDU geht, gehören beide zusammen. Denn nur auf einem wahren Fundament kann ein richtiges historisches Bild entstehen. Nur auf einem wahren Fundament kann die Zukunft aufgebaut werden.
Diese Erkenntnis muss Angela Merkel, muss die CDU für sich annehmen. Und nur so wird es der Partei im Übrigen auch gelingen, nicht immer bei jeder neuen Schwierigkeit für die Bildung einer stabilen Regierung angreifbar zu werden, sondern aus dem Schussfeld auch derjenigen zu geraten, die die eingetrete Lage in Wahrheit nur nutzen wollen, um die CDU Deutschlands kaputtzumachen.
Vielleicht ist es nach einem so langen politischen Leben, wie Angela Merkel es geführt hat, wirklich zu viel verlangt, von heute auf morgen alle Ämter niederzulegen, sich völlig aus der Politik zurückzuziehen und den Nachfolgern, den Jüngeren, das Feld schnell ganz zu überlassen. Und deshalb liegt es auch weniger an Angela Merkel als an uns, die wir jetzt in der Partei Verantwortung haben, wie wir die neue Zeit angehen. Wir kommen nicht umhin, unsere Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Die Partei muss also laufen lernen, muss sich zutrauen, in Zukunft auch ohne ihre bisherige Frontfrau den Kampf mit dem politischen Gegner aufzunehmen. Sie muss sich wie jemand in der Pubertät von zu Hause lösen, eigene Wege gehen und wird trotzdem immer zu der stehen, die sie seit 2000 ganz nachhaltig geprägt hat – vielleicht später sogar wieder mehr als heute.
Ein solcher Prozess geht nicht ohne Wunden, ohne Verletzungen. Wie wir in der Partei aber damit umgehen, ob wir dieses scheinbar Undenkbare als Treuebruch verteufeln oder als notwendige, fließende Weiterentwicklung nicht erst seit 24. September 2017 begreifen, das wird über unsere Chancen bei den nächsten Wahlen in den Ländern und im Bund entscheiden. Ausweichen können wir diesem Prozess ohnehin nicht, und Angela Merkel wäre im Übrigen sicher die Erste, der dies verstünde.
Wenn wir diesen Prozess annehmen, wird unsere Partei sich verändert haben, aber sie wird in ihrem Kern noch dieselbe bleiben – mit großartigen Grundwerten, mit selbstbewussten Mitgliedern, mit einer stolzen Tradition, mit einer Mischung aus Bewahrenswertem und neuen Erfahrungen nach der Ära der Parteivorsitzenden Angela Merkel – und mit einem Entwurf für die Zukunft.
(Ursprungstext: Angela Merkel, „Die von Helmut Kohl eingeräumten Vorgänge haben der Partei Schaden zugefügt“, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22. Dezember 1999, S. 2.)
Dieser Beitrag ist auch bei Cicero erschienen.





















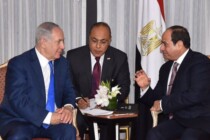









Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
Die SPD hat Buschkowsky und Sarrazin, die Linke hat Wagenknecht, die FDP hat Kubicki, die Grünen haben Palmer, die CSU hat Söder. Das sind alles Leute, die ihren Parteikollegen auf die Finger klopfen, wenn sie es zu weit treiben. Aber wen hat die CDU? Wer klopft Merkel auf die Finger?
Zitat: „Seither wird von ihren Leistungen in der Vergangenheit gesprochen – von der Sanierung der Bundesrepublik nach dem finanziellen Desaster von Rot-Grün, von der Überwindung der Finanz- und Wirtschaftskrise, vom Zusammenhalten der EU in schwierigen Zeiten, von der mächtigsten Politikerin Europas.“ . Herr Müller-Vogg, bitte lesen Sie diese, Ihre Textadaption nochmal aufmerksam. Und finde den Fehler…. . Von Sanierung der Staatsfinanzen kann nach all den Griechenlandpaketen, der Kosten von Migrationskrise und Energiewende keine Rede sein. Als nächstes beabsichtigt Merkel die von Macron geforderte Vergemeinschaftung der EU- Schulden. Die Schuldenkrise ist mitnichten überwunden, sondern es wurde lediglich Zeit erkauft durch das… Mehr
Sehr schön, dass ich jetzt endlich hier auch schreiben kann. Bin T-Online Nutzer.
Ich hoffe als ehemaliger CSU-Wähler, dass die CSU-Abgeordneten morgen die ersten richtigen Weichen stellen werden = Horst in den Keller zur seiner Eisenbahn. Wenn ja, dann kann hier noch einiges an unerwarteter Dynamik einsetzen. Ich war mal ein überzeugter Merkel-Anhänger, heute steigt mein Blutdruck wenn ich nur ein Bild von ihr sehe !
Herr Müller-Vock, dass Merkel der Partei und dem Land massiven Schaden zugefügt hat ist nicht nur offensichtlich und bekannt, es ist einfach Fakt. Allerdings nicht für Merkels Hofschranzen in Berlin, denn ohne Merkel würde viele in der letzten Reiher verschwinden. Merkel wird die CDU noch unter die 20% drücken und alle werden wieder 10 Minuten Beifall klatschen, denn inzwischen ist sie die CDU. Die alte, vormalige CDU gibt es mehr als 10 Jahre nicht mehr und mit dem Brechen der Euroverträge begann auch der Abstieg der einstmaligen „Volkspartei“! Merkel agiert schon lange nicht mehr nach dem Eid, sondern im Interesse… Mehr
Was soll eine Amtszeitbeschränkung nützen, wenn die gesamte CDU-Führungsriege Merkels Ansichten teilt?
Wenn das gesamte Prozedere das wir jetzt fast jeden Tag aufgeführt bekommen dazu führt,das Frau Merkel und auch ein Horst Drehhofer von der politischen Bühne verschwiden,dann soll es mir Recht sein. Es muss sehr gründlich in der CDU aufgeräumt werden,um den politischen Kahlschlag der Frau Merkel auch nur halbwegs wieder auf solide Füsse zu stellen. Alle guten hat die Frau gnadenlos abgeräumt,den Rest der Parteiführung muss nun die verbliebene junge Generation abräumen,sonst wird das nichts mehr mit neuer Glaubwürdigkeit,mit zurückgewinnung der abtrünnigen Wähler. Ich bin seit ewigen Zeiten Liberal-konservativ,habe deshalb 2013 die FDP nicht mehr gewählt,und 2017 die CDU, aber… Mehr
„aber 2017 wieder die FDP, die ihren alten liberal-konservatien Kurs durch Christian Lindner neu aufgenommen hat.“
Die FDP mag zwar auf dem Papier eine Opposition sein, aber spätestens dann, wenn die FDP aus Prinzip gegen den Antrag auf einen Untersuchungsausschuss gegen Merkel stimmt, nur weil er aus der AFD kommt, werden Sie sehen, dass eine FDP-Stimme eben keine Anti-Merkel-Stimme war.
Angela Merkels rechtswidrige „Politik der offenen Grenzen“ haben deutsche Bürger und ausländische Gäste mit dem Leben bezahlt. Tausende vergewaltigte Frauen, Jugendliche und Kinder haben für Merkels Rechtsbrüche mit ihrer körperlichen und seelischen Unversehrtheit bezahlt. Diese „Mutigen“ in der CDU, die jetzt wie Rüttgers den Verlust von über 60 Bundestagsmandaten beklagen, haben zu den Morden und Vergewaltigungen geschwiegen. Die CDU hatte zweimal auf den Parteitagen 2015 und 2016 die Möglichkeit, Merkel das Handwerk zu legen und damit weitere Verbrechen an der Bevölkerung durch Illegale zu verhindern. Stattdessen haben die Delegierten, insbesondere das Parteipräsidium, dieser Frau stehend minutenlang applaudiert. Dass Merkel der… Mehr
das gilt natürlich a u c h für die anderen, die das verbrechen an deutschland zugelassn haben ebenso!!
Frau Merkel war von Anfang an eine NOTLÖSUNG. Eine schlimme Fehlbesetzung, die zum Niedergang zuerst der CDU, dann der CSU, dann der deutschen Demokratie und nun zum beginnenden Niedergang Deutschlands geführt hat und führt. Sie stellt all das infrage, wofür wir Ossis die Kommunisten zum Teufel gejagt haben. Sie hat mit ihrer Europapolitik das Verhältnis zu Russland torpediert, mit ihrer Flüchtlingspolitik Europa gespalten und die Briten in die Flucht geschlagen. Sie hat das seit Gründung der BRD bestehende ausgezeichnete Verhältnis zu den USA zerstört und eine lächerliche Politliebe zu der Großschnauze Macron angefangen. Da aber keine Aktion ohne REaktion bleibt,… Mehr
Was für Leistungen von CDU und Merkel? Vielleicht die vorläufige Rettung des Euros, was Milliarden kostete und die Altersvorsorge der Bürger…auch die Gesetzliche RV zahlt Strafzinsen…nieder machte…oder die Bankenrettung, die Steuer Milliarden gekostet hat…oder die Einladung der Migranten, die über 50 Milliarden pro Jahr bis jetzt fordert….oder die unbezahlbare Energiewende, die demnächst scheitern wird…
Welche Leistungen also sind da zu sehen? Ich bitte um Nachricht….
Haben sie denn noch nicht die Merkelsteine bemerkt, die unsere Innenstädte verschönern? Wo sonst ist es einem Politiker gelungen, sich in jeder Stadt des Landes nicht ein Denkmal, sondern gleich hunderte setzen zu lassen? Und was ist mit der Ehe für alle? Die wäre ohne Merkel auch nicht gekommen!
Ich erinnere mich daran, wie nach dem „Weggang“ Helmut Kohls aus der CDU ein Nachfolger gesucht wurde. NIEMAND WOLLTE. Nach der Spendenaffaire. Da kam man auf „Kohls Mädchen“. SIE WAR EINFACH DA. Und als unbedarfter Ossi MACHTE SIE DEN PARTEICHEF. Keine Ahnung von Demokratie und mit ein bisschen Übung als Umweltminister. Und dann – ich erinnere mich genau – ging es wie ein Aufschrei durch die Reihen der Konservativen: Mensch, der Parteivorsitzende muss ja auch für den Bundeskanzler kandidieren! Plötzlich wurde klar, dass der „Ausputzer“ gefährlich werden könnte. Diskussionen begannen: kann die das – muss das wirklich sein? Man beruhigte… Mehr
Merkel ist mir EGAL! Und zwar so egal, wie ich es wahrscheinlich auch in ihren Augen bin. Warum sollte sie sich aber auch um mich kümmern wollen, denn ICH kenne zwar diese Person, aber SIE kennt MICH nicht! Vielleicht darf man ihr also noch verdanken, dass es jetzt rechts neben der CDU ENDLICH eine Partei gibt, die gar nicht so rechts ist, sondern neben all den anderen politischen VERSAGERN noch das Wohl des Volkes berücksichtigen möchte. Allein; DAS überhaupt in Frage stellen zu müssen, zeigt, wes Geistes Kind eine Frau Merkel offensichtlich ist, respektive ist einer Frau Merkel wohl in… Mehr