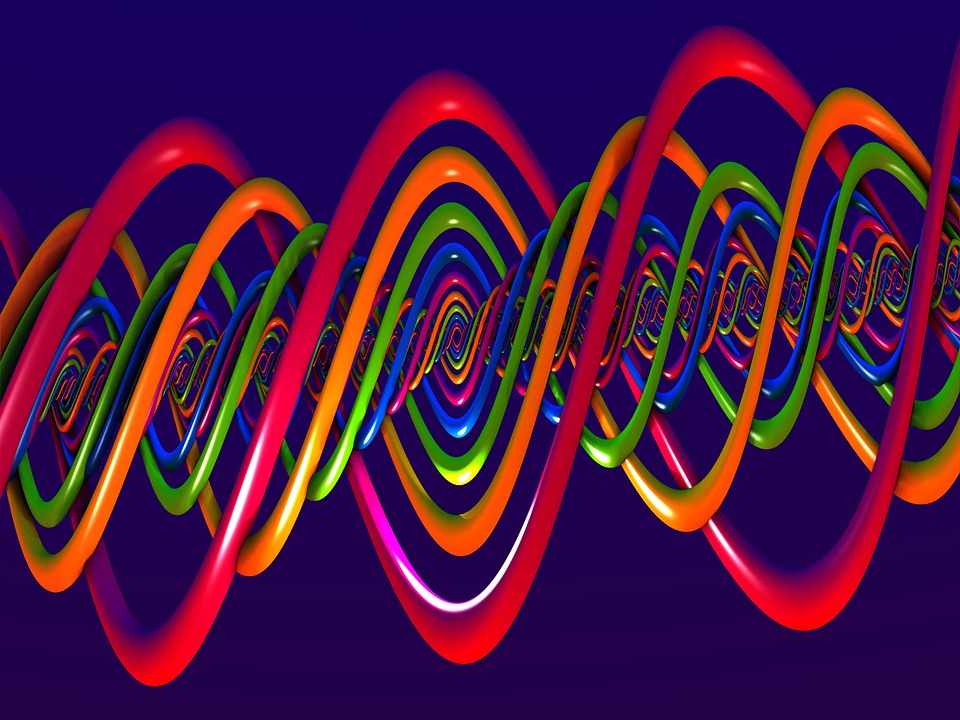Darf ich Sie in eine wundersame Welt mitnehmen, in der Sie mit Sicherheit noch nie waren? In die Sie auch niemals hineinkommen werden?
Niemand kann sie sehen. Zumindest nicht direkt. Die Welten im Kleinsten sind vollkommen anders als die, die wir kennen und in der wir leben.
In unserer „realen“ Welt können wir durch Straßen gehen, es stehen Häuser, es fahren Autos und Eisenbahnen.
Doch betrachten Sie jetzt einfach einmal ihren Arm, nur als Beispiel. Fahren Sie in Gedanken natürlich nur in das Innere ihres Armes. Durchbrechen Sie die Grenze der Haut, bewegen sich an Blutgefäßen weiter vorbei und treffen recht schnell auf Muskelzellen. Weiter geht’s durch die Hülle der Zelle, der Zellmembran. Kein großes Problem, die ist nur knapp 10 nm, also zehn millionstel Millimeter dick.
Jeder seine chemische Fabrik
Und schon sind wir in einer lebendigen chemischen Fabrik. Wie die Stahlträger in einer großen Produktionshalle sorgt auch hier ein festes Skelett für Stabilität, das sogenannte Zytoskelett.
Im Inneren wieseln Millionen von Molekülen umher. Da gibt es in der einen Ecke ein komplettes Kraftwerk, merkwürdig fächerförmig angeordnet; das besorgt die Energieversorgung der Zelle. In bestimmten Zellen wie Leberzellen gibt es sogar ein mehr als tausend dieser Kraftwerke. Sie sollen die Energie aus unserer Nahrung so umbauen, dass die Zelle sie für ihren Betrieb verwenden kann.
Dann gibt es eine Fertigung, eine Art Versandlager zum Export der fertigen Produkte und natürlich eine Müllentsorgung. Davor sind noch Recyclinganlagen angeordnet, die Stoffe wiederverwerten. Und wie überall hat sich auch in unserer Zelle eine fette Verwaltung eingenistet. Die sitzt im Zellkern. Sie produziert Pläne, Baupläne für die Zelle und Anweisungen für deren Ausführung.
Bei einer richtigen Verwaltung kommt hier auch mitunter Mist heraus. Diese fehlerhaften Pläne werden gleich wieder in den Mülleimer geworfen und geschreddert.
Begeben wir uns also in den mit einer wässrigen Lösung angefüllten Zellkern, schauen bei der Produktion der Pläne, der so genannten DNA, zu.
Hier erleben wir unsere Überraschung:
Könnten wir tiefer ins Innere unseres Körpers und unserer Organe in die Moleküle fahren, aus denen wir bestehen, würden wir erhebliche Überraschungen erleben:
Stürmisch geht es zu, rau und extrem unwirtlich. Kein Ort, an dem wir uns aufhalten möchten.
„Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einer einsamen Insel und es bläst ein Orkan von 300 km/h.
Man befindet sich in einem ganz schlimmen Hagelsturm, und gleichzeitig, das ist dann schwer vorzustellen, bewegt man sich durch eine träge, viskose Masse.
Was dort auf das Protein andonnert, ist sozusagen die Hölle. Da kommen Wassermoleküle mit hunderten von Metern pro Sekunde angeflogen und donnern auf dieses Protein drauf, und es ist alles permanent in Bewegung.
Man selbst wird ständig hin und her geworfen, aber es fällt einem selber unheimlich schwer, Bewegung zu erzeugen.“
So schildern Wissenschaftler der Technischen Universität München, wie es aussehen würde, könnten wir uns ungefähr eine Million mal kleiner machen und in die Nanowelten eintauchen, in der DNA-Moleküle „leben“.
Hendrik Dietz, Professor für Biophysik leitet das „Dietz Lab“ im Laboratorium für Biomolekulare Nanotechnologie an der Technischen Universität München. Das Ziel seiner Arbeitsgruppe ist die Erforschung neuer Methoden in biomolekularer Physik. Oder wie er es einfacher ausdrückt: Basteln und Stricken auf der Nanoskala. In diesen Welten wollen sie mit den Baumaterialien aus biologischen Systemen, ähnlich wie aus Legosteinen neue Maschinen zusammensetzen, die auch Aufgaben erledigen können sollen.
Basteln und Stricken auf der Nanoskala
Dietz, der auch in Harvard arbeitete, ist fasziniert vom Leben, das sich in den Zellen jedes Organismus abspielt. Rund 4.000 bis 5.000 Eiweiße arbeiten in einer einzigen Zelle nach strengen, aber einfachen Regeln. Alle Aufgaben sind miteinander verbunden, und es funktioniert perfekt.
Mit Intuition erfassen lässt sich für Menschen aus unserer Welt nichts mehr. Erfahrungen aus unserer großen, makroskopischen Welt gelten im Nanokosmos nicht.
Nanomaschinen – damit sind nicht jene Gebilde aus Silizium gemeint, die ähnlich wie Computerchips aus festen Stoffen meist in Form irgendwelcher Kristalle hergestellt werden. Die mit der Aufmerksamkeit garantierenden Vorsilbe »Nano« garnierten Visionen zeigen meist Zahnräder, die locker auf dem Knie einer Ameise liegen, oder Bilder, von denen die Forscher fest behaupten, es handele sich um vier Räder an einem Nanoauto. Nur drehen können die sich noch nicht, weil sich die herkömmliche Mechanik nicht so ohne Weiteres auf Nanostrukturen anwenden lässt.
Solche Gegenstände sind lediglich tote Materie, raffiniert meist aus Kohlenstoffatomen zusammengebaut.
Die Nanotechnik, um die es hier geht, spielt sich im Reich der bewegten Materie ab. Deren Bausteine sind lebendige Proteine, Eiweiß-Molekülhaufen, die frei herumwabern, deren Atome in ständiger Bewegung sind.
Das beliebteste Element der Forscher ist das DNA-Molekül. Das Molekül mit der berühmten Doppelhelix gehört zu den am besten erforschten Molekülen, fast alle Eigenschaften sind bekannt.
Friedrich Simmel ist Professor für experimentelle Physik an der Technischen Universität in München. Seitdem in den Vereinigten Staaten die ersten frappierenden Fortschritte gemacht wurden, dämmerte auch den Forschungsförderungsinstanzen hierzulande, dass sich dahinter womöglich eine sehr zukunftsträchtige Angelegenheit verbirgt. Dieser Technologie wird durchaus ein ähnliches Potential zugeschrieben wie seinerzeit in den Anfängen der Computertechnologie. Forschungsgelder fließen, ein neues modernes Forschungszentrum in München wurde gebaut, Lehrstühle wurden eingerichtet und deutsche Wissenschaftler kamen tatsächlich aus den Staaten zurück und leiten Arbeitsgruppen oder »Labs«. Mittlerweile haben sich dort erstaunliche Forschungsaktivitäten entwickelt, die auch international anerkannt und gelobt werden.
Friedrich Simmel zum Beispiel, der früher in den berühmten Bell Labs in den Vereinigten Staaten forschte, untersucht an der TU München die Physik der Nukleinsäuren und ihre Anwendungen in der Bionanotechnologie.
Seine Vision ist ein sich selbst organisierendes Molekularsystem, das sogar auf Einflüsse seiner Umgebung reagieren können soll. Grundlage sind die berühmten vier Bausteine, aus denen das DNA-Molekül zusammengesetzt ist: Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin.
Ein Durchbruch geschah vor ungefähr einem Dutzend Jahren, als die ersten künstlichen Strukturen aus Biomolekülen geschaffen werden konnten, die sich tatsächlich auch bewegten.
Der amerikanische Biochemiker Nadrian Seeman entwickelte erste Konzepte und Visionen für eine Nanotechnologie, die auf DNA-Proteinen bestehen sollte. Er stellte bereits vor 30 Jahren mit einem Würfel aus DNA-Molekülen das erste dreidimensionale Nanoobjekt her und entwickelte Methoden, wie sich die vier Basenpaare der DNA zu ganz neuen Strukturen zusammensetzen lassen.
DNA-Moleküle herstellbar
DNA-Moleküle lassen sich heute sehr gut künstlich herstellen. Mangel an Material für die Forschungsarbeiten herrscht nicht.
Simmel: „Man kann beliebige DNA Strukturen chemisch synthetisieren, sodass wir solche Strukturen am Reißbrett gewissermaßen konstruieren können.“
Beeindruckende technische Fortschritte in der Biophysik und Biochemie erlaubten die ersten größeren Sprünge in den Nanowelten. Zunächst einmal galt es für die Forscher, die Regeln zu erkennen, nach denen hier gespielt wird.
Arbeiten in der Nanowelt – das ist ungefähr wie auf dem Meer auf einem Segelschiff. Der Kapitän nutzt die Kraft des Windes für die Vorwärtsbewegung und versucht, die Natur für seine Zwecke zu nutzen. Genauso versuchen dies Wissenschaftler mit Molekülen in den Nano-Welten.
Es eröffneten sich vollkommen andere „Landschaften‘“ wenn man in diese Tiefen steigen könnte. Fahren wir tief zum Beispiel in das Blatt eines Baumes hinein, erkennen wir Adern und Blattmasse. Mit dem normalen Lichtmikroskop können wir gerade noch kleine Strukturen erkennen wie zum Beispiel die einzelnen Zellen.
Bakterien können wir auch noch mit dem Mikroskop sehen. Danach aber wird es schwierig, wenn es noch weiter in die kleinsten Teilchen geht.
Dazu benötigen wir einen deutlich höheren technischen Aufwand. Nur mit Geräten wie zum Beispiel einem Elektronenmikroskop können wir dann Viren erkenne oder Aminosäuren.
Dann kommen wir bei unserer Fahrt in das Kleinste in den sogenannten Nano-Bereich, den Bereich der Moleküle. Die sind so groß wie der Milliardstel Teil eines Meters. Hier geschieht das Erstaunliche: Es weht an den Teilchen ein heftiger Wind vorbei. Die Luftteilchen bewegen sich – angetrieben von der Wärme der Umgebung. Denn Temperatur, das wissen Physiker, ist nichts anderes als Bewegung von Teilchen. Je höher die Temperatur, desto stärker bewegen sich Atome und Moleküle in Flüssigkeiten.
Diese Brownsche Molekularbewegung wirkt genauso auch in den Welten des Nanokosmos.
Es sind dieselben Vorgänge in der Luft, wie wir sie in unserer ‚großen‘ Welt auch erleben. Doch uns machen sie nichts aus. Wir sind schwer genug, um nicht gleich umgeworfen zu werden. Da muss schon ein starker Orkan her, um uns wegzublasen.
Matthias Rief ist Leiter des Lehrstuhles für Biophysik in München und untersucht die mechanischen Kräfte in diesen biomolekularen Systemen. Doch würden wir so klein, sagt der Professor für Biophysik, dass wir in die Nanowelt passten, dann wehte uns bereits der normale Wind leicht weg.
Nanowind
Weil die Objekte in der Nanowelt so extrem klein sind, sind die Bewegungen der Umgebung im Verhältnis zu ihrer Größe sehr stark. Das bedeutet, dass sie heftig hin und hergeworfen werden – Spielball der Winde oder der thermischen Bewegungen, wie Wissenschaftler sagen.
Honig, wie wir ihn kennen, fließt zäh herunter. Tauchen wir einen Löffel in den Honig, so bremst der Honig die Bewegung. Die Moleküle erleben im Kleinsten genau eine solche Welt, in der Bewegungen gedämpft werden.
Simmel: „Man muss sich vergegenwärtigen, dass Bewegungen auf dieser Skala in wässriger Umgebung zumindest auch immer gedämpft sind, das heißt, wenn man ein Objekt anschubst, dann bleibt es sofort wieder stehen, während auf unserer makroskopischen Skala sich Objekte einfach weiter bewegen gemäß den Newtonschen Gesetzen.“
Dennoch gelten die Gesetze der Physik wie in der großen Welt auch in den Bereichen des Kleinsten. Nur sind die Auswirkungen andere, weil die Größenverhältnisse anders sind. Und das macht es für Wissenschaftler so reizvoll, sich mit diesen geheimnisvollen, unbekannten Welten zu befassen und zu erforschen, wie sie funktionieren.
Nanomaschinen bauen
Friedrich Simmel will jetzt in diesen Welten Nanomaschinen bauen: »Für mich als Nanotechnologe ist jetzt natürlich die Aufgabe: Ich will eine künstliche Maschine bauen und nicht eine Maschine nehmen, die in der Natur bereits vorhanden ist.
Motoren eines Automobils beispielsweise sind die Maschinen, die wir seit langem kennen und die Ingenieure bisher mit Bravour bauen. Sie können wir sehen, anfassen und auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Werkzeuge: Schraubenzieher und Schraubenschlüssel.
Die Werkstatt eines Maschinisten der Nanowelt sieht völlig anders aus: Ein normales Chemielabor, Laborbänke, Reagenzgläser, Waagen, Kühlschränke mit unzähligen Materialien, vor allem mit vielen unterschiedlichen Proteinen, den Rohstoffen, aus denen später einmal Nanomaschinen werden sollen. In der Ecke Notduschen wie in jedem Chemielabor.
Die Werkzeuge der Nano-Techniker: eine Pipette und viele Flüssigkeiten, Lösungen und Enzyme.
Die Arbeit der Biochemiker ist vom Prinzip her wenig abwechslungsreich: Ein paar Tropfen in eine andere Flüssigkeit hineingeben, warten, und prüfen, was passiert ist.
Hendrik Dietz: „Was wir zunächst damit versuchen herzustellen, sind kleine Werkzeuge, mit denen ich wiederum mehr über gewisse Eigenschaften von Proteinen lernen kann. Zum Beispiel wollen wir herausfinden, wie stark gewisse Arten von Wechselwirkungen, die wir innerhalb von Proteinstrukturen finden, tatsächlich sind.“
Der Automotor leistet seine Arbeit, indem er Treibstoff wie Benzin oder Diesel verbrennt und dabei Wärme erzeugt. Das verbrannte heiße Gas dehnt sich aus. Der Motor bewegt sich und produziert eine Kraft. Auf diese Weise haben die fauchenden, stampfenden Ungetüme mit ihrer Arbeit die Welt verändert.
Doch die Konstruktionsprinzipien im Nanobereich sind völlig unterschiedlich. Molekulare Maschinen erzeugen auch eine Kraft – nur auf eine völlig andere Art, sagt Matthias Rief.
„Allerdings sind natürlich die Dampfmaschinen von ihrer Physik völlig verschieden von dem, was in einer Nanomaschine geschieht. Was machen Dampfmaschine oder Automotor? Da wird Brennstoff verbrannt, in Wärme umgesetzt und diese Wärme wird dazu benutzt, irgendwelche mechanischen Teile anzutreiben. Das könnten Sie in unserem Körper gar nicht machen. Wir sind konstant bei 37°. Alles andere nennen wir ungut, unterkühlt oder Fieber. Wir wollen eine konstante Temperatur haben und haben somit überhaupt nicht die Möglichkeit, Wärme zu nutzen, um direkt Maschinen anzutreiben.“
In einem Organismus wie zum Beispiel dem menschlichen Körper verbrennt also nichts. Es lodert auch kein Feuer wie in einem Ofen. Schlimm wäre, wenn es so wäre. Denn bei einem Feuer wird es heiß, es muss im Zaum gehalten werden. Das könnte ein lebender Organismus nicht.
Sehr hoch ist der technologische Aufwand beim Automotor, die Energie in Schach zu halten und sie kontrolliert in mechanische Bewegung umzuwandeln. Das gelingt nicht immer perfekt, wie Autos beweisen, die schon mal abbrennen können.
Der Organismus hat dagegen eine effektive Methode entwickelt, die Energie aus der Nahrung in sehr kleinen Einzelschritten abzubauen und sie etwa an den Muskelfasermolekülen abzuliefern.
Enzyme zerkleinern sie chemisch, zerhacken sie gewissermaßen in vielen einzelnen Schritten in immer kleinere Einheiten.
Der laufende Mensch – das Musterbeispiel einer gut funktionierenden Nanomaschine. Muskeln treiben ihn voran. Diese Muskeln wiederum bestehen aus Millionen kleiner Maschinen. Sie wandeln chemische Energie direkt in Bewegung um. Und deswegen sind die Prozesse, die in Nanomaschinen stattfinden, verschieden von sogenannten thermodynamischen Maschinen oder von Dampfmaschinen.
Die Muskelfaser zieht sich zusammen. Muskelarbeit kommt also dadurch zustande, dass die chemische Energie direkt in eine Änderung der Länge des Moleküls umgewandelt wird. Ein Molekül wird gespalten, das sogenannte ATP, ein universelles Instrument in jedem Organismus. Dann klappt ein Teil des Moleküls zurück und zieht einen Teil des Muskels mit. Matthias Rief: „Wenn das viele gleichzeitig machen, dann gibt es die Muskelbewegung.“
Die Muskelbewegung entsteht also, wenn ein winziges Molekül seine Form ändert.
Rief: „Konformationsänderungen, Formänderungen sind der Schlüssel wie Proteine in unserem Körper wirken.“
Verblüffend: Winzige Moleküle verändern ihre Form, und das erzeugt eine Muskelarbeit.
Doch diese Strukturen im Kleinsten sieht man nicht. Sie schwimmen in wässrigen Lösungen. Und nur mit Hilfe von raffinierten Tricks gelingt es Wissenschaftlern, zu überprüfen, daß die Maschinen im Kleinsten auch das gemacht haben, was sie sollen. Gar nicht so einfach.
Rief: „Ein ganz wichtiger Hinweis darauf ist der, dass wir genau wissen, wie lang dieses Protein sein soll. Wenn wir dran ziehen und es entfalten, dann wird es auch ausgestreckt sein. Aber es ist ganz genau definiert, wie viele Aminosäuren da drin sind. Sie können auf den Nanometer genau ausrechnen, wie lang die Kette ist.“
Schraubenzieher und Schraubenschlüssel – das sind die Werkzeuge des Maschinenbauers. Auch die Erbauer von kleinsten Maschinen benötigen Werkzeuge. Sie wollen ihre Stoffe ebenfalls greifen, festhalten und sie neu zusammenbauen.
„Wir brauchen Hände und müssen dieses Protein genau an einer definierten Stelle anzugreifen. Und wie schaffen wir das? Wir können chemische Gruppen an die Enden des Proteins einfügen. Das machen die Bakterien für uns. Und daran fügen wir mit einer synthetisch erzeugten DNA-Molekülen Handgriffe, die dann an Antikörpern, die auf unserem Molekül sitzen, angebunden werden, und so bekommen wir eine ganz genau designte Verbindungskette, nämlich eine mechanische, an der das Einzelprotein steckt, das dann genau untersucht werden kann.“
„Was wir machen, ist jetzt, diese Sequenzen geschickt genug zu wählen, damit die Struktur gebildet wird, die wir uns wünschen. Und nachdem sehr viel über diese Bindung bekannt ist, die Energie, die in den Bindungen drin steckt, kann sehr sehr gut vorher berechnet werden, können wir also die meisten Eigenschaften vorher berechnen. Von daher können wir bestimmen, wie sich nachher die DNA-Stränge in der Lösung zusammenfinden. Und mit einer sehr hohen Sicherheit machen die dann auch das, was wir uns wünschen.“
Protein-Molekül
Matthias Rief zeigt in seinem Labor im Kellergeschoß der Technischen Universität München die Apparatur, mit der er nachweist, dass Proteine tatsächlich das machen, was die Wissenschaftler wollen. Ein Versuchsaufbau aus der Optik. Grundlage ist eine sehr massive und schwere Platte, die schwingend aufgehängt ist. Keine Erschütterungen von vorbeifahrenden Lastwagen oder U-Bahnen sollen die Versuche stören. Schwarz ausgeschlagen und mit schwarzen Platten abgedeckt sind die Strahlengänge, Spiegel lenken Laserlicht. Dünne grüne und rote Punkte flimmern. Eine optische Falle, erklärt Matthias Rief.
„Wir sind Fallensteller, wenn Sie so wollen. Es ist eine Falle in dem Sinn, dass sie Kugeln einfängt. Also wir müssen unsere Proteine an irgendetwas dran binden. Das funktioniert über eine DNA, die am Ende über Glaskugel angebunden ist. Glaskugeln sind so Objekte, die man auch noch sehen kann in einem Mikroskop, und die müssen irgendwie manipuliert werden. Dazu nehmen wir Laserstrahlen.“
Mit dieser komplizierten Apparatur können die Wissenschaftler nachweisen, dass ein Molekül auch wirklich vorhanden ist. Denn sehen können sie nichts.
Jedes unterschiedliche Molekül hat eine bestimmte Länge. Wie mit einem Zollstock die Länge von Bausteinen bestimmt werden kann, so messen die Wissenschaftler die Länge der Moleküle und können so darauf schließen, um welche Moleküle es sich handelt.
„Ein Hinweis darauf, dass das, was wir angegriffen haben, auch wirklich in der optischen Falle sitzt, ist, dass diese Längenänderungen auf den Nanometer ganz präzise gleich sein müssen. Sie sehen also Entfaltungsübergänge, und irgendwann ist es ausgestreckt, dann können Sie abzählen, wie viel Aminosäure sie angegriffen haben. Sie können genau sagen, das kann nur dieses Protein sein, weil ein anderes Protein hätte dann wieder eine andere Länge.“
Die Wissenschaftler haben verschiedene Techniken entwickelt, die es erlauben, in den Nanowelten sogar Bewegungen der einzelnen Teilchen zu verfolgen. Sie benutzen dabei auch einen raffinierten Trick mit Hilfe von Farbstoffen.
„Das ist der Effekt, dass zwei Farbstoffe sich gegenseitig beeinflussen, wenn sie nahe zusammengebracht werden. Die Fluoreszenz eines Farbstoffes kann durch die Fluoreszenz eines anderen Farbstoffes reduziert werden, wenn die beiden sich sehr, sehr nahe kommen. Weil man die Abstandsabhängigkeit dieser Wechselwirkung kennt, kann man aus dem Fluoreszenz-Signal rückschließen, welche Abstände zwischen zwei Punkten auf so einer Nanomaschine existieren. Und damit auch die Bewegungen einer solchen Maschine verfolgen.“
Ein paar grüne, rote oder blaue Leuchtpunkte, die sich einen Hauch weit bewegen. Mehr ist es nicht, was die Wissenschaftler von ihren Forschungsobjekten sehen können. Nur mit solchen indirekten Methoden können sie verfolgen, was ihre Nanomaschinen machen. Wenn die näher zusammenkommen, leuchten die mehr rot, ansonsten gelb.
Rasterkraftmikroskop
Ohne eine sehr wichtige Erfindung, die vor 25 Jahren gemacht wurde, wären Nanotechnologien heute überhaupt nicht möglich. Erst mit diesem Gerät lassen sich Strukturen erkennen, die tausend mal kleiner sind als das, was ein Lichtmikroskop auflösen kann. Ein Rasterkraftmikroskop.
Eine wissenschaftliche Sensation war es, als 1981 die beiden Physiker Gerd Binning und Heinrich Rohrer am berühmten IBM-Forschungslabor bei Zürich das Rastertunnelmikroskop entwickelten. Sie führten eine sehr feine Spitze an einem Mikroskop extrem nahe an die Oberfläche.
Beide Atome – die der Probe und die der Spitze des Mikroskopes – sind von Elektronenwolken umgeben. Sobald sich beide nahe genug kommen, kann ein Elektron von der einen zur anderen Wolke wandern. Die beiden Forscher haben eine Spannung angelegt und konnten tatsächlich einen Stromfluss messen. Dieser Stromfluß verändert sich mit dem Abstand zur Probe. So schwenkten also die Spitze über die Probe und erhielten ein extrem genaues Abbild davon, wie die Atome auf der Oberfläche verteilt waren. Genauer gesagt: wie die Elektronenwolken der Atome verteilt waren. So genau konnte vorher noch niemand Atome beobachten. Für diese Leistung erhielten die beiden Forscher 1986 den Nobelpreis für Physik.
Doch Gerd Binning störte an der Tunnelmikroskopie, dass dafür immer ein, wenn auch geringer Strom fließen muss. Das ist für die meisten biologischen Systeme schädlich.
Daher kamen sie auf die Idee, direkt die Kräfte zwischen zwei Atomen zu messen. Mit einer feinen Feder, die im Idealfall ein Atom an ihrer Spitze hat, näherten sie sich langsam den obersten Atomen der Probe. Sie haben beim Annähern die Anziehungskräfte der beiden Atome messen können. So konnten sie jetzt die Oberflächen im atomaren Bereich abtasten und ein ungefähres Bild zeichnen.
Heute ist das sogenannte Rasterkraftmikroskop eines der wichtigsten Geräte für einen Blick in die Nanowelt: Damit können die Forscher Atome gewissermaßen ertasten.
Doch selbst Rasterkraftmikroskope können die kleinsten Nanostrukturen nicht darstellen, wie sich das Wissenschaftler wünschen. Daher warten sie dringend auf neue Mikroskopierverfahren, auf neue Superauflösungs-Mikroskopie-Methoden. Mit denen wird man in Bereich um die 100 Nanometer vordringen und kann wahrscheinlich die Bewegungen von DNA-Nanomaschinen anzuschauen.
Molekulare Maschine
Ihr Lieblingsmolekül, die DNA, kennen die Forscher mittlerweile sehr gut. Sie wissen, wo die negative Ladungen in dem Doppelstrang sitzen. Die Innereien sind eher ein bisschen hydrophob und versuchen sich vor der wässrigen Umgebung zu verbergen. Die beiden Doppelstränge werden von Wasserstoffbrückenbindungen zusammengehalten. Es gibt eine sogenannte Stapel-Wechselwirkung. Die zwei Basenpaare nebeneinander stabilisieren sich gegenseitig, und dadurch ist es ein Wechselspiel von physikalischen Kräften, die diese Struktur so zusammenhalten.
Eine solche Struktur bildet sich nur in einer bestimmten wässrigen Umgebung. Es müssen auch die entsprechenden Ionen vorhanden sein, die die Ladungen ausreichend abschirmen. Das Ganze funktioniert nur bei einer bestimmten Temperatur. Man weiß genau, wie stabil dieses Objekt ist und bei welcher Temperatur es auseinanderfallen würde. Man kann auch viele Aussagen machen über die mechanischen Eigenschaften einer solchen Struktur.
Simmel: „Zum Beispiel ist die DNA aber zu allem Überfluss auch noch eines der steifesten Polymere, die man finden kann, was natürlich besonders wichtig ist für die Konstruktion von Maschinen. Man braucht natürlich auch steife Maschinenelemente und auch flexible Elemente. Interessanterweise ist die doppelsträngige DNA viel steifer als die einzelsträngige DNA. Und genau diesen Umstand nutzen wir, indem einige dieser Maschinenteile eher doppelsträngig, andere eher einzelsträngig gewählt werden, damit die als flexible oder steife Elemente dienen.“
Versteckte Nanoroboter
Ein Blick in die Fabrikhalle eines Autoherstellers. Heerscharen von orangefarbenen Roboter stehen in der Halle, wirbeln ihre Arme durch die Luft, sind unermüdlich in Bewegung.
Sie greifen sich Blechteile, halten sie zusammen und schweißen sie zu Autokarosserien zusammen. Automatisch lackieren sie die Bleche, schrauben die Motoren ein. Am Ende spuckt die Fabrik dann fertige Autos aus. Das ist heute moderne effektive und kostengünstige Fertigung von Automobilen. Doch die Fertigung von Maschinen aus der Nanowelten sieht vollkommen anders aus.
Die Roboter der Nanowissenschaftler sind in Tanks und Reaktoren aus Edelstahl verborgen. Es sieht aus wie in einer chemischen Fabrik, und es ist auch eine kleine. Wir sind in einem sogenannten Technikum, der Vorstufe zu einer ausgewachsenen Chemiefabrik. Hier soll ausprobiert werden, ob das auch in einem größeren Maßstab funktioniert, was Forscher in ihren Reagenzgläsern entwickelt haben.
In solchen Anlagen könnten in Zukunft die Nanomaschinen hergestellt werden. Im Inneren dieser Tanks sollen Mikroorganismen arbeiten und große Mengen der Proteine ausspucken, die als Nanomaschinen wirken. Diese Mikroorganismen sind ebenfalls wie die Roboter der Autohersteller so programmiert, daß sie wissen, wie sie die Nanomaschinen zusammenbauen müssen.
Friedrich Simmel: „Also ein Ziel, das wahrscheinlich weiter in der Zukunft liegt, ist, dass man tatsächlich molekulare Motoren baut, die im künstlichen Nanofabriken Material transportieren von einem Punkt zum anderen. Das ist vermutlich dann eher Zukunftsmusik. Es ist aber doch ein sehr anregendes Ziel.“
Und hier kommt ein extrem verblüffender Begriff ins Spiel, der in der biologischen Nanotechnologie eine überragende Rolle spielt. Denn niemand sagt es, niemand schreibt es den Molekülen vor, was sie zu tun und wie sie zu arbeiten haben.
Und dennoch kommt ein neues Molekül heraus, das genau die Vorgaben erfüllt.
Woher weiß das Molekül, wie es sich verhalten soll?
Matthias Rief hält immer noch sein langes zusammengefaltetes Knäuel aus Draht in Händen: „Sie sehen hier viele Schlangenlinien. Diese Form bildet sich bei einem Protein von selbst. Niemand sagte dem Protein, was für eine Form es annehmen muss, es muss es selbst wissen. Und dieser Prozess der Faltung ist etwas, was wahnsinnig wichtig für die Funktion später ist. Das muss dann ein molekularer Motor sein, eine ganze Maschine. Wir studieren zum Beispiel von der entfalteten Kette, wie sich dieses Molekül spontan in die richtige dreidimensionale gefaltete Struktur auffaltet.“
Ein Protein ist nichts anderes als eine Kette aus verschiedenen sogenannten Aminosäuren. Das sind chemische Bausteine, von denen es nur 20 verschiedene gibt. Was sie tun sollen – das hängt davon ab, in welcher Reihenfolge die Bausteine angeordnet sind.
„Da können Sie sich vorstellen, da gibt es Aminosäuren, die wollen kein Wasser sehen, die sind ölig, die wollen ins Innere des Proteins. Dann gibt es solche, die gerne Wasser sehen, die sind außen, und die bestimmen dann außen und innen, und diese Regeln ergeben sich dann aus der Wechselwirkung dieser Aminosäuren untereinander.“
Die meisten Phänomene in organischen Zellen und Proteinen lassen sich auf erstaunlich einfache physikalische Vorgänge reduzieren. Anziehungs- und Abstoßungskräfte spielen eine wesentliche Rolle. Das Geheimnis liegt in ein paar verblüffend einfachen Regeln: Moleküle können etwa am einen Ende wasserabstoßend sein, am anderen Ende umgekehrt. Schon organisieren sich diese Moleküle millionenfach nach denselben Regeln.
Wasser- oder fettliebende Seiten von Molekülen lassen schon einmal Millionen von Strukturen sich gleichartig ausrichten.
„Hier spielen sehr viele unterschiedliche Forschungsthemen und Bereiche rein, physikalische Chemie spielt eine Rolle, Biochemie, aber auch bis zu einem gewissen Grad auch mechanische Überlegungen. Also man kann es bis zu einem gewissen Grad sogar Formeln anwenden, die man eigentlich eher aus der technischen Mechanik kennt. Also aus der Mechanik von makroskopischen Objekten.“
Selbstorganisation
Mittlerweile drehen sich in den Laboratorien der Forscher die ersten kleinsten Strukturen – gebaut aus DNA-Molekülen. Zum Beispiel ein kleiner Motor, ein paar Nanometer groß. Kein Werkzeug ist dafür angefaßt worden, um es herzustellen. Das haben die Proteine selbständig gemacht.
Allein durch sogenannte „Selbstorganisation“.
Dietz vergleicht es mit dem Bau eines Autos. Sämtliche einzelnen Teile, aus denen es besteht, werden in einen Wasserbottich geworfen, auf eine bestimmte Temperatur gebraucht und umgerührt. Plötzlich setzt sich das Auto von selbst zusammen.
Zusammengerührt, fertig – zack!
Wahrhaft verblüffend sind die Leistungen dieser kleinsten Maschinen der Welt: Diese Mini-Motoren drehen sich mit 100.000 Umdrehungen pro Minute. So schnell bewegen sich in der gewohnten Welt die Turbinen eines Flugzeuges.
Solche Maschinen haben wir alle milliardenfach in uns: In jeder einzelnen Zelle des Körpers erzeugen sie Energie, bei jeder Umdrehung genau drei Moleküle des Energieträgers ATP. Das macht im Laufe eines Tages eine ganze Menge aus: etwa 50 bis 60 Kilogramm pro Tag müssen die Zellen in unserem Körper erzeugen, damit wir uns bewegen können.
Unglaubliche Leistungen der Nanomaschinen, die Wissenschaftler ganz neidisch machen: „Unsere langfristig Zielsetzung ist, dass man autonome molekulare Systeme erzeugt – manche nennen es dann auch gerne Nano-Roboter – also autonome Systeme, die von selbst entscheiden, welche Bewegungen sie durchführen, welche chemische Reaktionen sie im Moment kontrollieren.“
Die Wissenschaftler sind gerade dabei, die Konstruktionsregeln zu verstehen, nach denen die Natur baut. Sie haben gerade die Türen aufgestoßen in eine faszinierende neue Welt, in der es Maschinen gibt, von denen die Menschheit bis vor Kurzem noch überhaupt nichts wußte.
Jetzt dürfen Sie gedanklich wieder zurückreisen aus den fantastischen Welten tief im Inneren Ihrer Zellen und sich noch viel mehr in der Wissenschaftsdokumentation „Kraftwerk Körper“ anschauen, was Sie noch nicht wußten.