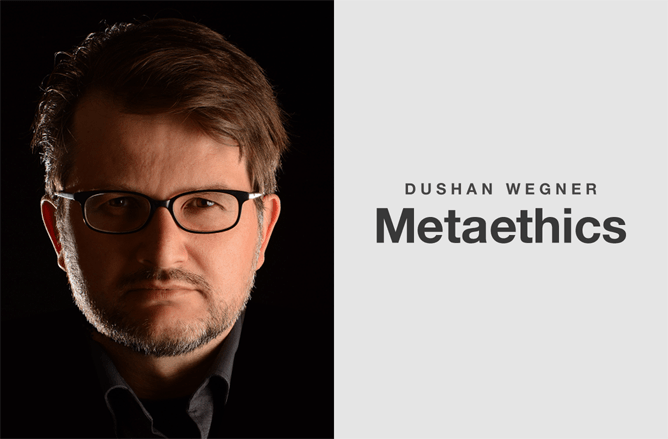Erinnern Sie sich, als Robin Williams starb? Oder Steve Jobs? Manche von uns können sich sogar erinnern, wo sie waren, als sie hörten, dass John F. Kennedy ermordet wurde.
Es gibt Menschen, die sind so voller Leben, dass ihr Tod eine greifbare Lücke in die Welt reißt. Es ist eine Eigenschaft der Großen, aus der Nähe zerbrechlich und zerrissen zu wirken, doch aus der Entfernung, aus dem Publikum heraus, überlebensgroß zu scheinen. Michael Ende nannte das die »Scheinriesen«.
Vielleicht sind alle Großen in Wahrheit »Scheinriesen«.
Wenn diese Großen plötzlich dann aber nicht mehr sind, aus diesem Grund oder jenem, dann bleibt eine Zeit lang ein Vakuum auf der Bühne. Es raubt uns, diese Zeit lang, die Luft. Natürlich, wir arrangieren uns. Doch die Erinnerung bleibt. Die Großen fehlen, wenn sie gehen.
Es gibt eine neue Art von Tod, den die Großen sterben können. Es ist das Verstummen in den sozialen Medien, der Social Media Death. Heimtückisch ermordet von Social Media Warriors. Sie sterben nicht, weil er oder sie nichts mehr zu sagen hätte, sondern weil höhere Mächte befahlen, dass er oder sie nichts mehr sagen darf. Zumindest nicht über die Kanäle und auf den Plätzen, auf denen der Rest von uns miteinander kommuniziert. Ein Klick in den Machtzentralen des Zensors genügt, und ein Großer verschwindet ins digitale Gestern.
Vor wenigen Tagen ist Milo Yiannopoulos auf Twitter verstummt. Sein Vergehen: Er war einigermaßen unhöflich zu Schauspielerin Leslie Jones.
Alles hat einen Hintergrund, auch dies. Leslie Jones ist eine mäßig erfolgreiche US-Komödiantin. Sie ist auch Schauspielerin in der feministischen Neuauflage des Klassikers »Ghostbusters«. Der Film ist durchschnittliche, solide Popcorn-Ware. Im Vorfeld aber wurden der Film und seine Darstellerinnen heftig kritisiert. Auch von Milo Yiannopoulos. Sein derbster Spruch war, sinngemäß, Leslie Jones sei ein »schwarzer Kerl« (»black dude«). Jones, empört, wandte sich direkt an Twitter. Sie habe ja nichts gegen Meinungsfreiheit, aber diese müsse auch Grenzen haben. Gut, viele von uns wenden sich an Twitter, indem wir @twitter in unsere Tweets schreiben. Die weitaus meisten von uns werden aber ignoriert, klar. Jones jedoch wurde vom Twitter-Chef persönlich kontaktiert. Ergebnis: Der Account von Yiannopoulos wurde abgeschaltet. Weil er Jones belästigt hatte, trotz Warnung, es nicht zu tun.
Die Sache hat nun ein übles Geschmäckle. Der Chef von Twitter, Jack Dorsey, ist relativ offen in seiner Unterstützung von »Third Wave Feminismus« und »Black Lives Matter«. Er sagt, er wolle zivilisierte Umgangsformen auf Twitter durchsetzen. So zweischneidig dieses Ansinnen sein kann: Würde es ausgeglichen angewandt, könnte es auf seine eigene Weise fair sein. Doch es stimmt nicht, was Dorsey sagt. Extremistische Feministinnen rufen regelmäßig via Twitter dazu auf, Männer zu töten.
(Sie können ja mal nach »kill all men« auf Twitter suchen.) Wenn Extrem-Feministinnen milde gestimmt sind, beschränken sie sich darauf, ihre Gegner ob vorgeblich unzureichender Größe des Gemächts zu beschimpfen. Extremistische Anhänger von »Black Lives Matter« rufen immer wieder zum Mord an Weißen auf. Wenn sie mal milde sind, begnügen sich jene Aktivisten damit, »Weißer« als Schimpfwort zu benutzen. So wie es Leslie Jones selbst tat, wieder und wieder. Sie drohte auch mal Schwarzen mit Gewalt, wenn sie sich neben weiße Frauen setzten. Sie forderte ihre Follower auf, ihre Gegner fertigzumachen – »get her!«. Kurz: Sie postete rassistischen Hass und hetzte Menschen gegeneinander auf. Aber sie ist Feministin. Für sie braucht es einen Tweet an Twitter und ihr Gegner, Milo Yiannopoulos, wird zum Schweigen gebracht. Schöne neue Welt der sozialen Medien. Orwell und Maas schießen beiden die Tränen in die Augen, wenn auch vielleicht aus unterschiedlichen Gründen.
Nun mögen manche sagen: Moment, hat der Milo Yiannopoulos nicht tatsächlich etwas »Böses« gesagt? Eindeutige Antwort: Jein. Im Kontext vielleicht sogar: Nein.
Sicher, seine Anhänger mögen Grenzen austesten. Doch genügt das, einen Menschen zum Verstummen zu bringen? Sind wir wirklich soweit, »Rädelsführer« zu eliminieren? Häuptling erledigen, um den Stamm zu lähmen? Und selbst wenn das der neue Usus in den sozialen Medien wäre, wieso werden vorwiegend Konservative abgesägt, während man als Feministinnen verkleidete Extremisten in die Zentralen einlädt, um den Chef zu »beraten«? Twitter hat tatsächlich den dystopisch betitelten »Twitter Trust & Safety Council« eingesetzt, wo eine Auswahl von Lobby-Organisationen mitentscheidet, was auf Twitter gesagt werden darf. Es sind seriöse Organisationen darunter, aber auch Gruppen wie »Feminist Frequency«, deren Personal regelmäßig Gegner sexistisch angreift.
Reden wir lieber, im fröhlichen Kontrast, von Milo Yiannopoulos. Er ist eine jener Figuren, die man »schillernd« nennt. Er »schillert« tatsächlich, inhaltlich wie optisch.
Yiannopoulos ist schwul. Wieso das erwähnenswert ist? Stellen Sie sich den fröhlichsten Wagen beim Christopher Street Day vor. So ungefähr ist Yiannopoulos – nur das ganze Jahr über. Politisch gesehen ist er stockkonservativ. Er nennt Donald Trump liebevoll »Daddy«. Er veranstaltet Events wie »Gays for Trump«. Er machte den Slogan »Feminism is Cancer« berühmt. (Eine Adaption des »white race is the cancer of human history« von Susan Sontag, das auf Twitter als »white people are cancer« recht häufig wiederholt wird. Nicht nur selbstkritisch von Weißen. Es ist aber nicht bekannt, dass ein Account dafür verschwinden musste.) Diese Kombination aus schwul und konservativ macht »progressive« Aktivisten rasend. Das weiß er. Das will er.
Yiannopoulos reist durch die USA unter dem Tour-Titel »Dangerous Faggot Tour«. Ich übersetze das mal nicht. Es ist vulgär. Es ist trotzig. Man spricht darüber.
Yiannopoulos hat eine öffentliche Persona geschaffen. Er spielt mit Klischees, wie ein Junge, der zwei Modellzüge lustvoll ineinander krachen lässt. Je mehr Schaden an den Zügen, um so mehr Spaß. Yiannopoulos adaptiert das Abziehbild vom flamboyanten New-York-Schwulen, bis hin zum »gebrochenen Handgelenk«. Und er ist unglaublich charismatisch dabei. Kaum hat er sich aber dieses Leit-Klischee übergezogen, bricht er es wieder. Er posiert mit schweren Waffen.
Er geht auf Bühnen und erklärt die Unterschiede zwischen dem traditionellen Feminismus und dem modernen »Third Wave Feminismus«, wie wir ihn auf Twitter, Tumblr und in schlechten Talkshows erleben. Für Yiannopoulos ist dieser neue Netz-Feminismus de facto ein von Lügen und Hass gespeister anti-freiheitlicher, anti-intellektueller, global agierender gefährlicher Mob. Yiannopoulos ist kein Freund der »Social Justice Warriors«, dieser humorlosen Moralprediger der Netze. Yiannopoulos bewertet, sagt er, einen Menschen nach dessen Handlungen und Worten, nicht danach, wie jener sich gerade zu »identifizieren« geruht. Yiannopoulos formuliert einen bitteren Gedanken: In Zeiten von »Safe Spaces« und »Trigger Warnings« verlassen manche Studenten die Uni dümmer, als sie hineingegangen sind. Das ist neu.
Vor allem aber: Yiannopoulos macht Wahlkampf für Donald Trump. (Yiannopoulos wurde übrigens in Griechenland geboren und ist in Großbritannien aufgewachsen. Er hat die griechische und die britische Staatsbürgerschaft. Und er ist »Posterboy« des liberalen Konservatismus in den USA.) Das macht ihn zum Hassobjekt der toleranten Klasse.
Wie war es denn aber nun mit dem »schwarzen Kerl«, als welchen Yiannopoulos seine Debatten-Partnerin titulierte? Nun, es hatte eine Vorgeschichte. (Hat nicht alles eine Vorgeschichte?)
Ein Fan von Frau Jones schrieb, dass Yiannopoulos der »Onkel Tom der Schwulen« sei. Eine üble Beleidigung, rassistisch dazu. Jones retweetete das, machte es sich zu eigen. Daraufhin schrieb Yiannopoulos: »wieder von einem schwarzen Kerl abgelehnt.« (»rejected by yet another black dude«) Jones nahm den Retweet zurück. Erst log sie, ihr Account sei einen Tweet lang gehacked worden. Dann nahm sie die Lüge wieder zurück. Die Aufregung des Krieges, nehme ich an. Ohne in Details zu gehen, kann man sagen: Yiannopoulos ist kein Rassist. Bei Frau Jones ist das nicht so sicher.
Es ist nicht möglich, Yiannopoulos zu erleben und »neutral« zu bleiben. Sein Auftritt will Provokation sein. Er ist darin sehr erfolgreich.
Linke Studenten-Organisationen in den USA ziehen viele Strippen, bis hin zur Androhung gewaltsamer Demonstrationen, um seine Auftritte an Universitäten zu verhindern. Tief innen drin fühlen sich einige seiner Gegner dann doch schlecht dabei, einem bekennenden Schwulen das Recht auf Meinungsäußerung entziehen zu wollen. Doch sie gehen nicht in sich. Ihre Reaktionen auf die eigene Dissonanz ähneln verblüffend denen gewisser religiöser Fanatiker: Sie wenden das Unwohlsein bezüglich der eigenen Zerrissenheit nach außen.
Was an Yiannopoulos »polarisiert«, sind nicht unbedingt nur die »kontroversen« (was heißt das heute schon?) politischen Meinungen. Es sind nicht nur die erwartbaren Aufreger wie sein T-Shirt mit dem Aufdruck »STOP BEING POOR«. Es ist seine plakative Lebensfreude, die in schmerzhaftem Kontrast zur Misanthropie seiner Gegner steht.
Ich empfehle, sich auf YouTube einige Yiannopoulos-Videos anzuschauen, dann auf Facebook seine Fotos. Sie werden einen Menschen erleben, der »larger than life« ist. Ganz egal, wie man zu seinen politischen Positionen steht (und unabhängig davon, wie viele seiner Positionen mehr Teil der Persona als des realen Menschen sind), Yiannopoulos ist ein Mensch, der »Leben« ausstrahlt. Das ist, so meine These, einigen seiner Gegner unerträglich.
Was ich Ihnen nicht empfehlen kann, weil es das schlicht nicht mehr gibt, ist sein Twitter-Stream. Yiannopoulos wäre ohne Twitter kaum zu seinem Ruhm gekommen.
Es war Twitter, wo er täglich mit seinen Fans und Followern kommunizierte. Darin ähnelte er Trump, seinem »Daddy«. Über Twitter motivierte und koordinierte er die von ihm ins Leben gerufene und mit Leben gefüllte Bewegung. Sein Twitter-Account mit dem so eleganten wie, wieder einmal, provozierenden Handle @nero wurde abgeschaltet. Vom Twitter-Chef persönlich. Nachdem eine latent rassistische Feministin sich über ihn beschwert hatte.
Als sie Yiannopoulos abschalteten, fühlte sich Twitter plötzlich trauriger an. Natürlich weiß ich, dass der Mensch Milo Yiannopoulos weiter lebt. Doch die Stimmung erinnert, ein kleines Stück weit, an jenes Bauchweh, das einen ergreift, wenn ein »larger than life«-Mensch stirbt. Die Welt ist ärmer und farbloser geworden. Zensur macht unsere Welt trauriger.
Die westliche Kultur entwickelt sich gerade zurück. Die öffentliche Debatte wird dümmer, sie infantilisiert. Ich erlaube mir, Menschen, die sich selbst nicht reflektieren, »freiwillig dumm« zu nennen. Social Justice Warriors und religiöse Fanatiker eint die Weigerung, über sich selbst nachzudenken, sich zu prüfen und zu korrigieren. Wer aber sein Selbst nicht reflektiert, dessen Selbstbild ist notwendigerweise fragil. Die noch so kleinste Frage wird sein Selbstbild angreifen – er weiß ja nichts über sich. Eine »Beleidigung« ist ein wirksamer Angriff auf mein Selbstbild. Ein in sich ruhender, reflektierter Menschen ist nur schwer zu beleidigen. Er ist wie die Wasseroberfläche, die auf einen Stein mit ein paar Wellen reagiert, dann aber bald wieder zur Ruhe kommt. Dem unreflektierten, jede Selbsterkenntnis fanatisch bekämpfenden Individuum dagegen kann die kleinste Frage schon Beleidigung sein. Und es ist noch nicht einmal notwendig, dass die Frage tatsächlich gestellt wurde. Sie kann sich auch von selbst ergeben. Deshalb verlangen gewisse neue Bewegungen »Trigger Warnings« auf Büchern. Deshalb richtet man »Safe Spaces« ein, intellektuelle Gummizellen, in die sich Unreflektierte freiwillig selbst einweisen.
Politik und Internet-Konzerne haben begonnen, diese neuen Dummheits-Kulte für ihre ganz eigenen Zwecke einzusetzen. Sie laden ihre Vertreter als Berater ein. Sie finanzieren sie mit Millionenbeträgen (deren Verbleib nicht immer ganz klar ist). Sie scheinen sie mit legislativer, jurisdikativer und exekutiver Gewalt an den dazu eigentlich bestimmten Staatsorganen vorbei zu versehen (Stichworte: Maas, Amadeu Antonio, Facebook, Taskforce).
Diese schöne neue Welt mag nun rechtsphilosophisch problematisch sein. Doch es ist ein anderer Punkt, auf einer anderen Ebene, der mir fast noch mehr Sorgen bereitet.
Eine zensierte Welt ist eine freudlose Welt. Wollen wir wirklich in einer Welt leben, in der alle Kunst und Debatte von Menschen zensiert wird, die eigentlich nur sich selbst hassen, diesen Hass aber auf die Außenwelt projizieren? Wollen wir in einer Welt leben, in der nur solche Meinung gesagt werden darf, die auch den fragilsten Safe-Space-Bewohner nicht »triggert«? Wollen wir in einer Welt leben, in der nicht das »bessere Argument« im habermasschen Sinne sich durchsetzt, sondern die am larmoyantesten vorgetragene Anklage?
Nein. Die Welt der neuen Zensoren wäre ein freudlose, dunkle Welt. Ich aber will die Verrückten feiern! Ich will mich über die Abgedrehten so richtig schön aufregen! Ich will eine fröhliche Kultur, in der von mir aus ein platinblond gefärbter Grieche mit Perlenschmuck und einer AK-47 posiert, allein, weil es so schön die Erwartungen aufbricht. Ein Tag, an dem meine Grundannahmen nicht hinterfragt wurden, ist ein verlorener Tag. Zu leben bedeutet auch, zu lernen. Wer sich nicht hinterfragt und sich nicht täglich hinterfragen lässt, der lebt doch nicht wirklich.
Kritiker zu vergiften oder verschwinden zu lassen ist altmodisch – heute werden einfach ihre Accounts abgeschaltet. Doch Twitter ohne Milo Yiannopoulos aka @Nero ist freudloser, trauriger und weniger lebensfroh. Das ist das Werk der Social Justice Warriors, der neuen Zensoren und ihren Freunden an den Schalthebeln der Meinungsmacht.
Uns, als Individuen und als denkende Gesellschaft, stellt sich nun eine simple Frage: Finden wir uns mit der Zensur ab – oder feiern wir das Leben?
Inhaltlicher Nachtrag
Eben wurde bekannt, dass Tichys-Einblick-Autorin Anabel Schunke von Facebook mit einem »dreitägigen Bann« bestraft wurde. Sie hatte es mit der Online-Regierungskritik überzogen. Es ist eine »virtuelle Gefängnisstrafe«. Früher wurden Menschen in den Kerker geworfen, damit sie niemand mehr hörte. Oder ihnen wurde gleich die Zunge herausgeschnitten. Heute gibt es Online-Sperren. Wenigstens gab es bei Kerker und Zunge noch das Schauspiel eines Gerichtsverfahrens. Heute entscheiden private, mit Stiftungen und Politikern verbandelte Firmen. In Dunkelheit und ohne Rechenschaft abzulegen, beratschlagen sie, wen sie verschonen – und wen sie strafen, um hunderte zu erziehen.
Technischer Nachtrag
Gegen die neue Zensur gibt es alte, wirksame Werkzeuge. Sie erfordern aber Kompromisse im Komfort und ein Minimum an Technik-Tüftelei.
Ich bin ja selbst gern auf Twitter. Doch ich bin mir dessen bewusst, dass alle, die keine »Social Justice Warriors« sind, beim Twitter des Jahres 2016 nur geduldete Gäste sind. Twitter ist freie Rede auf Abruf. Auf Facebook ist es ähnlich. Es macht Spaß, teilzunehmen. Man sollte aber vorbereitet sein, jederzeit abgeschaltet werden zu können.
Gerade heute wird wieder die Bedeutung des wichtigsten Werkzeugs der Meinungsfreiheit seit der Gutenberg-Presse sichtbar: Das gute alte WordPress, natürlich in der selbst gehosteten Variante. Wer seine Meinungsfreiheit in der vollen von Gesetz und Gerichten erlaubten Spannbreite ausleben will, kommt nicht daran vorbei, auf eigene Faust einen Blog zu installieren. (Ich selbst dopple übrigens alle meine Beiträge auf http://dushanwegner.com, leite aber auf Tichys Einblick weiter.)
Wessen Meinung über »Ein Hurra auf die politische Korrektheit« hinaus geht, oder in Zukunft hinausgehen könnte, der sollte sich (wieder?) mit selbst gehostetem beschäftigen. Ja, es ist anstrengender als ein schneller Tweet oder ein Status-Update auf Facebook. Aber es ist sicherer gegen die Launen der Meinungsdirigenten. So viel Arbeit sollte einem die praktische Meinungsfreiheit wert sein. Es geht, vergessen wir das nicht, um das Leben selbst, in all seiner Verrücktheit.