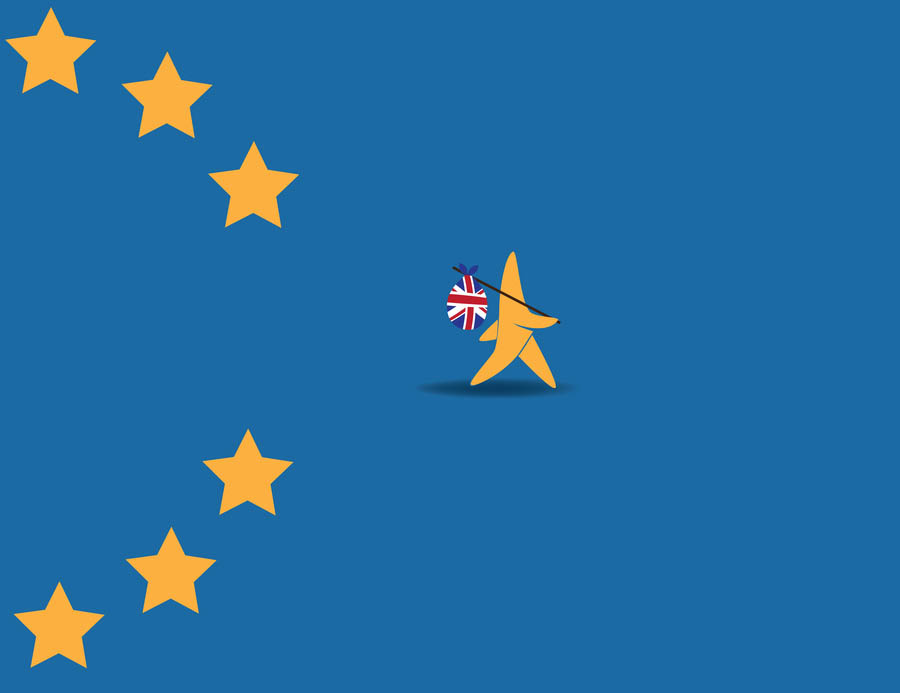Als die Brexit-Gefechte im britischen Unterhaus an der Jahreswende 2018/19 ins Absurde abzugleiten drohten, meldete sich auch Queen Elizabeth II. zu Wort. Mit der Mahnung, nicht das „größere Bild“ aus den Augen zu verlieren, hatte sie genau das zum Ausdruck gebracht, was in dieser verfahrenen Lage zu sagen war. Wenn im Nachhinein konstatiert werden muss, dass der Appell der Königin ihre Adressaten offensichtlich nicht erreichte, gilt das nicht nur für ihre eigenen Landsleute sondern auch für die Brexit-Verhandler der EU jenseits des Kanals. Und dies in mehrfacher Hinsicht.
Zum einen wurde der Brexit aus Brüsseler und Berliner Sicht von Anfang an als feindseliger Akt der Briten gegen die EU eingestuft, obgleich er auch eine Reaktion auf spröde Verschlossenheit und arrogante Selbstgerechtigkeit der Kontinentaleuropäer war. David Cameron, der damalige Premierminister bemühte sich vergeblich um ein Einlenken seiner 27 Kollegen in einer Frage, die von einem deutschen Spitzenpolitiker nicht zu Unrecht als „Mutter aller Probleme“ bezeichnet worden war. Nachdem Großbritannien stets an seiner liberalen Einwanderungspolitik für Zureisende aus dem Commonwealth, selbst unter zunehmender Gefährdung der inneren Sicherheit festgehalten hatte, brachte die Entscheidung der Bundesregierung vom September 2015 zur Öffnung der deutschen Grenzen für Massenzuwanderung aus den Kriegs- und Krisengebieten des Nahen Ostens sowie aus dem Balkan das Fass zum Überlaufen.
Als Nötigung wurde nicht nur im Vereinigten Königreich empfunden, dass eine von Deutschland zunächst als kurzfristig deklarierte humanitäre Nothilfe in dauerhafte Zuteilungsprozeduren für Flüchtlingskontingente aus überwiegend muslimischen Regionen Vorderasiens und Afrikas überführt werden sollte. David Cameron drang mit seinem Ansinnen nicht durch, angesichts der besonderen Bedingungen auf den britischen Inseln Sonderregelungen im Bereich der Personenfreizügigkeit für sein Land auszuhandeln.
Hans-Olaf Henkel, ehemaliger IBM-Deutschland-Chef und Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie sowie Mitglied des Europaparlaments, ist überzeugt davon, dass es keine Mehrheit für den Brexit gegeben hätte, wenn die EU-Partner den Briten bei dieser für sie existenziellen Frage entgegengekommen wären. Eine Reihe von Indizien sprechen dafür, dass es für die meisten Briten bei der Brexit-Abstimmung tatsächlich nicht um ein schlichtes Votum pro oder kontra Zugehörigkeit zur EU ging, sondern um etwas ganz anderes: Um Zurückweisung des deutschen Führungsanspruchs in der europäischen Migrationspolitik. Wie der Direktor des britischen Thinktank der Universität Buckingham, der deutschstämmige Prof. Anthony Glees zu Protokoll gibt, ist weiten Teilen der nicht-britischen europäischen Öffentlichkeit offenbar verborgen geblieben, was eine kritische Mehrheit seiner Landsleute beim Referendum tatsächlich im Innersten bewegte: „… dass die Frage nach dem Brexit im Kern eine Frage nach der Souveränität ist!“
Durch dieses Narrativ betrachtet liegt das eigentliche Problem des Brexit im weitgehenden Unverständnis der Kontinentaleuropäer für die tieferliegenden Motivationskräfte der Briten bei ihrer Entscheidung. Das gilt vor allem für die Deutschen, die nach Holocaust und zwei verlorenen Weltkriegen ein derart gebrochenes Verhältnis zu ihrem Land und zu ihrer Geschichte haben, dass sie einen Identitätswechsel in Richtung eines „europäischen Nationalbewusstseins“ vollzogen haben. Wobei ihnen das Verständnis für unveränderte Fixierung ihrer Nachbarn auf nationale Interessen in Kernfragen auch in einer Gemeinschaft wie der EU offenbar abhanden gekommen ist.
Damit dürfte sich diese „Seinsvergessenheit“ der Deutschen in Bezug auf ihre nationale Identität zu einem mindestens gleich großen Störfaktor für den Zusammenhalt in der EU entwickelt haben, wie dies dem Brexit der Briten oder manch störrischem Auftreten anderer Mitgliedsländer in ähnlichen Zusammenhängen zugeschrieben wird. Denn diese sich selbst angemaßte „Sonderrolle“ nährt (nicht nur bei den Briten) den Argwohn all derer, die hinter den Bemühungen um eine „Vertiefung“ der EU zu einer Politischen Union das versteckte Hegemonialstreben eines „Heiligen Europäischen Reiches deutscher Tonalität“ fürchten, zumal dieses mit „moralischem Imperativ“ untermauert bei der Zulassung illegaler Massenzuwanderung bereits sehr nachdrücklich praktiziert worden ist.
Wer auch nur eine gewisse Vorstellung von Völkerpsychologie hat, mag vor diesem Hintergrund die Seelenqualen mancher Briten nachvollziehen können:
- sich einerseits der EU als liberalem Binnenmarkt mit gemeinschaftlichen sozialen Standards und einem geteilten humanitären Wertekanon als Folge gemeinsamer Geschichtserfahrungen zugehörig zu empfinden
- aber andererseits nicht über den Schatten eines über die Jahrhunderte hinweg gewachsenen Bewusstseins nationaler Souveränität und Identität („Britains never shall be slaves!“) springen zu können.
Die exzellente deutsche Englandkennerin Gina Thomas hat auf dieses Grunddilemma verwiesen, indem sie den frustriert zurückgetretenen Brexit-Minister David Davis zitierte, der denen, „die glaubten, dass sich Britannien herumkommandieren lasse“, empfahl, „einige Geschichtsbücher zu lesen“. Und der dem spezifischen Selbstwertgefühl der Briten in dem Stolz darüber Ausdruck verlieh, „dass eine kleine Insel vor der Nordwestküste Europas mit weniger als einem Prozent der Weltbevölkerung so mächtig, so erfolgreich, so einflussreich, so wirksam, offengesagt, so großartig ist“.
Die ganze Verbitterung des überzeugten Europäers und Deutschlandfreundes Anthony Glees über eine die ureigenen Interessen Europas aus den Augen verlierende Politik schwingt mit, wenn er von den verlässlichen Regeln spricht, die eingehalten werden müssen, wenn ein politisches Gefüge wie die EU zum Wohle aller seiner Mitglieder funktionieren soll: „Auch wenn Frau Merkel für ihre Grenzöffnung hohe humanitäre Motive gehabt haben mag, so hat sie diese gemeinsamen demokratischen Regeln doch eigenmächtig aufgehoben und damit die EU ins Chaos gebracht. Und ein Teil dieses Chaos, da bin ich mir sicher, ist leider auch das Pro-Brexit-Votum, unter dem Großbritannien seitdem so sehr leidet.“
Der „andere“ bisher ausgeblendete Teil dieses Chaos, so könnte man den Gedankengang von Anthony Glees vervollständigen, besteht darin, dass die Abkehr der Briten vom kontinentalen Europa dort überhaupt nicht als jene existenzielle Erschütterung der Europäischen Union wahrgenommen wird, die diese seit dem Zweiten Weltkrieg einzigartige historische Errungenschaft zur Zeit tatsächlich durchlebt. Die Sichtweise der nicht-britischen Europäer, den Brexit als isoliertes britisches Problem zu sehen, das der spinnerten und überdrehten Denke eines introvertierten Inselvolkes zuzuschreiben sei, erweist sich in dieser weitergefassten Betrachtung als tragische Fehleinschätzung.
Dabei unterliegt einem fatalen Irrtum, wer die negativen Folgen des Brexit eher auf Seiten der Briten als auf der der verbleibenden EU vermutet. Fakt ist, dass der Austritt der Briten, der dem Auszug von 19 der mittleren und kleineren Mitgliedsländer der EU entsprechen würde, einem kaum zu verkraftenden Einbruch an Wirtschaftskraft der Union gleichkäme. Noch stärker würde der geostrategische und sicherheitspolitische Bedeutungsverlust zu Buch schlagen, wenn eine der beiden Atommächte und die zweitgrößte Militärmacht der NATO die Union verließe und Europa nicht mehr am ständigen Sitz des Vereinigten Königreichs im UN Sicherheitsrat partizipieren könnte.
Damit ist noch gar nicht auf die Gefahren hingewiesen worden, die Deutschland und seiner liberalen Wirtschaftsordnung in einer um Britannien ärmeren EU drohen: eine markante Schwächung des gesamten liberalen Nordens gegenüber einer sich systemverändernd bewegenden Machtbalance in Richtung des sozialistischen Südens, weil die im Lissaboner Vertrag festgelegte 35prozentige Sperrminorität der Nordländer gegenüber den finanziellen Begehrlichkeiten der Südeuropäer ohne die Briten entfallen würde.
Die Reise des deutschen Gulliver nach Europa, die mit so vielen Hoffnungen auf Wohlstand und Frieden für den nach all den Kriegen gepeinigten Kontinent verbunden war, liefe Gefahr, in den Fesseln der neu gewichteten Mehrheitsentscheidungen der Südländer zu enden. Mit gemeinsamen EU-Steuern, gemeinsamer EU-Arbeitslosenversicherung und einem gemeinsamen EU-Finanzminister könnte der langgehegte Plan des von seinen Gelbwesten geplagten Präsidenten Macron nunmehr zur Umsetzung gelangen und Gulliver zu jener umverteilungsbereiten Kapitulation zwingen, der er im Verein mit den liberalen Briten noch hatte widerstehen können.
Bei einer vollständigen Verlustbilanzierung des Brexit aus deutscher Sicht würde es der Bundesregierung gut anstehen, außer den gravierenden wirtschaftlich-materiellen Einbußen und negativen sicherheitspolitischen Folgen die geistig-kulturelle Dimension dieses weltpolitischen Vorgangs im Blick zu behalten. Die Bundeskanzlerin hat nicht zu erkennen gegeben, dass sie den Besuch des britischen Thronfolgers Prinz Charles in diesen Zusammenhängen gesehen hat. Auch wenn der Hohe Gesandte der Queen mit keinem Wort auf die den Brexit mit auslösende migrationspolitische Kontroverse einging, hat er sich dieses Themas doch auf seine Art umso nachdrücklicher angenommen. So hat er nicht von ungefähr an seinen deutschen Ur-Ur-Urgroßvater Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha erinnert, der in der britischen Königsfamilie eine starke „Affinität zur deutschen Kultur“ hinterlassen habe. Dessen Eingedenk gab er seinem Wunsch Ausdruck, „diese Gemeinsamkeit über nationale Grenzen hinweg zu bewahren“. Es klang wie eine Beschwörung, als er an die politischen Klassen beider Länder appellierte, „dass wir uns, nachdem unsere Völker gemeinsam so viel durchgestanden haben, versprechen werden, uns noch stärker füreinander und für die Bande zwischen uns einzusetzen“.
Man hätte sich in dieser Situation einen Kanzler Kohl zurückgewünscht, der mit seinem ausgeprägten Geschichtsbewusstsein jene Antwort auf die Bekundung enger Zusammengehörigkeit hätte geben können, die die amtierende Kanzlerin leider vermissen ließ. Und hätte es, um diesen Gedanken in Richtung einer realpolitischen Perspektive weiterzuspinnen, nicht nahegelegen, diesen „Pulse of Europe“ des britischen Thronfolgers für einen genialen Einstieg in einen Lösungsansatz zur Überwindung der europäischen Agonie zu nutzen, um die allseitigen Forderungen nach einem Reformschub mit der Schaffung eines neuen Bedingungsrahmens für den Verbleib der Briten in der Union zu verbinden?
Österreichs Kanzler Kurz hat beim jüngsten Treffen des Europäischen Rats in Rumänien erneut vorgeschlagen, eine Verfassungsreform in Angriff zu nehmen. Er hat sich zum Sprecher einer nicht kleinen Zahl von Mitgliedsstaaten gemacht, die im Sinne des britischen Aufbegehrens ein Ende der „Bevormundung“ Brüssels auf all jenen Feldern fordern, auf denen den Menschen vorgeschrieben wird, wie sie zu leben haben. Gleichzeitig wächst angesichts der Zuspitzung der Sicherheitslage im Nahen und Mittleren Osten und der Spannungen in der Atlantischen Gemeinschaft die Bereitschaft zu einem engeren Zusammenrücken in den Bereichen Äußere Sicherheit und Gemeinsame Außenpolitik.
Was spräche eigentlich gegen die kurzfristige Einberufung eines mehrwöchigen „Europäischen Verfassungskonvents“ zur Anpassung der Europäischen Verträge an die neuen Bedingungen einer multipolaren Welt? Wenn die Lage es erfordert, könnte der Europäische Rat mit den Staats- und Regierungschefs aller 28 Mitgliedsstaaten noch in diesem Sommer etwa auf der Insel Mainau zu diesem Zweck zusammentreffen.
Die Leitidee des Konvents könnte sein, Gemeinsamkeiten nach dem gewichteten Mehrheitsprinzip dort zu festigen, wo sich alle 28 Partner durch Kräftebündelung uneingeschränkte Vorteile für ihre militärische Sicherheit und die Wahrung ihrer gemeinsamen außenpolitischen Interessen versprechen und in allen innenpolitischen Bereichen dem Subsidiaritätsprinzip den ihm in den Gründungsverträgen zuerkannten hohen Stellenwert wieder zurückzugeben, d.h. Rückbau von Zentralisierung und Bürokratie sowie Verkleinerung der Institutionen.
Die Erarbeitung der Reformkapitel sollte im Geiste der Wahrung der nationalen und kulturellen Identitäten erfolgen, aus denen heraus die Europäer über die Jahrhunderte hinweg der Welt ihre großen Errungenschaften verfügbar gemacht haben. Insbesondere sollte ein strenges Grenzregime zur Sicherung der EU-Außengrenzen nach den Vorbildern der USA, Kanadas und Australiens in Kraft gesetzt werden, dem Wettbewerb wieder jene Förderung zuteilwerden, die über Belebung der Binnenmärkte zur Wohlstandsmehrung der Bürger beiträgt und die Währungspolitik der Europäischen Zentralbank wieder ihren ursprünglich geltenden Statuten unterworfen werden.
Der große Gewinn der Umsetzung eines solchen Reformansatzes wäre, dass damit zugleich den Briten die Hinderungsgründe genommen würden, wieder „Yes“ zu Europa zu sagen.