Jünger war und bleibt ein unbequemer Zeitgenosse, dessen Opus niemals bloß unterhaltend sein, sondern den Leser existenziell packen will.

 imago images / Sven Simon
imago images / Sven Simon
Der Streit um den Schriftsteller Ernst Jünger (1895-1998) schwelt noch, hat allerdings an Leidenschaft eingebüßt. Diesen Schluss lassen jedenfalls die Meinungen in den Medien und im Netz zu seinem 125. Geburtstag am 29. März zu. Zeit schafft Abstand.
Jünger gehört zu den Autoren, deren Leben und Werk sich nicht leicht auf eine bündige Formel bringen lassen. So werfen sich bis heute Kritik und Zustimmung wahlweise auf Werkaspekte bzw. Lebensabschnitte: auf den Soldaten zweier Weltkriege, den Konvertiten zum Katholizismus noch zwei Jahre vor seinem Tod, den Käfersammler (eine Art trägt sogar seinen Namen), den Reiseschriftsteller, den Technikskeptiker und -bewunderer (er war beides nacheinander), den konservativen Zeitzeugen, den Drogenexperimentierer, den nationalistischen Agitator der 20er Jahre, den Leser von Büchern (darauf legte er besonderen Wert), den Verfasser von Zukunftsromanen, den Naturfreund, und so fort. Die Vielfalt der Arbeitsfelder hat nicht nur diverse unverbundene Lesergemeinden geschaffen, sondern auch hilflos wirkende Gesamturteile erzeugt, wie etwa „widersprüchlich“, „umstritten“, „uneinheitlich“, bis hin zur „zerrissenen Persönlichkeit“. Nein, Jüngers Produktivität entsprang einer einzigen kreativen Quelle, der einer komplexen und kraftvollen Individualität, die sich über ein Dreivierteljahrhundert lang, von 1920 bis 1995 (!), in viele Richtungen verzweigte, von der jeder sich anhand einer 24-bändigen Werkausgabe überzeugen kann. Jünger muss die Missverständnisse geahnt haben: „Jeder Autor hat einen Sinn, in welchem alle entgegengesetzte Stellen sich vertragen oder er hat überhaupt keinen Sinn“ mahnte er schon 1934.
Jünger hat hier etwa sechzig Protokolle persönlicher Erlebnisse und Begebenheiten zusammengestellt. Er schildert in ihnen Naturphänomene, Lektüren, Träume, menschliche Verhältnisse und historische Gegebenheiten, Architekturen etc., durchsetzt mit Gedanken über deren Sinn, Bedeutung, innerer Ordnung und umfassenden Kontext. Das Abenteuer, will er uns damit sagen, warte überall, wo man den Dingen auf den Grund geht und damit ein neues, wunderbares Licht auf sie fallen lässt – das ist ihm die Aufgabe von Autorschaft. Aber nicht etwa in wissenschaftlich-analytischer Manier, wie er sie 1923-1925 in Leipzig am Institut für Zoologie kennenlernte. Er fordert einen vollständig anderen, ganzheitlichen Blick auf die Erscheinungen.
Damit wird ein Horizont geöffnet. „Das Leben birgt zwei Richtungen; die eine ist der Sorge zugewandt, die andere dem Überflusse, der die Opferfeuer umringt. Unsere Wissenschaft ist der Anlage nach der Sorge zugeordnet und der Festseite abgewandt; sie ist mit der Not untrennbar verbunden … Daher müsste man die Wissenschaft vom Überfluss erfinden, wenn es sie nicht seit jeher schon gäbe – denn sie ist keine andere als die Theologie.“ Ein Wechsel der Perspektive: vom Jammertal zur Fülle, ohne dass freilich die Existenz der Leiden geleugnet würden.
Jünger betont ausdrücklich, dass sein ästhetischer Standpunkt andere Maßstäbe setzt als die in der Welt der Entscheidungen (Politik, Wirtschaft, Recht, Militär, Familie etc.) gültigen, die anderen Gesetzmäßigkeiten und Kausalketten gehorcht. Freilich, auf ihre Weise kann aber die Kunst trotzdem indirekt auf sie einwirken. (Das zeigt sich schon an der nächsten Publikation, der Erzählung „Auf den Marmorklippen“, 1939 – obwohl das Thema ganz generell die Methoden der Gewaltherrschaft zum Inhalt hat, wird es weithin als eine Form des inneren Widerstandes gegen das NS-Regime verstanden.) Und wer sich neu auf Ernst Jünger einlassen möchte, darf nicht erwarten, in dessen Schrifttum Anpassungen an Ethik und Moral der oben genannten Systeme zu finden, schon gar nicht an den Zeitgeist. Jünger war und bleibt ein unbequemer Zeitgenosse, dessen Opus niemals bloß unterhaltend sein, sondern den Leser existenziell packen will.
Dr. Rainer Waßner, Dozent für Soziologie i.R. an der Universität Hamburg



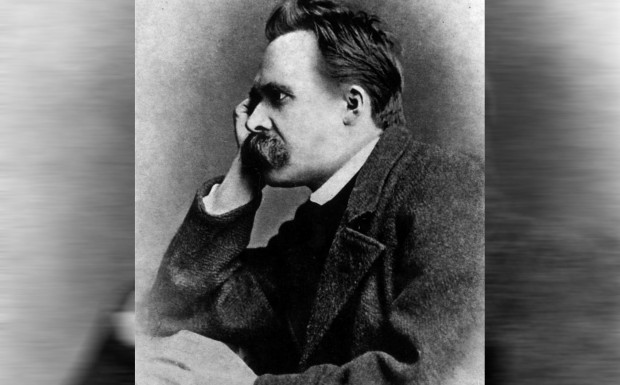


























Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
Ernst Jünger, 22 Jahre nach seinem Ableben, ist immer noch für Überraschungen gut. Kürzlich hat sich Martin Schulz, richtig, der Ex.Buchhändler aus Würselen, als Jünger Leser geoutet und festgestellt, Jünger sei einer von uns. Zur Lektüre von Jünger wurde er offenbar angeregt duch die Besuche der sozialistischen Ministerpräsidenten Spaniens und Frankreichs, Gonzales und Mitterrand bei Jünger in Wilfingen in den achziger Jahren des letzten Jahrhunderts, die beide ebenfalls zu den Lesern Jüngers gehörten. Na gut, der neurechte Verleger und Buchhändler Götz Kubischek und Martin Schulz, der Exbuchhändler und Genosse, friedlich vereint im Bann der Literatur eines Schriftstellers von Weltrang, das… Mehr
Ernst Jünger hätte 1933 aufgrund seiner militärischen Vergangenheit und seinen Büchern in der Weimarer Republik im Dritten Reich die Nummer eins sein können. Aber er verzichtete darauf der Günther Grass oder Thomas Mann der Nazis zu sein und schrieb nur noch unpolitische Bücher und kurz vor Kriegsbeginn die berühmten Marmorklippen. Das war eine respektable Haltung gegenüber den Machthabern und auch bezüglich seiner damit verlorenen finanziellen Einnahmen. Er schrieb nicht mehr politisch korrekt und verbot dem Völkischen Beobachter den Abdruck aus seinen Büchern. Wer würde das heute noch machen ? Als Besatzungsoffizier in Paris warnte er Juden vor Deportationen, verzichtete aber… Mehr
Jüngers Ernst, das war einer der ganz Großen. Rauchend und stehend, so ist er in meinen Augen gestorben. Erst am Tag seines Todes durfte ich ihn kennenlernen. Da hat nämlich der NDR spontan die lange Ernst-Jünger-Nacht gesendet (ja, die 3. Programme, die konnten mal was…). Ich war damals verdammt jung, noch nicht mal 30. Und konnte gar nicht fassen, was ein 90jähriger Knacker da vom Stapel ließ (es wurde u.a. viel aus einem Interview gezeigt, das er mit 90 gegeben hat). Solche Typen gibts unter den Einheimischen vermutlich gar nicht mehr. Und falls doch, würden alle gesellschaft… lichen (doch, „…lichen“,… Mehr
Ernst Jünger: Der Waldgang! empfehlenswert
„Die Sklaverei lässt sich bedeutend steigern,
indem man ihr den Anschein der Freiheit gewährt.“
Ernst Jünger, Blätter und Steine (1934, S. 219)
„Unsere Wissenschaft ist der Anlage nach der Sorge zugeordnet und der Festseite abgewandt“ – wie wahr, wie zutreffend, wenn wir die täglichen Ergüsse wissenschaftlicher und politischer Art betrachten, die in ihrer Engstirnigkeit die wunderbare Fülle der Welt auf nichtssagende Zahlen reduzieren.
Immer wenn ich mal wieder ein paar völlig fehlgeleitete (um’s mal diplomatisch zu formulieren) Jugendliche für’s Klima hüpfen sehe, fühle ich mich versucht, ihnen das Buch „In Stahlgewittern“ über Jüngers Erlebnisse im WK-I zu empfehlen. Nur um das Ganze mal so ein bisschen in Relation zu setzen.
Dann schaue ich in die Gesichter, erkenne die Aussichtslosigkeit dieses Ansinnens, seufze kurz und gehe weiter…
Ernst Jünger hatte im übrigens schon sehr früh recht, als er erkannte und schon 1948 treffend benannte: „Wo der Liberalismus seine äußersten Grenzen erreicht, schließt er den Mördern die Tür auf. Das ist ein Gesetz“. Karl Popper hat es als „Toleranzparadoxon“ bezeichnet: „Uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Denn wenn wir die uneingeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen.“ Wir werden uns, wie immer zu spät, noch oft und schmerzhaft an… Mehr
Jünger hat das falsch gesehen, wie es noch heute viele falsch sehen. Liberalismus heißt nicht unendliche Toleranz; Liberalismus ist Freiheitsliebe (libertas = Freiheit; tolerantia=Toleranz). Kein Freiheitlicher schließt den Feinden der Freiheit die Tür auf, das würde dem Wesen des Liberalismus gerade widersprechen.