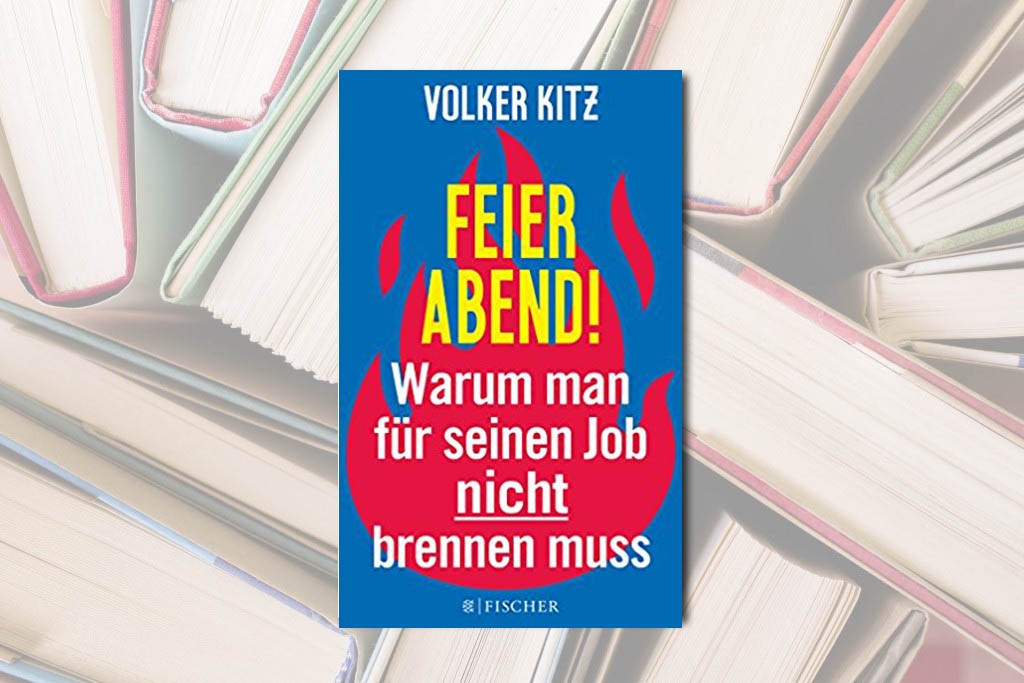Als ich das Buch vor einigen Tagen im Kaufhaus sah, war ich sofort neugierig, weil der Titel nahelegt, dass der Autor eine Gegenthese zu meinem eigenen Buch („Wenn du nicht mehr brennst, starte neu!“) vertritt. Ich lese manchmal gerne Texte, die genau das Gegenteil dessen vertreten, was ich denke. Manchmal wird dann allerdings ein Buchverriss daraus, so wie etwa jüngst bei dem Buch von Justizminister Maas.
Doch dieses Buch hat keinen Verriss verdient. Ganz im Gegenteil. Es enthält viele wichtige, kritische Gedanken über unsere Arbeitswelt, über die Selbstdarstellung von Unternehmen und zu den wirklichkeitsfremden Vorstellungen vieler Arbeitnehmer. Die zentrale These des Autors: Die Meinung, jeder Job müsse den, der ihn ausübt, mit Begeisterung erfüllen, jeder müsse seine Arbeit mit Leidenschaft tun und seinen Beruf als Berufung empfinden, für die er brennt, ist unrealistisch. Sie führt zu überzogenen Erwartungshaltungen und damit zur Unzufriedenheit, die gar nicht sein müsste, würden sich die Menschen dazu entschließen, das Berufsleben realistischer zu sehen. „Nicht die Arbeit macht Menschen unglücklich, sondern die Lügen, die wir uns darüber erzählen.“ (S. 9).
Arbeiten gehöre nun einmal für die Meisten nicht zu den Tätigkeiten, die sie am glücklichsten machten. Die Glücksforschung zeige, dass sich Menschen am glücklichsten fühlen (in dieser Reihenfolge), wenn sie Sex haben, mit anderen gesellig sind, essen und Sport treiben. „Arbeiten steht auf der Liste nicht vorne, sondern hinten.“ (S. 9).
Nach Umfragen des Gallup Institutes identifizieren sich nur 15 Prozent aller Beschäftigten mit ihrem Unternehmen, brennen für ihren Job. Diese Zahlen seien seit etwa 15 Jahren unverändert. Doch die Unternehmen verstrickten sich mit ihren „Employer Branding“-Kampagnen in immer unrealistischere Versprechen, die zu überzogenen Erwartungshaltungen führten und damit eine Quelle der Frustration seien.
„Leidenschaft“
Überall heißt es, man solle seinen Job mit „Leidenschaft“ ausüben. Dabei zeige jede Folge von „Deutschland sucht den Superstar“, was Leidenschaft mit der Frage zu tun habe, ob jemand seine Arbeit gut mache: nichts (S.22). Viele Startups zeigten, dass Leidenschaft nicht unbedingt ein Erfolgsgarant sei. „Zwei Dinge sind bei ihnen ausgeprägt: die Leidenschaft – und die Floprate. Gründer brennen für ihre Idee, ihr Projekt ist ihr Leben.“ Und die Gründer merken oft vor lauter Leidenschaft nicht, dass sie ein Produkt anbieten, dass niemand braucht – oder das schlecht ist (S. 24 f.). Leidenschaft sei jedenfalls keine Voraussetzung, um seine Arbeit gut zu verrichten – oft sei sie sogar eher ein Hinderungsgrund. Unternehmen und Mitarbeiter machten sich etwas vor, wenn sie so tun, als sei Leidenschaft bei der Arbeit der Normalfall und der Idealfall zugleich.
„Herausforderung“
In Stellenanzeigen wird gerne mit dem Wort „Herausforderung“ geworben. Bei den meisten Berufen bestünden jedoch 95% der Tätigkeiten nicht aus Herausforderungen, sondern aus Routine. „Einsteiger erleben einen Schock, wenn sie erfahren, wie sich der Arbeitsalltag von dem unterscheidet, was sie aus Ausbildung und Medien kennen. Statt sich mit der Normalität anzufreunden, leiden sie und sind sicher, dass sie den falschen Beruf gewählt haben.“ (S. 31) Das kommt mir plausibel vor, denn ich habe es in meiner ehemaligen Firma zu oft erlebt, dass wir junge Leute einstellten, die frisch von der Uni kamen und die völlig unrealistische Vorstellungen davon hatten, was ihnen ein Job zu bieten habe. Vorstellungen, die beim Aufeinandertreffen mit der Wirklichkeit des Arbeitslebens notwendigerweise zur Frustration führen mussten. Der Autor hat also Recht mit dieser These.
„Gestalten“
Eine andere Phrase ist die vom Anspruch, mit oder in seiner Arbeit etwas „gestalten“ zu wollen. Unter „gestalten“ werde dabei verstanden, dass man die Arbeit im Großen und Ganzen nach den eigenen Vorstellungen und Ideen ausführen könne. Auch das sei eine unrealistische Vorstellung vom Arbeitsleben, das keineswegs darin bestehe, dass alle ständig ihre eigenen Vorstellungen auslebten. „Dass es in einer Organisation um Anweisungen und Ausführung geht, um Hierarchie und Gehorsam, um Über- und Unterordnung, dass nicht einfach alle machen können, wonach ihnen der Sinn steht – dieser Gedanke ist unsexy und bleibt ungesagt. Kein Mensch richtet sich gern nach Anweisungen; deshalb möchte keine Führungskraft durch Anweisungen führen. Das gilt als altmodisch. So ignorieren wir, dass es in jeder Organisation Personen geben muss, die Entscheidungen treffen – und solche, die sie ausführen.“ (S. 42) Durch diese falschen Vorstellungen vom Arbeitsleben werde wiederum Frustration erzeugt, denn „schon bei Berufseinsteigern brandet Widerstand auf, wenn ihnen jemand etwas ‚vorschreiben’ will“ (S. 42).
„Sinn“
Die Arbeit soll sinnvoll sein. Wer will dem widersprechen. Sinnvoll ist jedoch, so der Autor, mehr oder minder alles, was wir tun, denn wir befriedigen mit unserer Arbeit das Bedürfnis von Konsumenten. Dies sei aber heute nicht mit „Sinn“ gemeint. „Sinnvoll“ erschienen uns nur noch Tätigkeiten, mit denen wir die Welt im großen Stil verändern, und zwar möglichst unkommerziell: „Das Medikament erfinden, das Krebs spontan heilt, für keine anderen Zwecke missbraucht werden kann und der Weltbevölkerung kostenlos zur Verfügung steht. Die erschwingliche Powersolarzelle bauen, die das Energieproblem löst. Irgendwas in Afrika, egal was. Solange nicht das Erdenschicksal von unserem Fingerzeig abhängt, erscheint uns eine Tätigkeit zu klein-klein, um ‚sinnvoll’ zu sein.“ (S. 47). Auch das habe ich beobachtet: Universitätsabgänger fühlen sich nicht selten berufen, irgendetwas zu tun, was mit „Nachhaltigkeit“ zu tun hat. Produkte die nicht aus „fairem Handel“ stammten (was auch immer das sein soll), sind ihnen suspekt und sie wollen sich nicht zum Komplizen derjenigen machen, die daran verdienen.
Die tanzende Putzfrau
Das Idealbild, das von Motivationsgurus verkündet wird, ist die „tanzende Putzfrau“. Ein Forscherteam in den USA fand heraus, dass es neben Reinigungskräften in Krankenhäusern, die einfach nur ihren Job tun, auch solche gibt, die sich um Patienten kümmern, für sie tanzen, sie zum Lachen bringen, ihren die Angst vor der Untersuchung nehmen, Bilder an die Wand hängen und mit den Besuchern plaudern. Die Botschaft: Wenn die Putzfrau das kann, dann kann jeder seinen Job interessant machen und mit Begeisterung ausfüllen. Der Autor widerspricht: „Das Krankenhaus käme ohne die paar Reinigungskräfte zurecht, die nebenbei tanzen; womöglich wäre die Stimmung weniger ausgelassen. Ohne die vielen aber, die ‚nur’ ihre Arbeit machen und putzen, könnte es keine drei Tage bestehen. Hygiene ist für ein Krankenhaus und seine Patienten überlebenswichtig. Wer sie am Leben und den Laden am Laufen hält, sind nicht die tanzenden Reinigungskräfte, sondern die reinigenden Reinigungskräfte. Es ist die Masse der normalen Leute, die ihre normale Arbeit normal erledigen.“ (S. 64 f.)
Die Minderheit, die „brennt“
Der Autor hat nichts gegen Menschen wie mich – mein Motto war stets: Ich muss für meine Arbeit brennen, sonst suche ich mir eine neue Arbeit. So habe ich mein Leben lang gehandelt – wie ich in meinem Buch „Wenn du nicht mehr brennst, starte neu!“ beschreibe. Ich gehöre zu den Menschen, für die es viel zu wenig ist, „zufrieden“ mit der Arbeit zu sein, sondern die viel höhere Maßstäbe anlegen. Der Autor bestreitet nicht, dass es solche gibt, aber: „Es handelt sich um eine winzige Gruppe mit besonderen Voraussetzungen.“ (S. 16 f.) Es sei nur falsch, so zu tun, als seien eine solche Einstellung und Lebenspraxis normal. Falsch sei die Botschaft: „Wenn deine Arbeit dich nicht von ganzem Herzen erfüllt, wenn du nicht für sie brennst, wenn deine Arbeit nicht dein ‚Selbst’ ist, ist etwas nicht in Ordnung. Dann fehlt deinem Leben ein wichtiges Vitalsignal.“ (S. 78) Für die Mehrheit der Menschen bedeute die Arbeit nicht das große Glück. „Aber sie sind mit ihrer Arbeit ganz zufrieden. Das beschreibt die Gefühlslage fast aller Arbeitenden in Deutschland.“ (S. 81)
Realistische Ansprüche
Die Menschen seien glücklicher, wenn sie einige Tatsachen akzeptierten, z.B.: „Dieser Betrieb wurde nicht erfunden, um euch mit der Arbeit zu beglücken, sondern um ein Produkt oder eine Dienstleistung für die Gesellschaft hervorzubringen – und damit euren und unseren Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Was ihr zu tun habt, ist im Großen und Ganzen vorgegeben. Es geht um ein gemeinsames Ergebnis, nicht darum, dass jeder seine Vorstellungen umsetzt. Eure Arbeit ist meist Routine, sie wiederholt sich. Deshalb seid ihr gut darin. Eure Arbeit hat einen Sinn für die Gesellschaft. Es ist nicht die Aufgabe der Arbeit, eurem Leben einen Sinn einzuhauchen, den es ohne die Arbeit nicht hat. Für den Sinn eures Lebens seid ihr verantwortlich.“ (S. 84 f).
Fazit:
Ich teile die Meinung des Autors, dass die Mehrheit der Menschen vermutlich besser beraten ist, von solchen realistischen Sichtweisen auszugehen als überzogene Erwartungshaltungen an ihren Job zu legen, die nur Quelle von Frustration sind. Andererseits: Es gäbe kein Aufstiegsstreben in Unternehmen und in der Gesellschaft, keine Unternehmensneugründungen und keine neuen Ideen – und somit überhaupt keinen gesellschaftlichen und technischen Fortschritt, wenn es nicht eine Minderheit gäbe, die das vollkommen anders sieht. Die eben mit Routinearbeit nicht „zufrieden“ ist (und diese daher lieber von Anderen erledigen lässt, die es sind), die nicht die Anweisungen von anderen umsetzen möchten, sondern lieber eigene Ideen entwickeln und anderen Anweisungen geben, wie diese umzusetzen sind, denen es angesichts der Tatsache, dass sie den größten Teil ihres wachen Lebens mit Arbeit verbringen, viel zu wenig ist, wenn sie „nicht völlig unzufrieden“ sind. Für diese Menschen habe ich mein neues Buch geschrieben: „Wenn du nicht mehr brennst, starte neu!“ Für die Mehrheit derjenigen, denen es ausreicht, wenn sie „irgendwie ganz zufrieden“ sind, ist hingegen das vorliegende Buch „Feierabend!“ sehr empfehlenswert, denn es hilft ihnen, die eigenen Ansprüche mit der eben nicht allzu berauschenden Realität in Einklang zu bringen. Sie müssen eben damit zufrieden sein, wenn der Feierabend, das Wochenende und das Rentenalter sie glücklich machen (obwohl auch das dann oft daneben gehen dürfte).
Volker Kitz, Feierabend! Warum man für seinen Job nicht brennen muss. Eine Streitschrift für mehr Gelassenheit und Ehrlichkeit im Arbeitsleben, Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2017, 93 Seiten.
Dr. Dr. Rainer Zitelmann „Wenn du nicht mehr brennst starte neu!“: Leseproben und Rezensionen zum neuen Buch von Dr.Dr. Rainer Zitelmann finden Sie hier: zitelmann-autobiografie.de