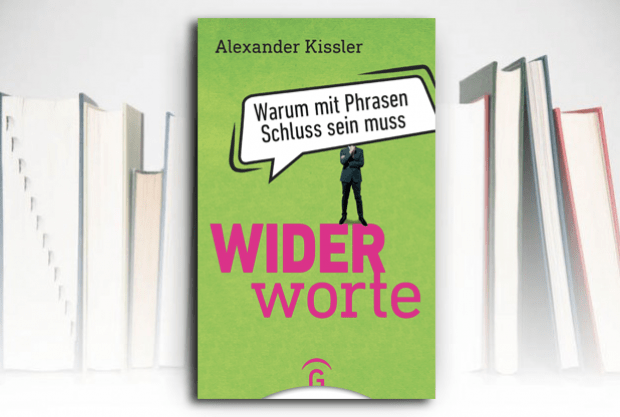Ein Könner war er schon, vielleicht ein »arroganter Könner«, wie der Schriftsteller Uwe Kolbe den schwäbischen Kollegen nennt, aber ein Könner unbedingt. Sonst wären nicht derart viele Wendungen Bertolt Brechts in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen und hätten dort bis heute überdauert, zwischen »Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch«, »erst kommt das Fressen, dann die Moral« und der rhetorischen Frage, »was ein Einbruch in eine Bank« sei »gegen die Gründung einer Bank.« Wer deutsch spricht, entkommt Brecht nicht.
Worte transportieren Botschaften auf vielen Pfaden, und mit den metrisch geglückten, witzigen, plastischen Wendungen Brechts gelangt dessen sozialistisch eingefärbte Weltsicht ins öffentliche Reden, und sei’s in Form eines Kinderreims. Auch dieses Stilmittel beherrschte der Ego- und Erotomane mit dem laxen Eigentumsbegriff. »Ford hat ein Auto gebaut / Das fährt ein wenig laut. / Es ist nicht wasserdicht / Und fährt auch manchmal nicht.« So steht es unter dem Buchstaben »F« im Gedicht »Alfabet« aus Brechts »Kinderbuch«. Bei »R« lesen wir einen ungleich bekannteren Vierzeiler. »Reicher Mann und armer Mann / Standen da und sahn sich an. / Und der Arme sagte bleich: / Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.« Hart stoßen die Antagonisten aufeinander, der Reiche und der Arme, unversöhnlich ist ihre entgegengesetzte Lage. Brecht dachte oft in Antinomien. Besonders auf ökonomischem Feld gab es für ihn selten ein Drittes, gab es nur die Habenichtse und die Ausbeuter, die Knechte und die Herren, vergleichbar einem Max Stirner, einem Karl Marx.
Uwe Kolbe urteilt in seinem Langessay »Brecht – Rollenmodell eines Dichters« von 2016: »Das Vorbild der Denk- und Lebensweise, die von dem Dichter Brecht herkommt, lebt. Es ist ein zäh fortbestehendes Rollenmodell des kritischen Dichters, Schriftstellers, Künstlers, das die realen Verhältnisse weitgehend ignoriert. Er mischt sich in die Belange der Wirtschaft, des Fortgangs der Menschheit, der Politik ein, obwohl deren Dynamik ihn überfordert. (…) Er bietet einfache Lösungen an. Zugleich schmarotzt sein eigenes Leben an dem Gewinn, den die Dynamik mit sich bringt.«
Brecht, der Überforderte und Profiteur seiner Überforderung?
Was im Kinderreim putzig klingt und seinen Platz hat, stößt sich hart an den von Uwe Kolbe eingeklagten »realen Verhältnissen«. Den Ursprung des Reichtums, der sich einer fremden Armut verdanken soll, lässt Brecht außer Acht. Ein Mann hat Geld geerbt, das seine Eltern durch sparsames Haushalten beiseitegelegt haben, ihr Leben lang: Dieser Vermögenszuwachs beim Sohn soll Resultat sein der Ausbeutung eines Armen? So kann es Brecht nicht gemeint haben. Ein Mann hat eine pfiffige Idee, meldet ein Patent an, gründet eine Firma, schafft Arbeitsplätze für Hunderte: Auf wessen Kosten soll dieser Reichtum entstanden sein? So kann es Brecht nicht gemeint haben. Eine junge Frau überspringt mehrere Klassen, macht den Universitätsabschluss in Rekordzeit und wird zur weltweit gefragten Expertin für Künstliche Intelligenz: Welchem Armen hat sie bei ihrem Aufstieg Geld weggenommen? Und welche Armen wurden von den millionenschweren Rockstars Mick Jagger, Bono, Lady Gaga bestohlen? So kann es Brecht nicht gemeint haben. Wie aber dann?
Hinzu kommt ein zweiter Gedanke im antagonistischen Kräftefeld, der es ins Universelle weitet: Brechts Wippe. In der »Heiligen Johanna der Schlachthöfe« beschreibt die Titelheldin »das System« wie folgt: »Da sitzen welche, wenige, oben und viele unten, und die oben schreien hinunter: kommt herauf, damit wir alle oben sind, aber genau hinsehend siehst du was Verdecktes zwischen denen oben und denen unten, was wie ein Weg aussieht, doch ist’s kein Weg, sondern ein Brett, und jetzt siehst du’s ganz deutlich, ’s ist ein Schaukelbrett, dieses ganze System, ist eine Schaukel mit zwei Enden, die voneinander abhängen, und die oben sitzen oben nur, weil jene unten sitzen, und nur solange jene unten sitzen, und säßen nicht mehr oben, wenn jene heraufkämen, ihren Platz verlassend, so dass sie wollen müssen, diese säßen unten in Ewigkeit und kämen nicht herauf. Auch müssen’s unten mehr als oben sein, sonst hält die Schaukel nicht.« Dem deutschen Schauspieler Lars Eidinger, geboren 1976 in Berlin, leuchtet dieses Bild »total ein«. So sagte er es im Fernsehen, bei »arte«, Ende Januar 2018.
Eidinger, der wenig später Bertolt Brecht spielen sollte im Kinofilm »Mackie Messer«, präsentiert sich im selben »arte«-Gespräch an der Seite des Regisseurs Oskar Roehler als Kind seiner Erziehung. Er sei »in diesem Unrechtsbewusstsein (…) eigentlich groß geworden«. Eine bemerkenswerte und vermutlich ehrliche Aussage. Gemeint ist eine Erziehung, deren prägende Haltung unzerstört vom Heranwachsenden auf den Erwachsenen überging, also keinerlei Rebellionen auslöste, keine Abnabelung, keine Auflehnung. Lars Eidinger, der Bühnenstar, repetiert jene Wahrheit, die er aus seiner Westberliner Jugend übernommen hat. Er sieht sich wie weiland als Knabe, als Teenager, als Schauspielschüler in einem universalen Verblendungszusammenhang gefangen. Er ist seiner Eltern und seines sozialen Umfelds gehorsamer Sohn geblieben. Er gibt als erkannt aus, was ihm damals gesagt worden ist. Er schließt auf zum Kind, das er war. Man könnte ihn einen Traditionalisten des richtigen Bewusstseins nennen. Oder einen unfreien Nachbeter.
Lars Eidinger verdient sehr gut und fühlt sich darum schuldig. Brecht wäre stolz auf seinen Schüler, einen unter vielen. Auf der Rückbank eines Taxis bei der nächtlichen Fahrt durch Berlin – so sieht es die Rahmenhandlung des arte-Formats »Durch die Nacht mit …« vor – bekennt Eidinger vor Roehler, er habe gegen »sowas wie Multikulti nichts, weil ich immer das Gefühl habe, ich lebe in einem absoluten Wohlstand, und mein Reichtum und mein Wohlstand gründet sich auf der Ausbeutung und der Armut anderer. Wenn ich helfen will, muss ich was abgeben, da muss ich ein Eingeständnis machen an meinen Wohlstand, und dazu bin ich bereit.« Wenig später blendet die Szene ab. Wir werden nie erfahren, welchen Teil seines erarbeiteten Reichtums Lars Eidinger anno 2018 abzugeben bereit war. Und welchen er abgab.
Wohl aber sind die entscheidenden Stichworte gefallen: Es geht ums »Helfen«, worunter zwischen Entwicklungshilfe und Almosen eine breite Skala geldwerter Unterstützung für Abwesende fällt. Eidinger will durch seine versprochene helfende Tat »der Ausbeutung und der Armut anderer« entgegenwirken. Ausbeutung und Armut sollen verringert werden dadurch, dass Lars Eidinger seinen Wohlstand reduziert, »dazu bin ich bereit«. Der Schauspieler, der künftig – wir müssen da spekulieren – eine Ananas weniger kauft oder einen Teil seiner Gagen spendet oder vom Eigenheim in eine Zwei-Zimmer-Wohnung umzieht, sieht den Komfort seiner Berliner Lebensverhältnisse und seine Einkünfte bei Film, Theater, Fernsehen errichtet auf bösem Fundament, »auf der Ausbeutung und Armut anderer«, ohne dass er selbst ein Ausbeuter wäre. Das Bewusstsein eines kolossalen Unrechts verlässt ihn nie. Wir haben es, soziologisch gesprochen, mit struktureller Schuld zu tun, einem veritablen schwarzen Schimmel. Deshalb stellt Eidinger in Aussicht zu tun, was er tun »muss«. Das modale Hilfsverb ist entscheidend. In diesem Moraldiskurs herrscht kein Sollen, hier regiert das Müssen. Eine Schuld, die für kollektiv untilgbar gilt und individuell nicht gewogen werden kann, bedarf des Imperativs, frei von aller Abwägung. »Du musst! Du musst! Und kostet es mein Leben!« (»Faust«)
Die Uhr tickt, und wer das UN-Utopia errichten will, darf sich mit keinem Vielleicht, keiner Hoffnung, keinem Werben aufhalten. Hier gilt’s zu müssen. »Alle müssen bei der Umsetzung der Agenda 2030 mitmachen«, heißt es am Ende der Broschüre, ehe unter dem Befehlspfeil »Machen Sie mit!« die finale Verhaltensanordnung erfolgt:
Energie sparen! Fahrrad statt Auto! Keine Lebensmittel wegwerfen! Produkte kaufen mit ökologisch-sozialen Gütesiegeln! »Engagieren Sie sich!«
Wird sich jemand durch moralische Gestellungsbefehle der Regierung in seinem Konsumverhalten dauerhaft beeindrucken lassen? Hunger, Armut, Krankheit weichen weltweit, wenn der Pudding in Bad Blankenburg zu Feinkostpreisen erstanden wird? Wenn für fair gehandelte Baumwolle im T-Shirt das Fünffache gezahlt wird? Natürlich kann erhöhte Nachfrage zu einer Ausweitung der gewünschten Produktionszweige führen, mangelnder Absatz zum Niedergang. Insofern haben die Konsumenten tatsächlich Macht, Marktmacht, wie jeder Marktteilnehmer. Von globalen Verheißungen sollte auch und gerade ein deutscher Entwicklungshilfeminister mit UN-Rhetorik absehen. Allein der Umstand, dass an fast keiner Stelle der vielen Benimmfibeln für den nachhaltigen Musterkonsumenten der Zusammenhang zwischen dem Kampf gegen das weggeworfene Lebensmittel und dem globalen Sieg über Hunger und Armut detailliert ausgeführt wird, mahnt zur Skepsis.
Auf der vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft betriebenen Homepage »Zu gut für die Tonne« heißt es, »in Anbetracht des Hungers in der Welt und aus Respekt vor unseren Mitmenschen und der Schöpfung sind wir geradezu verpflichtet, sorgsam mit unseren Lebensmitteln umzugehen. Außerdem trägt unser Verhalten tendenziell auch zur Verknappung und damit zur Steigerung der Preise für Lebensmittel bei.« Dass man nicht vor allen Menschen Respekt haben kann, haben sollte, wird im vierten Kapitel meines Buches ausgeführt. Entscheidend ist der Moralappell. Er macht die Pflicht zur relativen – nur »geradezu« sei man verpflichtet.
Das nachgeschobene ökonomische Stützargument taugt kaum: Ziel des mündigen Konsumenten soll es sein, durch Kaufzurückhaltung die Preise der Produkte, die er wenig nachfragt, zu steigern? Um sie dann, wenn sie teurer geworden sind, wieder stärker nachzufragen? Diese Gleichung dürfte nicht aufgehen. Ein Unternehmer, dessen Produkte in eine Absatzkrise geraten, wird eher die Belegschaft verringern, also Arbeitslosigkeit generieren, als die Preise für seine Produkte zu erhöhen. Kein Fall ist mir bekannt, da Ladenhüter zu Rennern wurden, indem man ihre Preise heraufsetzte. Der »tendenzielle« Satz von zugutfuerdietonne.de hat die Tendenz zum Unsinn.
Wenn Minister Müller fordert, »diese Zustände müssen wir ändern«, und der CSU-Politiker damit ein Ende der »neokolonialistischen Ausnutzung der Arbeitskraft und der Ressourcen dieses reichen Kontinents« anmahnt durch den Kauf von »fairem Kaffee, Kakao, Baumwolle oder Bananen«, denn nur so hätten »Afrikas Kinder und Jugendliche eine Chance auf ein Leben und eine Zukunft in Würde« – dann deutet die alarmistische »Nur so«- Rhetorik nicht nur auf die zynische Ausweitung der Alternativlosigkeitsrhetorik, mit deren Hilfe dem einer gewaltigen Staatsquote unterworfenen Staatsbürger vom Staatsvertreter eingeredet werden soll, er sei verantwortlich für ein würdeloses Dasein junger Afrikaner, sofern er nicht subito einen 30-prozentigen Aufschlag auf das Pfund Kaffee berappe; nein, dann erweist sich der CSU-Minister als gelehriger Schüler des Münchner Soziologen und Politikers Stephan Lessenich. Dessen Haupttheorie nimmt Minister Müller auf, wenn er zum Welt-Umwelttag 2018 sagt, »wir leben auf Kosten anderer Menschen und Naturräume, die ihre Ressourcen für unseren Konsum ausbeuten. (…) Industrieländer leben auf Kosten der Entwicklungsländer. Wir sind eine Externalisierungsgesellschaft.« Was meint das?
Der Hochschullehrer Stephan Lessenich gründete die links-grüne Partei »Mut«, die bei den bayerischen Landtagswahlen im Oktober 2018 insgesamt 0,3 Prozent der Stimmen erhielt. Überregional bekannt geworden war Lessenich 2016 durch seinen Bestseller »Neben uns die Sintflut – Die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis«, in dem er ein breites Panorama des westlichen »Unrechtsbewusstseins« (Eidinger) entwirft. Das Erfolgsbuch erschien 2018 als Taschenbuch unter dem leicht geänderten Titel: »Neben uns die Sintflut – Wie wir auf Kosten anderer leben«. Anders als Minister Müller traut er dem individuellen Kaufverhalten nicht zu, die Erbschuld des Bösen zu tilgen. Lessenich stellt die Systemfrage, will die antikapitalistische Revolution. »Wer wirklich allen Weltbürgern eine materiell gesicherte Existenz, ein Mindestmaß der Verfügung über das eigene Lebensschicksal und die Chance auf ein friedvolles gesellschaftliches Zusammenleben wünscht, der muss die Externalisierungsgesellschaft infrage stellen – und damit (…) den globalen Kapitalismus als System ungleichen Tauschs im Besonderen.«
Das Buch, das mit der längst enttarnten Begriffsattrappe namens »strukturelle Schuld/strukturelle Gewalt« hantiert, verkaufte sich gut – obwohl eben »die Rede von struktureller Gewalt keine Täter kennt, nur Opfer. Sie erklärt nichts, weil sie soziale Abhängigkeitsverhältnisse mit Gewalt verwechselt.« (Jörg Baberowski) Kluges hatte Lessenich fallweise im Angebot, etwa die Abgrenzung der Soziologie von Sozialtherapie und Morallehre. Dem blinden Fleck der Linken entkam er nicht. Lessenich übersah, dass die nachparadiesische Menschheit jenseits des Kapitalismus bisher keine Gesellschaft zustande brachte, in der die Freiheit des Einzelnen fester verbürgt gewesen wäre.
Wo das Müssen der Anderen gemeint ist, lauert fast immer eine Anmaßung, oft sogar die Heuchelei der »Tugendschurken« und »Tugend-Hausierer« (Nassim Nicholas Taleb). Wo Minister Müller fordernd referiert, »das Bewusstsein muss gestärkt werden, dass jeder Einzelne zu einer gerechteren Welt beitragen kann, zu einer Welt ohne Hunger und mit guten Entwicklungsmöglichkeiten für nachfolgende Generationen«, wird aus Politik eine Heilslehre. Trotz der UN ist eine »Welt ohne Hunger« illusionär. Man müsste die Willensfreiheit abschaffen und die Demokratie und zudem eine Globalregierung installieren für die eine »Weltinnenrepublik«, deren Zeit nicht nur die SPD gekommen sieht. Um solche Utopien wahr werden zu lassen, braucht es eine derart harte Hand, dass sie, kaum in Wirklichkeit erschienen, zu Dystopien würden. Der Weg in die Hölle ist mit himmlischen Versprechungen gepflastert.
Man muss nicht so weit in die Provokation ziehen, wie es der Wirtschaftspublizist René Zeyer tat, als er Brechts Dogma umdrehte, seinem Buch den Titel »Armut ist Diebstahl« gab und darin unter anderem darlegte, dass Brechts Dichotomie vom armen und reichen Mann auf Umverteilung hinauslaufe, wodurch sich freilich die Armut nicht besiegen lasse; »dann ist es so, dass ein Armer nicht zuletzt deswegen arm ist, weil er mit Geld nicht umgehen kann.« Die Gegenthese stammt vom neomarxistisch inspirierten Papst Franziskus, der 2017 einen jährlich zu begehenden »Welttag der Armen« einführte und zu diesem Anlass in der Armut »die Frucht sozialer Ungerechtigkeit« sah »sowie moralischen Elends, der Habgier weniger und der allgemein verbreiteten Gleichgültigkeit«. Die Gegenthese zur Gegenthese in diesem virtuellen Schlagabtausch findet sich wiederum bei Zeyer: »Letztlich ist also die Verknüpfung des Abstraktums Gerechtigkeit mit dem Abstraktum Armut ein philosophisches Luftgefecht, ohne Erkenntnisgewinn, nicht beweisbar, ein Wortgeklingel.« Zeyer versteht unter Gerechtigkeit eine »innere Eigenschaft«, eine Tugend.
Natürlich ist der persönliche Einsatz gegen unverschuldete Armut nobel und sinnvoll, natürlich muss eine Gesellschaft darauf achten, dass Armut nicht überhand nimmt und zum Nährboden für Gewalt oder politischen Extremismus wird. Es gibt tatsächlich einen Reichtum, der zum Himmel stinkt, und eine Armut, die ein entsetzliches Unrecht ist. Darum ist die Nachricht, dass seit 1990 die Zahl der Menschen in extremer Armut um etwa 1,4 Milliarden insgesamt fiel, wunderbar.
Arme wird es immer geben, das prophezeite schon Jesus Christus (Mt 26,11). Ebenso realistisch war Papst Leo XIII., der in seiner Sozialenzyklika »Rerum novarum« aus dem Jahr 1891 schrieb: »Es werden immerdar in der Menschheit die größten und tiefgreifendsten Ungleichheiten bestehen. Ungleich sind Anlagen, Fleiß, Gesundheit und Kräfte, und hiervon ist als Folge unzertrennlich die Ungleichheit in der Lebensstellung, im Besitze.« Die verordnete Gleichheit ist kein erstrebenswertes Ziel, denn sie brächte die totale Unfreiheit. Ein Blick in die Geschichte zeigt es. Der manichäische Glaubenssatz von Brecht & Co. trügt mehr, als dass er erhellte. Die gerade und kausale Linie, die von der Armut der Einen zum Reichtum der Anderen und retour führte, gibt es nicht. Wer – zu Recht – Differenzierung fordert und sich gegen einfache Antworten auf komplexe Fragen sperrt, kann nicht den schlichtesten aller Scheinzusammenhänge als tiefe Erkenntnis ausgeben.
Dieser Beitrag stammt – mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag – aus:
Alexander Kissler, Widerworte. Warum mit Phrasen Schluss sein muss. Gütersloher Verlagshaus, 208 Seiten, 18,00 €.