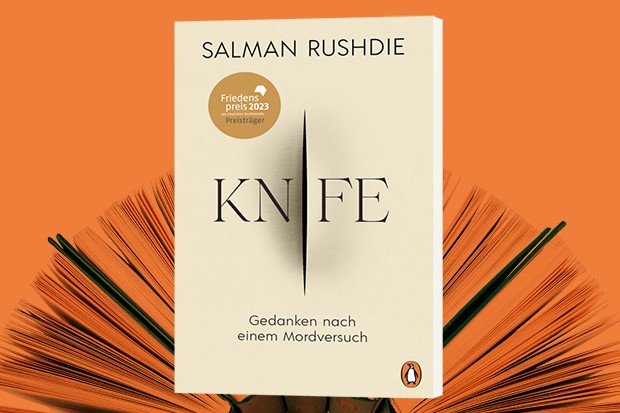Er sieht seinen Mörder wie in Zeitlupe auf sich zukommen, hebt schützend die linke Hand, setzt sich aber nicht zur Wehr. „Ich stand einfach nur da und starrte ihn an, stand da wie angewurzelt, ein Kaninchendepp im Scheinwerferlicht.“ Unfassbare 27 Sekunden lang sticht der Mann auf Salman Rushdie ein, in die Hand, in die Leber, in ein Bein, in die Brust, in den Hals, ins Gesicht, in ein Auge, ehe er endlich abgehalten wird. Es gibt keine Security auf der Bühne des Literaturfestivals in Chautauqua im US-Bundesstaat New York. Rushdies Leben hängt tagelang am seidenen Faden, es folgen furchtbare Wochen auf der Intensivstaton, in der Reha-Klinik.
Daran erinnert er sich zwei Jahre später in „Knife“, seinem neuesten Buch. Gnadenlos genau, unfassbar kühl, kein Detail des Horrors und der schmerzhaften Therapie auslassend, das „Gekochtes-Ei-Auge“ hängt ihm am Gesicht. Der Humor hat ihn nicht verlassen. Es ist sein Versuch, „mit dem Vorgefallenen klarzukommen“, eine Selbsttherapie, für die es die optimistische, lebensbejahende Heiterkeit Rushdies braucht: „Dieses Buch ist meine Art, mir zu eigen zu machen, was geschehen ist, es anzunehmen – es zu meiner Arbeit zu machen.“
Der Täter, ein 24-jähriger US-Amerikaner libanesischer Abstammung, zu blindem Fanatismus aufgehetzt, ein „Einzeltäter“ wie es nun beschönigend heißt. Rushdie weigert sich, den Namen des gescheiterten Mörders zu nennen. Für ihn ist er einfach A., „mein Angreifer, mein Attentat, der Affenblöde“, den er in Gedanken nur „Arschloch“ nennt.
Der keine zwei Seiten von Rushdie gelesen hat.
Deshalb glaubt das Opfer: „Worum auch immer es bei diesem Attentat ging, es ging nicht um ‚Die satanischen Verse‘.“ Da macht er sich allerdings etwas vor. Verständlich, denn seit drei Jahrzehnten kämpft er dagegen an, von der Fatwa gegen ihn definiert zu werden. Und um den tatsächlichen Inhalt des Romans war es noch nie gegangen.
Nichts beweist den satanischen Glutkern dieses Glaubens stringenter als sein menschenfeindlicher Fundamentalismus. Im Februar 1989 hatte Irans greiser Führer Ayatollah Khomeini Salman Rushdie zum Tode verurteilt, die Muslime in aller Welt zur Vollstreckung aufgerufen, ein Kopfgeld von einer Million Dollar ausgesetzt. Gewaltsame Massenproteste folgten in aller Welt. Bomben explodierten. Ein Übersetzer des Buches wurde ermordet, Sicherheitskräfte verhinderten mindestens sechs Attentate. Auch Rushdie verlor seine Freiheit – seine britischen Beschützer behandelten ihn mehr wie einen Gefangenen, denn als einen Verfolgten. 2000 wanderte er in die USA aus, wo er sich sicherer und freier fühlte. 2012 war das Kopfgeld noch einmal auf nunmehr 3,3 Millionen Dollar und später auf vier Millionen erhöht worden.
Die Geschichte war und ist aber nicht nur Rushdies Geschichte. Im September 2005 erschienen in der dänischen Tageszeitung „Jyllands-Posten“ zwölf Mohammed-Karikaturen. Die folgenden Unruhen und Anschläge forderten mehr als 100 Menschenleben. Im Januar 2015 dann der Anschlag auf die französische Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“. Elf Menschen wurden ermordet.
Rushdies Kommentar dazu: „Religion, eine mittelalterliche Form der Unvernunft, wird, wenn sie mit modernen Waffen kombiniert wird, zu einer echten Gefahr unserer Freiheiten. Derartiger religiöser Totalitarismus hat zu einer tödlichen Mutation im Herzen des Islams geführt, und wir sehen heute die tragischen Folgen in Paris.“
Im August 2022 jedoch, 33 Jahre nach dem Erscheinen der „Satanischen Verse“, wurde die Fatwa an ihm dann doch noch um ein Haar vollstreckt. Er beschrieb den ersten Teil der Geschichte 2012 in seinem besten Buch, der Autobiografie „Joseph Anton“ – atemberaubend kühl und zugleich aufrüttelnd in der dritten Person, Distanz zu sich selbst suchend.
Er spürt keine Wut gegenüber A. Weil die Begegnung mit A. nicht möglich ist, fantasiert Rushdie sie, versucht, einen Weg in den Kopf des Fanatikers zu finden – besser gesagt: ihn zu erfinden. Daran scheitert er. Der Mann ist einfach zu verbohrt. Sein Glaube erweist sich als nicht mehr als abgrundtiefe Blödheit. Alles, was diesen A. ausmacht, ist das Messer. Aber das ist eben auch nicht nichts. „Das Leben war mein Sieg. Doch die Bedeutung, die das Messer meinem Leben gab, war meine Niederlage.“
Ich sprach mit Rushdie im November 2012 unter konspirativen Umständen in London. Das „Blaue Sofa“ (damals die Literatursendung des ZDF) stand in einem Haus der anglikanischen Kirche. Das war nicht ohne Komik, da Rushdie, der aufgeklärte Skeptiker, bei allen Glaubensgemeinschaften aneckte, besteht er doch auf Respektlosigkeit als Tugend der Freiheitsliebenden. Das Wort „Respekt“, sagte er damals, könne er so wenig leiden wie „political correctness“. Eine öffentliche Entschuldigung für die „Satanischen Verse“ untergrübe nur seine Glaubwürdigkeit. Die blödeste Frage, die er immer wieder gestellt bekomme, sei deshalb die, ob er das noch einmal schreiben würde.
Mit Todesverachtung schrieb er weiter, bekämpfte seine Angst. Was Fundamentalisten aller Arten gemeinsam hätten, fragte ich ihn damals. Seine Antwort kam wie aus der Pistole geschossen: „Sie hassen das Vergnügen auf Erden, weil alles auf ein Leben nach dem Tod ausgerichtet ist.“
Die tiefste Spaltung der Menschheit ist die zwischen Menschen mit Humor und Menschen ohne Humor, konstatiert Rushdie in „Knife“. Deshalb meinen ja so viele, dass man über religiöse Fanatiker nicht spotten dürfe. Der tödlich-fromme Ernst ist ein Tabuthema. Deshalb aber sind in Wahrheit nicht die Mullahs die größten Feinde aufgeklärter, säkularer Menschen, sondern die Gutmeinenden.
Es war ein Sieg der Mutlosigkeit und der Dummheit. Selbst Figuren wie der konservative Großverleger Rupert Murdoch distanzierten sich von Rushdie: „Ich finde, man sollte die religiösen Gefühle der Menschen nicht beleidigen.“ Die Furcht, die in der Verlagsbranche um sich griff, war real. Aber die einen verhielten sich tadellos, die anderen rückgratlos – wie Rushdies deutscher Verlag (damals noch KiWi), der ihm nicht nur kündigte, sondern auch noch die Kosten des Einbaus kugelsicherer Scheiben in seinem Büro in Rechnung stellen wollte.
Wokeness heißt diese Krankheit heute, die weltweit verbreitet ist wie einst das Covid-Virus. Angesehene Propagandisten der Aufklärung hissen die weiße Fahne. Dabei ist es doch ganz einfach. Niemand hat etwas gegen gläubige Muslime, auch Rushdie nicht, solange sie nicht versuchen, „die Wertvorstellungen anderer Menschen zu beeinflussen. Wenn die Religion aber politisch wird, gar zur Waffe, dann geht sie uns alle etwas an, da sie solch enormes Schadenspotenzial hat.“ So stellt er es in „Knife“ noch einmal klar.
Es ist am Ende eine Frage der Freiheit. Nur freie Menschen schreiben Bücher, nur freie Menschen verlegen, verkaufen und lesen sie. Heldenhaft an Rushdie ist, dass er im Kopf frei blieb, obwohl er niemals mehr frei sein konnte. Er besteht einfach nur auf seinem Recht, zu schreiben, wie es ihm beliebt.
Salman Rushdie, Knife. Gedanken nach einem Mordversuch. Penguin Verlag, Hardcover mit Schutzumschlag, 256 Seiten, 25,00 €.