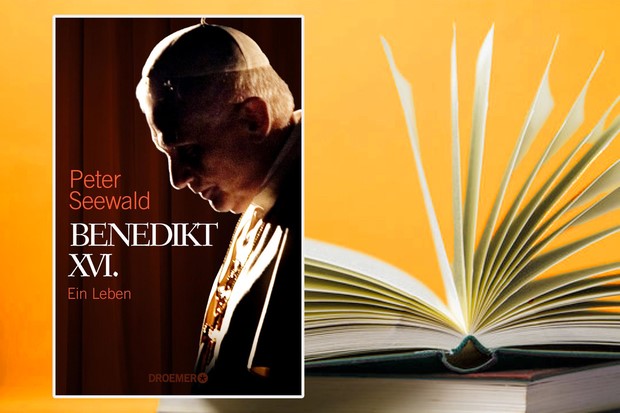Es war eine leise Stimme, die da anhob – und die sich dennoch zutraute, eine gewaltige Szenerie ins Bild zu setzen. Ratzinger begann (seine Festansprache zum 60. Priesterjubiläum von Josef Kardinal Frings – Anm. d. Red.) mit einer Situationsschilderung aus dem Jahre 375. Er liebte es, auf historische Zitate zurückzugreifen, um auf dieser Leinwand einen modernen Sachverhalt deutlich zu machen. »Womit sollen wir den gegenwärtigen Zustand der Kirche vergleichen?«, begann er seine Rede.
Die Frage stammte von Basilius dem Großen, einem der bedeutendsten Gestalten der Kirche überhaupt. Der Bischof von Caesarea in Kappadokien hatte von einer gewaltigen Seeschlacht erzählt. In einem »wirren, ununterscheidbaren Lärm«, der »das ganze Meer beherrscht«, sei ein Schiff in Gefahr, in die Tiefe zu sinken, und dennoch hätte die Besatzung, beherrscht von der »unbezwinglichen Krankheit der Ehrsucht«, ihren »Kampf um den Vorrang« noch immer nicht aufgegeben. Wobei die Unruhe, die in der Kirche tobe, so Basilius, noch weitaus »grausamer als das Gewoge des Meeres« sei. Wahrlich, »in ihr ist jede Grenze, die von den Vätern gezogen wurde, in Bewegung geraten, jeder Grundstein, jede Sicherheit der Lehren ist erschüttert. Alles löst sich auf; was sich über morschem Fundament erhebt, wankt. Übereinanderfallend stoßen wir uns gegenseitig nieder.« Und als wäre das Gemetzel nicht schon groß genug, witterten in dieser Situation »Neuerungssüchtige die beste Gelegenheit zum Aufruhr«.
»Dieser Text aus dem vierten Jahrhundert«, fuhr Ratzinger fort, klinge »überraschend modern«, und tatsächlich scheine er »geradezu eine Schilderung der Situation zu sein, in welche die Kirche nach dem Zweiten Vatikanum unversehens geraten ist.« Gewiss, die katholische Kirche habe zuvor vielfach den »Eindruck der Starre und der Uniformität« erweckt. Aber heute würden sogar jene, die sich »mehr Vielfalt und Bewegung wünschten«, über die Art erschrecken, »in der ihre Wünsche in Erfüllung gegangen sind«.
Die Rede von Köln dokumentiert präzise das Programm, dem sich Ratzinger als Theologe, als Bischof, als Präfekt und schließlich als Papst die nächsten vier Jahrzehnte widmen sollte. Sie verdient ausführlich zitiert zu werden, weil sie erhellende Einsicht in Ratzingers Denken gibt und aufzeigt, worin er die Probleme der modernen Kirche sah – und welche Option er für ihre Erneuerung empfahl. Wörtlich heißt es darin:
»Die Formel ›Wir sind die Kirche‹, in der Zeit der Jugendbewegung geprägt, erhält einen merkwürdig sektiererischen Sinn: Der Radius dieses Wir umfasst oft nur noch die jeweilige kleine Gruppe von Gesinnungsfreunden, die nun, auf dieses Wir pochend, eine Art Unfehlbarkeit verlangen. In Wahrheit sollte doch gerade dieser Satz alle Selbstgerechtigkeit der Gruppen ausschließen. Denn wahr ist er doch nur, wenn unter dem Wir die ganze Gemeinschaft aller Glaubenden, nicht nur von heute, sondern alle Jahrhunderte hindurch, gefasst und in dieses Wir das Ich Christi einbezogen wird, das uns erst zum Wir zusammenfasst.
Was die Kirche heute rettet, sind – menschlich gesprochen – nicht die vielfach zögernden und unsicheren Hierarchen, die sich entweder in Traditionalismus flüchten oder unsicher und besorgt sich nach den Theologen umsehen und Angst haben, als konservativ verschrien zu werden, wenn sie es wagen sollten, das Credo als eine klare Aussage anzusehen. Was die Kirche durch solche Stunden der Ungewissheit trägt, ist die Unbeirrbarkeit des Glaubens der Gemeinden, in denen die Einheit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vorgelebt und vorgelitten wird, jenseits von Traditionalismus und Progressivität: in der Realität eines Lebens heute, das vom Credo her heute bestanden wird.
Vielleicht müssen wir die Zerstörungen des Atheismus durchleben, damit wir überhaupt erst wieder entdecken können, wie unausrottbar und wie unverzichtbar der Schrei nach Gott aus dem Menschen aufsteigt. Damit wir endlich wieder merken, dass der Mensch eben wirklich nicht vom Brot allein lebt und dass er noch lange nicht erlöst ist, wenn er ein Einkommen hat, das ihm gestattet, alles zu besitzen, was er wünscht, und eine Freiheit, die ihm erlaubt, alles zu tun, was er möchte. Dann wird er erst merken, dass Freizeit allein nicht frei macht und dass mit dem Haben das ganze Problem des Seins erst beginnt. Dass er etwas braucht, was ihm der Kapitalismus des Westens so wenig gewährt wie der Marxismus.
Laut Ratzingers Krisenszenario hatte sich der nachkonziliare Prozess zu einem Selbstläufer entwickelt, der weder Substanz noch Ziel aufwies. Manche Repräsentanten einer radikalen Reform würden die Kirche vornehmlich unter dem Gesichtspunkt der Veränderung, der Objektivierung und der Funktion sehen. Dadurch aber würde ihr eigentliches, ihr geistliches Wesen nicht mehr erkennbar sein. Ein gefährlicher Progressismus bestimme längst die kirchliche Großwetterlage, aber er tauche das kirchliche Leben nicht in das Licht der Freude, sondern in ein tiefes Zwielicht.
Ratzinger unterschied im Wesentlichen drei Kräfte, zwischen denen ein Ringen um die zukünftige Gestalt von katholischer Kirche und Theologie stattfinde:
1. ein nachkonziliarer Progressismus, der sich mit dem neomarxistischen oder auch liberalen pragmatistischen Trend verbindet und beherrschend im Vordergrund steht;
2. ein engherziger Konservativismus, der sich an Formen der Vergangenheit klammert und in seiner Ablehnung des Konzils ins Sektiererische abzugleiten droht;
3. jene Kräfte, die das Zweite Vatikanum ermöglicht und getragen haben. Sie hätten eine Theologie und Frömmigkeit angestoßen, »die sich wesentlich von der Heiligen Schrift, von den Kirchenvätern und von dem großen liturgischen Erbe der Gesamtkirche« herleiteten, seien aber danach von einer Welle der Modernität überrollt worden.
Es war in der Tat paradox: Eigentlich sollte eine immer weitergehende Öffnung und Liberalisierung das Image der katholischen Kirche in der Öffentlichkeit verbessern, doch genau das Gegenteil trat ein. Je moderner sie sich gerierte, umso mehr erschien sie den Menschen als ein Hort der Unterdrückung, der Vergehen und der Gestrigkeit. Seine Diagnostik legte Ratzinger 1970 auch in verschiedenen Rundfunkbeiträgen vor. Sie sollte dabei nicht nur »die Erschütterungen des Glaubens durch die Krise der Gegenwart« behandeln, sondern auch »die Faszination des Zukünftigen«. Er wolle versuchen »aufzuschließen«, erklärte er, um das »Zukunftsträchtige« zu zeigen, »das im Glauben gerade dann liegt, wenn er sich selbst treu bleibt«.
Ratzingers Alternativprogramm fasste ein Aufsatz über die Kirche im Jahr 2000 zusammen. (…) Dem kirchlichen Establishment, das sich noch ganz im Vollbesitz katholischer Pfründe wähnte, dürfte weder die Diagnose noch Ratzingers davon abgeleitete Vorhersage gefallen haben. Neben dem selbstbewussten Schwung zeugt der hier in Auszügen wörtlich wiedergegebene Essay von der Aussagekraft des Autors. In die Zukunft blickend hielt er fest:
Die Zukunft der Kirche … wird nicht von denen kommen, die nur Rezepte machen. Sie wird nicht von denen kommen, die nur den bequemeren Weg wählen. Die der Passion des Glaubens ausweichen und alles für falsch und überholt, für Tyrannis und Gesetzlichkeit erklären, was den Menschen fordert … Sagen wir es positiv: Die Zukunft der Kirche wird auch dieses Mal, wie immer, von den Heiligen neu geprägt werden. Von Menschen also, die mehr wahrnehmen als die Phrasen, die gerade modern sind, sondern tiefe Wurzeln haben und aus der reinen Fülle ihres Glaubens leben.
Aber bei allen diesen Veränderungen, die man vermuten kann, wird die Kirche ihr Wesentliches von Neuem und mit aller Entschiedenheit in dem finden, was immer ihre Mitte war: im Glauben an den dreieinigen Gott, an Jesus Christus … Es wird eine verinnerlichte Kirche sein, die nicht auf ihr politisches Mandat pocht und mit der Linken so wenig flirtet wie mit der Rechten. Sie wird in Glaube und Gebet wieder ihre eigentliche Mitte erkennen und die Sakramente wieder als Gottesdienst, nicht als Problem liturgischer Gestaltung erfahren. Sie wird es mühsam haben. Denn der Vorgang der Kristallisation und der Klärung wird ihr auch manche gute Kräfte kosten. Er wird sie arm machen, zu einer Kirche der Kleinen sie werden lassen.
Der Prozess wird lang und mühsam sein … Aber nach der Prüfung dieser Trennungen wird aus einer verinnerlichten und vereinfachten Kirche eine große Kraft strömen. Denn die Menschen einer ganz und gar geplanten Welt werden unsagbar einsam sein. Sie werden, wenn ihnen Gott ganz entschwunden ist, ihre volle, schreckliche Armut erfahren. Und sie werden dann die kleine Gemeinschaft der Glaubenden als etwas ganz Neues entdecken. Als eine Hoffnung, die sie angeht; als eine Antwort, nach der sie im Vorborgenen immer gefragt haben… als Heimat, die ihnen Leben gibt und Hoffnung über den Tod hinaus.« (…)
Inzwischen sei es vielfach jedoch so, fuhr Ratzinger fort, dass man immer weniger von der Kirche Gottes spreche. »An die Stelle Seiner Kirche ist unsere Kirche und sind damit die vielen Kirchen getreten – jeder hat die seinige.« Auf diese Weise seien »viele kleine Privateigentümer« nebeneinander entstanden, »lauter ›unsrige‹ Kirchen, die wir selber machen, die unser Werk und Eigentum sind und die wir demgemäß entweder umgestalten oder erhalten wollen«. Doch eine Kirche, die nicht »Seine Kirche« sein wolle, »wäre ein überflüssiges Sandkastenspiel«. Damit gab Ratzinger die Antwort auf sein Thema: »Ich bin in der Kirche, weil ich daran glaube, dass nach wie vor – und unaufhebbar durch uns – hinter unserer Kirche Seine Kirche steht. Und dass ich bei Ihm nicht anders stehen kann, als indem ich bei und in seiner Kirche stehe.« Ohne die Kirche gebe es Jesus nur als historische Reminiszenz. Kirche, so Ratzinger, mache Christus auch in der Gegenwart lebendig. Trotz aller Schwächen. »Was immer es in der Kirche an Untreue geben mag und gibt, wie sehr es wahr ist, dass sie immer ständig neu Maß nehmen muss an Christus, so gibt es doch keine letzte Entgegensetzung von Christus und Kirche.« Sie gebe der Menschheit ein Licht und einen Maßstab »weit über die Grenzen der Glaubenden hinaus«.
In seinem Plädoyer verwies Ratzinger auf den Glauben als Communio. Das »Ich glaube« der Credo-Formel sei im Grunde ein kollektives Ich. Der Einzelne glaube ja nicht aus seinem Eigenen heraus, sondern mitglaubend mit der Kirche aller Jahrhunderte, die wiederum zu internationaler Solidarität in der Gleichheit der Völker verpflichtet sei. Bei all den Schattenseiten der Kirche: Wenn man die Augen offen halte, sehe man Menschen, die »lebendiges Zeugnis der frei machenden Kraft des christlichen Glaubens« sind.
Und um sein Bekenntnis auf den kürzest möglichen Nenner zu bringen, fügte er hinzu: »Wenn man sich so indiskret ausdrücken will, würde ich sagen, ich bleibe in der Kirche, weil ich sie liebe.« Spätestens an dieser Stelle waren Tausende von Hörern am Radio aufs Herz gerührt. Gewiss, »Liebe macht blind«, fuhr Ratzinger fort. Und irgendetwas an dieser Volksweisheit sei wohl wahr. »Aber nicht weniger wahr ist, dass Liebe sehend macht. In einem alten, runzligen Gesicht, das, äußerlich betrachtet, keine Schönheit hat, entdeckt sie uns den Menschen, der dieses Gesicht beseelt und der unserer ganzen Liebe wert ist. Im Gesicht der Kirche entdeckt sie uns durch so viel Runzeln und Narben hindurch das Geheimnis des Herrn, das durch dieses Gesicht hindurchleuchtet.«
Klar, man könne an dieser Stelle von Beschönigung sprechen. »Aber ich glaube, wir täuschen uns da. Wirkliche Liebe ist nicht unkritisch. Und ist nicht statisch. Im Gegenteil. Sie allein ist die Kraft, die verwandeln kann und die aufbaut. Und so sollten wir doch wohl auch heute wieder mehr den Mut haben, die Kirche mit den Augen der Liebe zu sehen, um auf die Liebe als die wahre Kraft der Reform, der Verjüngung und der Erneuerung zu bauen.«
Gekürzter und um die im Buch enthaltenen Fußnoten bereinigter Auszug aus:
Peter Seewald. Benedikt XVI. Ein Leben. Droemer Verlag, Hardcover mit Schutzumschlag und zwei Lesebändchen, 1184 Seiten, 38,00 €
Empfohlen von Tichys Einblick. Erhältlich im Tichys Einblick Shop >>>