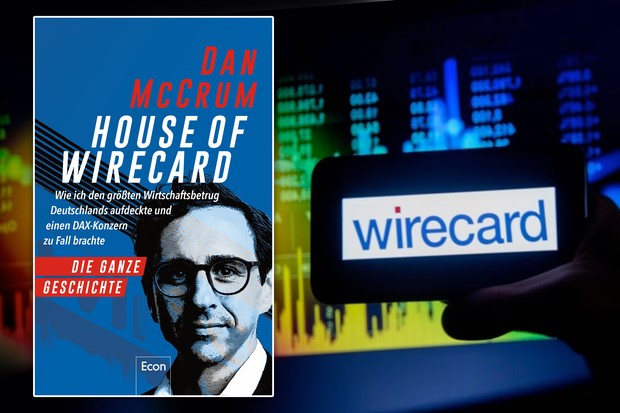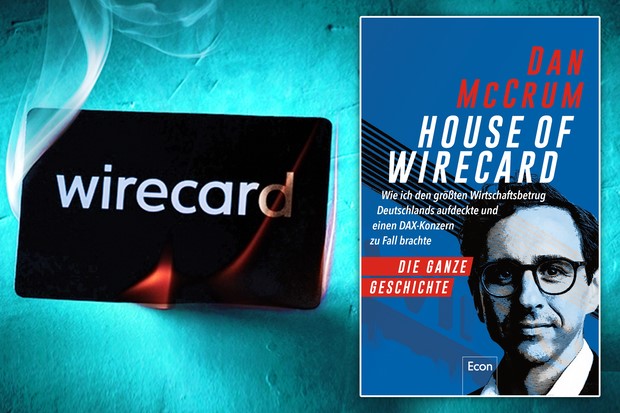Ende 2018 und Anfang 2019 hatte ich zwei Monate wie ein Eremit in einem Bunker an einer Seite des Newsrooms der Financial Times zugebracht. Ich hatte »off the grid« gearbeitet, abseits vom Netz und außerhalb der Reichweite von Hackern; jeden Abend hatte ich meinen Offline-Computer und meine Notizhefte in einen Tresor mit 15 Zentimeter dicken Stahlwänden weggeschlossen. Doch die Paranoia nahm ich mit mir nach Hause, beäugte andere Pendler mit Argwohn und achtete auf Anzeichen dafür, dass ich überwacht würde, denn ich wusste, dass meine Informanten unter Beobachtung standen. Sie waren nervös und ungeduldig, und dann wurde eine von ihnen krank. Sie hatte gedacht, es sei Stress, doch der Arzt hatte schlechte Nachrichten: Es sehe aus wie ein Hirntumor. Würde ihr noch genug Zeit bleiben, um Gerechtigkeit zu erleben?
Mit gesenktem Kopf erwartete ich das Urteil des Chefredakteurs Lionel Barber. Wir saßen in seinem Büro im ersten Stock des FT-Gebäudes in London, direkt an der Themse mit Blick über die Southwark Bridge. In diesem Raum schwang er anfeuernde Reden oder machte Leute zur Sau. Ich saß mit dem Rücken zum Fluss und blickte auf ein Foto, das Barber mit Imran Khan – einem ehemaligen pakistanischen Profi -Kricketspieler, der zum Politiker mutiert war – beim Kricket zeigte, während ich versuchte, meinen nervös wippenden Fuß unter Kontrolle zu bringen. Barber war ein beliebter und respektierter Journalist und bekannt als Namedropper. Er hatte sich den Spitznamen »Lionel the Movie« erworben, weil er dazu neigte, sich in den Mittelpunkt dramatischer Ereignisse zu stellen. Er war ein geselliger und begeisterungsfähiger Typ, wenn alles gut lief – aber wenn nicht, war er kleinkariert und bissig.
Draußen war es dunkel, der Tag ging zu Ende, die internationale Ausgabe der Zeitung war fast fertig, und Barber hatte Zeit, uns zu treffen. Ich beobachtete ihn in seinem Anzug, mit Krawatte und Joggingschuhen, einer bloßen Andeutung von Grau an den Schläfen und Lesebrille auf der Nasenspitze, während er die Story mit einem Füller redigierte und in strengem Ton Korrekturen und Ergänzungen vorlas. Als er fertig war, hielt er einen Moment inne und wog das Manuskript in seinen Händen.
Ich atmete einmal tief durch. »Er ist Anwalt, und er riskiert seine Karriere und seine persönliche Sicherheit, indem er mit uns spricht. Er will das Richtige tun, und ich glaube ihm, aber das Entscheidende ist, dass wir nicht darauf angewiesen sind, ihm zu glauben. Wir haben die Dokumente.« Ich hatte hieb- und stichfeste Beweise für jeden einzelnen Aspekt dieser Story, und so berief ich mich auf die Fakten und zählte Details auf. Barber hörte konzentriert zu.
Zu meiner Linken saß Paul Murphy, ein altgedienter FT-Redakteur, der mich in dieser Sache auf jedem Schritt des Weges begleitet hatte. Was wir vermuteten, aber nicht mit Sicherheit wussten, war, dass Barber seine eigene Uhr ticken hatte. Es waren Gerüchte im Umlauf, dass er kurz davorstand, in den Ruhestand zu gehen; was wir als Nächstes tun würden, konnte sein Vermächtnis krönen – oder es komplett ruinieren, falls wir falschlagen. Als Paul sah, dass Barber mit den Augen rollte, da ich mich wieder einmal allzu sehr in Details verlor, unterbrach er mich und kam direkt zur Sache. »Wissen Sie, selbst die eigenen Anwälte der Firma glauben, dass sie Betrüger sind, ohne Zweifel. Wir haben es schwarz auf weiß.«
Instinktiv vermied er es, den Namen der Firma auszusprechen, als ob dessen Nennung sie plötzlich wie Lord Voldemort erscheinen lassen würde. Es war ein unausgesprochener Aberglaube, dem Murphy und ich uns verschrieben hatten, um nicht eventuellen Lauschern ein Stichwort zu liefern und ihre Aufmerksamkeit zu wecken. Wir sprachen immer nur von »The Company« oder, im Kontext dieser Recherchen, von »Ahab«; ich war der Firma so lange auf den Spuren gewesen, dass sie zu einem Running Gag im Newsroom geworden war – einem großen weißen Wal, den ich nicht entkommen lassen konnte, wie seinerzeit Kapitän Ahab in Herman Melvilles Abenteuerroman Moby Dick.
Was ich mit Sicherheit wusste, war Folgendes: Die Firma hieß Wirecard. Sie hatte etliche Milliarden Euro an der Börse eingesammelt, als Europas Antwort auf PayPal, ein Bezahldienst, der Provisionen kassiert auf Online-Zahlungen in Höhe von vielen Billionen Euro, die jedes Jahr durchs Netz strömen. Doch die Wahrheit war viel bemerkenswerter: Die Firma war von einem Porno-Magnaten an die Börse gebracht worden und hatte mittlerweile Dutzende von Tochtergesellschaft en weltweit, von denen manche gar kein aktives Geschäft zu betreiben schienen; Kritiker der Firma waren von Hackern angegriffen, gestalkt oder körperlich bedroht worden. Überall blinkten rote Alarmsignale, und dennoch schworen viele Aktienanalysten Stein und Bein, dass der Kaiser prächtig gekleidet sei – soeben hatte die Firma am Aktienmarkt sogar die Deutsche Bank überholt. Wirecards milliardenschwerer Vorstandsvorsitzender, neudeutsch CEO, und Hauptaktionär wurde als technologischer Visionär gefeiert, Wegbereiter einer Zukunft, in der es keine Banknoten und Münzen mehr geben und alles Geld digital sein würde.
Endlich hatte ich Beweise dafür, dass irgendetwas in der Firma oberfaul war – ein Dokument, das mir den Atem stocken ließ, als ich es zum ersten Mal zu Gesicht bekam. Auf jeder Seite stand oben eine nachdrückliche Warnung: »Rechtlich geschützt und streng vertraulich. An einem geheimen und sicheren Ort aufbewahren. Es ist nicht gestattet, dieses Dokument zu kopieren oder es Dritten zugänglich zu machen.« Es war der kühnste Traum eines jeden Investigativreporters – ich wusste, dass nur wirklich brisante Sachen in den Genuss einer solchen Behandlung kommen. Mit zusammengekniffenen Augen starrte ich auf das Display meines Smartphones und überflog das Inhaltsverzeichnis des Dokuments, abgefasst in Großbuchstaben. Zuerst kam eine Folge von seltsam klingenden Firmennamen, aber dann sprangen einzelne Worte hervor: BILANZBETRUG; FÄLSCHUNG; KORRUPTION; GELDWÄSCHE. Es war unglaublich. Mir wurde schwindelig; seit Monaten hatte ich darauf hingearbeitet, genug Selbstgewissheit aufzubauen, um diese Worte in gedruckter Form zu veröffentlichen.
Ich schlug in die gleiche Kerbe wie Murphy. »Ihr ganzes Geschäft besteht darin, Geld um die Welt zu schicken. Sie haben ihre eigene Bank, die sich ins internationale Finanzsystem eingeschlichen hat. Sie tun so, als ob sie eine blütenweiße Weste hätten.«
Barber nickte. Er drehte sich zur vierten Person am Tisch, Nigel Hanson, einem spöttischen Anwalt in Hemdsärmeln, der in einem dicken Ordner alles, was gesagt wurde, detailliert notierte. Er hatte die Geschichte mit größter Sorgfalt auf eventuelle juristische Probleme durchkämmt, und bei jedem Durchgang fand er einen neuen Stolperstein, der aus dem Weg geräumt werden musste – ein unbedachtes Wort, das einem der gefürchtetsten juristischen Kettenhunde Londons, der Kanzlei Schillings, etwas gab, woran er sich festbeißen konnte. Hanson wirkte manchmal ein bisschen gequält, wie der heldenhafte Verteidiger der Financial Times, und nutzte jede sich bietende Gelegenheit, um allzu kantige Formulierungen ein bisschen zu entschärfen, soweit das möglich war. Barber vertraute ihm. »Wie hoch ist das juristische Risiko?«
Hanson legte seinen Stift beiseite. Ausnahmsweise wirkte er entspannt. »Im Hinblick auf eine Verleumdungsklage haben wir starke Argumente: solide Beweise, ein klares öffentliches Interesse und die begründete Überzeugung, dass das, was wir haben, wahr ist. Aber wir müssen mit der Möglichkeit rechnen, dass sie trotzdem klagen, weil die Geschichte für sie extrem schädlich ist. Sie haben unbegrenzte Ressourcen.«
Das brachte die Entscheidung. Barber sagte erbost: »Ich werde mich nicht einschüchtern lassen. Die Story ist gut. Wenn sie uns verklagen wollen, sollen sie es ruhig versuchen.«
Das war für uns das Signal zu gehen. Angesichts der Aussicht, die Story auf die Öffentlichkeit loszulassen, nachdem ich monatelang daran gearbeitet hatte, fühlte ich eine Mischung aus Hochstimmung und Übelkeit. Ich würde den Informanten das geben, was sie unbedingt erreichen wollten, sie aber auch dem Risiko aussetzen, aufzufliegen. Als wir aufstanden, äußerte Hanson ein letztes Anliegen: »Wenn es okay ist, würde ich gern eine zweite Meinung einholen, nur um auf der sicheren Seite zu sein.«
Um 18.30 Uhr an jenem Abend warteten Hanson und ich vor Barbers Büro, in der sogenannten »Spitzkehre«, dem Korridor der Macht am Ende des Newsrooms, wo die höheren Tiere ihre Büros hatten. Wir waren im Begriff, an einem der teuersten Gespräche teilzunehmen, bei dem ich je dabei war: einem Telefonat mit einem »Silk« (Seidentalar), einer »Queens Counsel« (Kronanwältin), die auf der obersten Stufe der juristischen Karriereleiter angekommen war. Murphy instruierte mich stichwortartig, wie man mit einem so exotischen Biest umzugehen hat. »Sie glauben, Götter zu sein. Kolossale Egos. Ganz egal, wie’s läuft, gerate nicht in eine Diskussion. Ein QC ist es gewohnt, die wichtigste Person im Raum zu sein. Wenn du anderer Meinung bist als sie, besteht sie nur noch hartnäckiger auf ihrem Standpunkt.«
Die Dame kam direkt zur Sache. »Ich habe den Bericht des Anwalts und den Entwurf des Berichts überflogen. Würde ich die andere Seite beraten, dann würde ich ihnen empfehlen, eine einstweilige Verfügung zu beantragen.«
Hanson konnte sie dazu bewegen, etwas genauer zu erklären, was sie damit meinte. Die Kanzlei Schillings konnte am Obersten Gerichtshof in London einen Eilantrag stellen und fordern, die Veröffentlichung der Story zu stoppen, wegen eines Bruchs der Vertraulichkeit durch die Weitergabe interner Geschäftsunterlagen. Wir würden vor Gericht erscheinen müssen, zeigen, was wir drucken wollten, und dann versuchen, den Richter zu überzeugen, dass die Veröffentlichung im öffentlichen Interesse sei. Vielleicht würde die Sache sofort entschieden, aber wahrscheinlicher sei, dass das Gericht sich um sechs Wochen vertagen würde, um beiden Seiten genug Zeit zu geben, ihre Argumentation vorzubereiten.
In dieser Zeit würden wir den Bericht nicht drucken können, was eine Katastrophe wäre. Wirecard würde sechs Wochen Zeit bekommen, möglicherweise Spuren verwischen und Tarngeschichten erfinden, und es bestand die Gefahr, dass man uns endgültig einen Knebel verpassen würde. Wir würden riskieren, unsere Informanten preiszugeben, ohne damit irgendetwas zu erreichen. Und dann wären da ja auch noch die potenziellen Prozesskosten für beide Seiten, mit Leichtigkeit ein sechsstelliger Betrag.
»Meiner Einschätzung nach würden Sie ein hohes Risiko eingehen, dass eine einstweilige Verfügung beantragt und erlassen würde.«
Barber streckte die Arme aus, als ob er gegen die Entscheidung eines Schiedsrichters protestieren wollte. »Und wo bleibt das öffentliche Interesse?«
Es gelang mir nicht, meinen Ärger zu kontrollieren, und ich mischte mich ein: »Wir haben klare Beweise für kriminelles Verhalten. Es liegt doch bestimmt im öffentlichen Interesse, das aufzudecken?«
Sie ließ sich nicht beeindrucken. »Klare Beweise? Es heißt, dies sei lediglich ein Zwischenbericht. Wo sind die endgültigen Ergebnisse der Ermittlungen?«
Ich wollte schreien. »Die Ermittlungen wurden eingestellt. Darum ist der Whistleblower ja überhaupt erst auf uns zugekommen, weil die Sache vertuscht wurde.«
»Und würde diese Person das in einem Gerichtsverfahren bezeugen?«
Rings um den Tisch waren grimmige Gesichter zu sehen; wir alle kannten die Antwort auf diese Frage. Ich hatte lange genug als Journalist gearbeitet, um zu wissen, dass die Londoner Gerichte eine Katastrophe waren, der man lieber aus dem Weg gehen sollte – eine Waffe, die Oligarchen und Despoten einsetzen, um Widersacher einzuschüchtern und offene Rechnungen zu begleichen. Aber dies war ein neuer Tiefpunkt. Als das Telefonat beendet war, hatten wir mehrere Tausend Pfund aus der Kasse der Financial Times ausgegeben – und das nur, um jetzt meinen Bericht zu schreddern. Murphy fluchte, wie idiotisch das System sei. Ich stand unter Schock; dies war die beste Chance, die ich je gehabt hatte. Was sollte ich bloß den Whistleblowern sagen?
Barber schickte uns raus in die Dunkelheit: »Dieses Problem werden wir heute Abend nicht mehr lösen, und ich muss meinen Flug nach Tokio kriegen. Ich will, dass wir eine Möglichkeit finden, diese Story zu drucken.«
*
Fünf Tage nachdem die Kronanwältin die Story abgeschossen hatte, klingelte mein Wecker morgens um 5.30 Uhr. Es war Mittwoch, der 30. Januar 2019. Ich hatte schlecht geschlafen in der vorigen Nacht, und sobald ich die Augen öffnete, spürte ich einen Adrenalinschub. Dies war der Moment der Wahrheit. Wir hatten die Story auf das absolute Minimum zusammengestrichen und sie auf einer Präsentation aus meinem Bestand an Dokumenten aufgebaut, in der weder Vertraulichkeit noch das Anwaltsgeheimnis erwähnt waren. Gegen einen Chefbuchhalter im mittleren Management des asiatischen Hauptsitzes des Konzerns war ermittelt worden, weil der Verdacht bestand, er habe die Bücher frisiert. Doch anstatt suspendiert oder gefeuert zu werden, war er befördert worden.
Es war zu früh, um Kaffee zu machen; die Kaffeemühle hätte die Kinder aufgeweckt. Also begnügte ich mich mit Tee, setzte mich in meinem abgetragenen Morgenmantel an den Schreibtisch und bereitete mich darauf vor, ihn unter seiner Büronummer anzurufen. Der Plan war, um 6 Uhr morgens Fragen zu schicken, dann war es früher Nachmittag in Singapur und Arbeitsbeginn in München, das London eine Stunde voraus war. Ich wartete bis 5.53 Uhr und wählte dann seine Nummer.
»Hallo, spreche ich mit Edo?«
»Ja, hallo.«
»Edo Kurniawan?«
»Ja. Kann ich Ihnen helfen?«
»Und Sie sind nach wie vor Chef des Bereichs International Finance?«
Ich hörte ein zustimmendes Geräusch. »Prima. Ich heiße Dan McCrum und rufe im Namen der Financial Times an, ich bin eine Zeitung.« Nein, ich war keine Zeitung, vielleicht hätte ich doch Kaffee machen sollen. »Pardon, für die Zeitung Financial Times. Ich wollte, ähm, ich wollte mit Ihnen über eine Angelegenheit sprechen, hmhmm, über die wir berichtet haben. Ich werde Ihnen nach diesem Telefonat ein paar Fragen schicken und wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie einmal einen Blick darauf werfen könnten, und zwar relativ bald. Falls Sie dazu Stellung nehmen möchten, müssten Sie das bis heute Abend tun, bis spätestens 21 Uhr Singapur-Zeit. Ja, spätestens heute Abend.« Mein Herz hämmerte. Jetzt kommt’s: »Okay. Also, die Hauptsache ist, dass nach meinen Informationen gegen Sie wegen Ihrer Beteiligung an verdächtigen Transaktionen bei Wirecard, Rückdatierung und Fälschung von Dokumenten ermittelt wurde.«
Kurniawan unterbrach mich. »Davon weiß ich nichts. Ich bin im Moment mitten in einem Meeting. Tatsächlich bin ich gerade dabei, die Konzernabschlussprüfung fertigzustellen«, sagte er. Es war klar, dass er höflich, aber möglichst schnell das Telefonat beenden wollte. »Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.« Klack.
Ich warf triumphierend die Arme hoch. Wir waren im Geschäft, die Story war okay. Sie war nur ein winziger Bruchteil dessen, was ich über die Firma wusste, der Fakten, Theorien und Gerüchte, die ich über die Jahre gehört hatte: dass sie Zahlungen für Hardcore-Pornografie abgewickelt habe, mit der Mafia unter einer Decke stecke, Aufsichtsbeamte und Politiker geschmiert habe, angeblich florierende Tochterunternehmen lediglich Scheinfirmen seien, sie vor kaum etwas zurückschrecke, um nicht aufzufliegen. Aber die Story war ein Anfang, ein Signal für den Rest der Welt, dass etwas nicht stimmte. Würde es funktionieren? Die Fragen waren fertig, und ich schickte sie ab. In sieben Stunden würden wir Antworten haben.
Auszug aus: Dan McCrum, House of Wirecard. Wie ich den größten Wirtschaftsbetrug Deutschlands aufdeckte und einen DAX-Konzern zu Fall brachte. Die ganze Geschichte. Econ, 464 Seiten, 25,00 €.