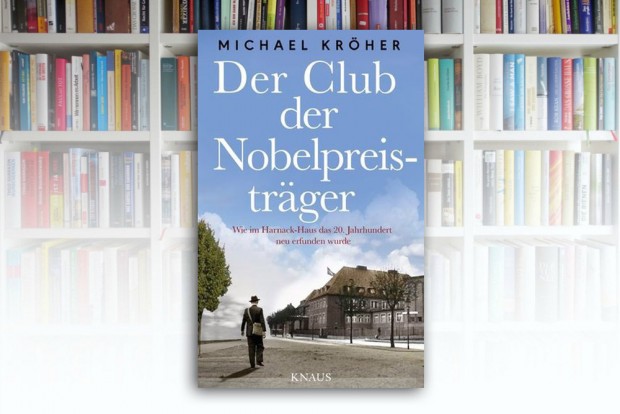In den Zirkeln der Wirtschafts- und Wissenschaftsförderer, also bei jenen Schattengestalten, die Professoren und Unternehmern Zugänge zu staatlichen Geldtöpfen öffnen, genießt Otto Warburg Kultstatus.
Wie kriegt man 10.000 Mark?
Die Ursache dafür ist ein in der Zeitschrift Nature im Jahr 2011 veröffentlichtes Faksimile eines Forschungsantrages, den der Biochemiker wohl Anfang der 1930er Jahre formulierte. „Ich benötige 10 000 (zehntausend) Mark“ hatte Warburg eine Sekretärin damals tippen lassen. Mehr zu sagen, etwa die geplanten Experimente zu beschreiben oder gar die beabsichtigte Verwendung der Mittel aufzuschlüsseln, erschien ihm nicht notwendig. Und das war es ja auch nicht. Warburgs Wunsch wurde ohne weitere Rückfragen erfüllt. Was ihn heute zum Helden all jener macht, die sich tagtäglich durch den bürokratischen Dschungel der Förderlinien und des Vergaberechts kämpfen. Wer nun mehr über die Hintergründe dieses wohl einmaligen Vorgangs wissen möchte, der sollte Michael Kröhers „Der Club der Nobelpreisträger“ lesen.
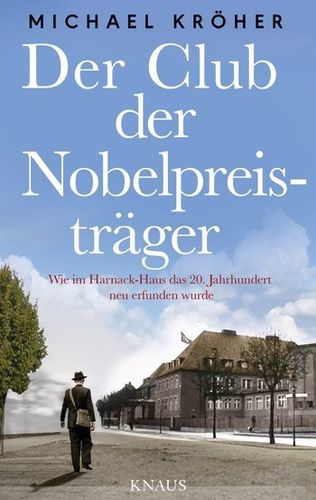
Jedenfalls dann, wenn es um die im Jahr 1911 gegründete Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG) geht. Mit ihr etablierte man in Deutschland ein damals revolutionäres Konzept der Wissenschaftsförderung. Aus staatlichen wie privaten Zuwendungen entstanden Refugien für die besten Köpfe unterschiedlicher Fachgebiete, in denen sich diese frei von sonstigen Obliegenheiten, insbesondere frei von den organisatorischen Begrenzungen und zeitfressenden Lehrverpflichtungen des herkömmlichen Universitätsbetriebs, vollumfänglich ihrer Forschung in von ihnen selbstgewählten Aspekten widmen konnten. Räumlich konzentrierte man zentrale Funktionen der Verwaltung und zahlreiche wichtige Institute auf einem Gelände in Berlin-Dahlem. Viele der bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs dort entstandenen Infrastrukturen existieren noch heute und werden mittlerweile von der Freien Universität Berlin genutzt. Auch das 1929 als Tagungs- und Begegnungsstätte eröffnete, nach dem ersten Präsidenten der KWG, dem Religionswissenschaftler Adolf von Harnack benannte Gebäude, wird heute unter der Ägide der Max-Planck-Gesellschaft wieder seinem ursprünglichen Zweck entsprechend betrieben. Wie schon zu Zeiten der Weimarer Republik verfügt es über Zimmer für auswärtige Gäste, über Hörsäle und Sitzungsräume in unterschiedlichen Größen und über eine Gastronomie, die nicht nur der Versorgung der Teilnehmer von Konferenzen und Kongressen dient, sondern auch von Dozenten und Studenten der umliegenden Forschungseinrichtungen genutzt werden kann. Nur die Nobelpreisträger fehlen, jedenfalls in der Anzahl und Dichte, in der sie sich einst dort miteinander, mit der Politik und der breiten Öffentlichkeit trafen.
Kaiser-Wilhelm wusste schon warum
Das gehäufte Auftreten herausragender Forscherpersönlichkeiten zwischen den Kriegen ist auf die Innovationsdynamik im sich rasant industrialisierenden Kaiserreich zurückzuführen. Denn der technische Fortschritt geht dem wissenschaftlichen voraus. Die neuen Möglichkeiten, die im Maschinen- und Anlagenbau, in der elektrotechnischen und in der chemischen Industrie entstanden, zeigten den Forschern nicht nur auf, welche Fragen sie an die Natur zu stellen hatten, sie lieferten ihnen gleichzeitig auch noch das dazu notwendige Instrumentarium. Von daher gehe ich nicht mit Kröher überein, wenn er sagt, im Harnack-Haus, also in der Dahlemer Forscherkolonie, sei das zwanzigste Jahrhundert neu erfunden worden. Nein, in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und ihren prominenten Protagonisten gipfelten die Umwälzungen des neunzehnten Jahrhunderts, sie wurden dort vollendet und abgerundet.
Aus zeitgenössischer Perspektive bestand die Bestimmung der KWG darin, der sich abzeichnenden nordamerikanischen Dominanz in den Naturwissenschaften etwas entgegenzusetzen und die bedeutende Stellung Deutschlands zu bewahren. So wurde, wie Kröher spannend beschreibt, das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik im Jahr 1917 allein zu dem Zweck gegründet, dem aus Zürich durch intensives Werben der Koryphäen Planck, Haber und Nernst nach Berlin gelockten Albert Einstein eine Stellung und ein Auskommen zu verschaffen. Das Institut selbst war in seinen ersten Jahren räumlich mit Einsteins Privatwohnung identisch und hatte außer dem Erschaffer der Relativitätstheorie nur einen weiteren Mitarbeiter. Kröher schildert Einsteins Berliner Phase und dessen wachsende Distanz zu Deutschland mit eindringlicher Intensität. Der Leser spürt, wie langsam aber sicher das Böse von außen in das Berliner Forscherparadies eindringt, wie den in vielen Aspekten dem Alltäglichen entrückten Wissenschaftlern zunehmend abverlangt wird, zwischen der Loyalität zur eigenen Nation und der Solidarität mit ihren Kollegen, der Verteidigung der Freiheit der Forschung und den an sich selbst angelegten ethischen und moralischen Maßstäben zu wählen. Einstein entschied sich aufgrund der zunehmenden antisemitischen Ressentiments, denen er in Berlin ausgesetzt war, nach einer Vortragsreise in die USA im Jahr 1932 nicht mehr nach Deutschland zurückzukehren. Andere aber blieben.
Kröhers Buch verdeutlicht, wie gerade durch das Harnack-Haus, durch die Schnittstelle zwischen dem brodelnden Berlin und der idyllischen, weitläufigen, mit allerlei Sport- und Freizeitanlagen versehenen Parkanlage, die die Laboratorien der Nobelpreisträger umgab, die grimmige Realität in das Eldorado der Wissenschaft einsickerte und auf die völlig unvorbereiteten, teils naiven und politisch unbedarften Geistesgrößen traf. Dilettantisch mutet aus heutiger Sicht an, wie Otto Hahn, Peter Debye und Max von Laue die Flucht der großen Lise Meitner planten und vorbereiteten. Zwar glückte die heimliche Ausreise mit dem Zug in die Niederlande am 12. Juli 1938, von wo sie per Flugzeug zunächst nach Dänemark und schließlich in ihr endgültiges Exil nach Schweden weiterreiste, aber völlig mittellos stand sie nun da, mit nur einem einzigen Koffer, den sie, so Kröher „nach 31 Jahren Forschungsarbeit in Deutschland mitnehmen“ konnte. Nicht einmal für ausreichend Bargeld hatten die Kollegen gesorgt, weswegen sich Hahn gezwungen sah, ihr noch einen Diamantring zuzustecken, ein Erbstück seiner Mutter. Als das erlösende Telegramm aus Groningen mit dem Wortlaut „Das Baby ist glücklich angekommen“ eintraf, wich die Anspannung zunächst nicht, denn immerhin hatte man einer gebürtigen Jüdin, die nach dem Anschluss Österreichs auch noch ohne es zu wollen die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt, zu einer verbotenen „Reichsflucht“ verholfen. Kröher berichtet von dem Nervenzusammenbruch, den Otto Hahns Frau Edith in der Folge dieser dramatischen Ereignisse erlitt. Und erzählt, wie ihr Mann sich trotzdem nicht davon abhalten ließ, weiteren durch das Regime bedrohten Kollegen zu helfen.
Kröher erspart uns allerdings nicht, neben den Heldengeschichten auch die Kollaborateure zu benennen, wie die Anthropologen und Humangenetiker Eugen Fischer und Otmar von Verschuer, die das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik nur allzu bereitwillig in den Dienst der Nationalsozialisten stellten. Er lenkt den Blick zudem auf die von Merkwürdigkeiten und Ungereimtheiten geprägte Geschichte der deutschen Kernforschung in jener Zeit. Mit der detaillierten Schilderung des legendären Treffens am 4. Juni 1942, zu dem sich um 18 Uhr Rüstungsminister Albert Speer, dessen technischer Berater Ferdinand Porsche und eine ganze Reihe hoher Offiziereim Helmholtz-Saal des Harnack-Hauses einfanden, um mit Werner Heisenberg, Kurt Diebner, Otto Hahn und anderen Dahlemer Fürsten zu konferieren, fügt Kröher dem Mythos von der deutschen Atombombe ein weiteres Kapitel hinzu. Ob die dort versammelte Genialität der ihr gegenübersitzenden Generalität absichtlich, aus Unkenntnis oder schlicht aus Unvermögen die Kernwaffe ausredete, bleibt aber auch weiterhin offen. Eine surreale Wucht entfaltet sich schließlich in der Schilderung des gemeinsamen nächtlichen Spaziergangs, den der Chemiker Adolf Butenandt und eben Heisenberg in Ermangelung anderer Transportmöglichkeiten im März 1943 durch das kurz zuvor vom Bombenhagel getroffene Berlin unternahmen. Angesichts zerstörter und brennender Gebäude begannen die beiden Koryphäen dabei abstrakte Debatten über die Rolle der Wissenschaft in Deutschlands Zukunft.
Das Ende der Wissenschaft, wie wir sie kennen
Nur einen tangierte das alles nicht. Otto Heinrich Warburg, der den anfangs erwähnten Förderantrag „ausarbeitete“, ließ sich nicht beirren. Der Lebensgeschichte des Jahrhundertgenies widmet Kröher unter der Überschrift „Der Dandy von Dahlem“ das stärkste Kapitel seines Buches. Nach dessen Lektüre man sich verwundert fragt, warum noch kein Produzent auf den Gedanken kam, diese fesselnde Biographie zu verfilmen. Der gemäß der Nürnberger Rassegesetze als „jüdischer Mischling ersten Grades“ geltende Biochemiker lebte nicht nur mehr oder weniger offen homosexuell in einer Beziehung mit Jacob Heiss, offiziell sein Sekretär für mehr als fünfzig Jahre, er verbot in seinem Kaiser-Wilhelm-Institut für Zellphysiologie auch noch das Zeigen des Hitler-Grußes. Trotzdem galt er als unantastbar. Schützten ihn Beziehungen zu hochrangigen Repräsentanten des Regimes? War es die Furcht des Diktators vor dem Krebs, über dessen Ursachen Warburg Zeit seines Lebens forschte? Kröher stellt entsprechende Indizien zusammen, ohne eine endgültige Erklärung liefern zu können. Dem 1931 mit dem Nobelpreis geehrten Exzentriker, der diese Auszeichnung nach eigener Auffassung schon zehn Jahre früher verdient gehabt hätte, wurde jedenfalls alles gestattet. Und er nahm sich auch alles heraus. Täglich ritt er auf seinem Schimmel durch das Dahlemer Gelände, wo er eine nach seinen Vorstellungen im Stile eines Rokoko-Schlösschens errichtete Villa bewohnte, in der er sich mit weißen Pudeln umgab. Seine Arbeiten zur Zellatmung und zur Photosynthese sind bis heute bahnbrechend. Und für die sogenannte Warburg-Hypothese, nach der Tumorzellen ihre Existenz einer Störung in der Funktion der Mitochondrien verdanken, fanden sich in den letzten Jahren überzeugende Belege. In Warburgs Karriere stellten die Nationalsozialisten und der Krieg nur eine vorübergehende Unannehmlichkeit dar. Er leitete sein Institut auch nach dessen Eingliederung in die Max-Planck-Gesellschaft bis zu seinem Tod im Jahr 1970. Und wer sich durch einen Hitler nicht aufhalten lässt, den stoppt auch kein Eiserner Vorhang. Natürlich erhielt Warburg für sich, seinen Lebensgefährten, einen Chauffeur und seine Hunde ein Sondervisum, mit dem er jederzeit die innerdeutsche Grenze überqueren durfte, um in der DDR Urlaub zu machen. Schließlich stand sein geliebtes Vorkriegs-Feriendomizil auf Rügen, und wer wollte ihm verwehren, dorthin auch weiterhin zu reisen? Dem Mann, der uns die Zelle erklärt hat, dem schlug niemand etwas ab. Nicht die Behörden des Kaiserreiches, der Weimarer Republik und der Bundesrepublik, nicht die NSDAP und auch nicht die SED. Er benötigte zehntausend Mark. Er bekam sie ohne jede Diskussion.
Mit seinem Werk führt uns Michael Kröher zurück in eine legendäre Epoche der Wissenschaft, die durch den Nationalsozialismus ein jähes Ende fand. Aber er zeigt indirekt auch auf, wie eine Renaissance der Spitzenforschung in Deutschland gelingen könnte. Das Harnack-Haus steht ja noch, und wo sich einst die herausragenden Physiker, Chemiker und Biologen ihrer Zeit ganz zwanglos beim Abendessen begegneten, um sich anschließend mit einer guten Zigarre und hochgeistigen Getränken dem Philosophieren über die Grenzen ihres Faches hinweg hinzugeben, dort könnten durchaus ein paar neue Habers, Plancks, Einsteins, Meitners, Hahns und Heisenbergs heranreifen. Wenn wir es denn zulassen. Wenn wir denn die notwendigen Freiräume schaffen, wenn wir sie vor Bürokratie und Ideologie beschützen. Dazu braucht es „zehntausend Mark“? Dann gebt ihnen das Geld doch einfach! Und verpflichtet sie nur das zu tun, was sie ohnehin mehr als alles andere wollen: Forschen, forschen, forschen. Fragt nicht nach, errichtet keine Hürden, zieht keine Grenzen und wer da glaubt, ohne weiße Pudel ginge es nicht, der soll halt auch diese bekommen. So vermag, und das ist Kröhers indirekte Botschaft, der „Club der Nobelpreisträger“ wieder neu zu entstehen. Wer einen Warburg will, muss ihn eben auch wie einen Warburg behandeln.
Es gibt Bücher, die liest man bei aller Spannung nur abschnittsweise, weil man sich ständig fragt, ob es sich wirklich so zugetragen hat, weil man nach jedem Absatz den Rechner anwirft, um zu recherchieren, um zu überprüfen und um noch mehr zu erfahren. Michael Kröhers „Club der Nobelpreisträger“ gehört in diese Kategorie. Es ist ein spannender, unterhaltsamer und lehrreicher Schmöker, uneingeschränkt empfehlenswert für die langen Herbst- und Winterabende dieser Tage.