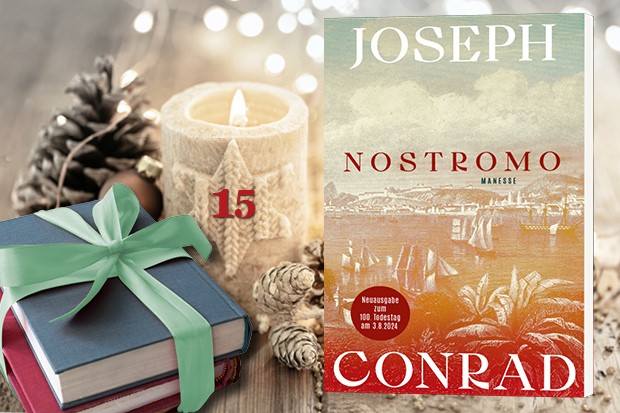Joseph Conrad werde ich für immer mit himmelblauen Augen in Erinnerung behalten. Es waren die schönsten Augen des Planeten, die nicht einmal ihm selbst gehörten. Denn Conrads legendärer „Lord Jim“ wurde für mich durch Peter O’Toole auf der Leinwand verkörpert. Das war im Eden-Kino in Aachen, mit Lord Jims unvergesslicher Erkenntnis, dass sich jeweils im Bruchteil einer Sekunde entscheide, ob man als Held oder Versager weiterlebe – in einem fast unmessbar winzigen Moment also, in dem man den Mund zu einem Aufschrei öffne, oder sich auf die Zunge beiße. Wo man ja oder nein sage. Ob mich der Film heute noch genauso berühren würde, wie als 17jährigen Gymnasiasten? Ich weiß es nicht.
Denn mit meiner Frau schaue ich mir in verschiedenen Mediatheken seit langem fast nur noch Filme an, in denen die Protagonisten Smartphones bedienen. Warum? Nicht der vielen Fotos wegen, die Kommissare inzwischen mit diesen Dingern in den meisten Krimis für ihre Ermittlungen machen, sondern als Indikator für das Alter der Filme überhaupt. Sind die Filme älter als die Einführung des iPhones durch Steve Jobs im Februar 2007, sind sie meistens auch viel langatmiger. Auch langweiliger, um es offen zu sagen, wenn wir uns dafür noch einmal kurz einen alten Derrick-Film anschauen wollen. Das hat neben den Drehbüchern vor allem mit der rasant veränderten Schnitttechnik zu tun, die durch die Werbe-Industrie revolutioniert worden ist und kaum noch eine Pause zulassen darf, in der Langeweile aufkommen könnte.
Ähnlich geht es mir mit Büchern. Ob ich „Hundert Jahre Einsamkeit“ von Gabriel Garcia Marquez aus Kolumbien deshalb heute noch einmal lesen könnte, mit dem ich in den 70er Jahren die Liebe zum Lesen neu erlernte nach allen Enttäuschungen der Pflicht-Lektüre am Gymnasium? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass dieser Jahrhundertroman ohne Joseph Conrad im Allgemeinen undenkbar ist und ohne dessen „Nostromo“ im Besonderen, der vor hundertzwanzig Jahren zuerst in Fortsetzungen in der Zeitschrift „T.P.‘s Weekly“ erschienen ist.
Die „Hundert Jahre Einsamkeit“ halten den magischen Realismus der Südamerikaner wie in einem Bernstein fest, wo den jungen Aureliano Buendia immer Wolken von Schmetterlingen umflattern, dessen Großmutter im Eingangskapitel noch klagt, Kolumbiens Niedergang habe begonnen, als die Menschen anfingen, ihre Beichtväter zu wechseln (anstatt sie einfach nur aufzugeben)!
Wir befinden uns in der fiktiven Republik Costaguana mit der westlichen Hafenstadt Sulaco. Die imaginären Orte des Schauplatzes gleichen Blaupausen einer Welt, wo Bürgerkriege Diktaturen folgen und umgekehrt. Am Golfo Placido besitzt Sulaco eine ertragreiche Silbermine mit unsicheren Besitzverhältnissen, die begehrliche Blicke von nah und fern auf sich zieht, als eine separatistische Revolution Sulaco vom Rest Costaguanas abtrennt. Das ist der blutige Hintergrund der großen Erzählung.
Der große Überblick ergibt sich aber auch darum erst allmählich, weil Conrads Erzählkunst zunächst und zuletzt die Menschen in den Blick nimmt. Das sind die entwurzelten Mestizen und Indios der Unterklasse, die ihre Haut in der Mine zu Markte tragen oder sich in die Armeen der Regierung oder der üblichen Putschisten pressen lassen. Oder es sind die Vertreter der „Blancos“, wie die weißen Nachfahren der spanischen Conquistadores genannt wurden, die hier seit dem 17. Jahrhundert die herrschende Elite bildeten. Die berührendsten Charaktere aber finden sich unter den Fremden und Entwurzelten, von denen Joseph Conrad sein ganzes Leben selbst einer war.
Ihr technisches Know-How prädestinierte diese versprengten Europäer gleichermaßen für den Ausbau der Kommunikationswege des Hafens, der Eisenbahn – und der Ausbeutung der Silbermine. Neben Briten stellen unter ihnen Italiener die Mehrheit. Da lernen wir auch den alten Giorgio Viola kennen. Er ist ein desillusionierter und resignierter Rebell der Alten Welt, der die Hauptfigur Nostromo wie einen Adoptivsohn in seine Familie aufnimmt, und wo das Hotel mit dem Namen „Albergo d’Italia Una“ den Leser wie nebenbei an die Sehnsüchte jenes Zeitalters erinnert, in dem sich allein in Europa noch dreißig verschiedene Souveräne und Potentaten die Herrschaft über die Apenninen-Halbinsel teilten, bevor Garibaldi aus diesem Flickenteppich einen einzigen modernen Nationalstaat formte.
Er selbst, sagt Conrad in einer „Vorbemerkung“ seines Ausnahmeromans, habe erstmals um das Jahr 1875 in der Karibik die Geschichte eines Mannes gehört, der angeblich allein einen ganzen Lastkahn (das heißt, einen Leichter) voll Silber gestohlen hatte, irgendwo an einer der Küsten des Kontinents, in den Wirren einer der vielen Revolutionen. Die Sache kam ihm auf den ersten Blick als ein starkes Stück und zweitens unglaublich vor. Weil er aber nicht mehr davon erfahren hatte, er dazu noch sehr jung war und an Verbrechen im Allgemeinen nicht wirklich interessiert war, sei ihm die Nachricht bald wieder aus dem Gedächtnis geglitten.
Siebenundzwanzig Jahre später hingegen habe ihn dieselbe Geschichte vollends elektrisiert, als er sie in einer zerfledderten Kladde wiederfand, die ihm auf dem Tisch eines Ladens mit gebrauchten Büchern unter die Finger geriet. Es musste die gleiche Geschichte sein, daran gab es keinen Zweifel, aus der Autobiographie eines amerikanischen Matrosen, die er mit Hilfe eines Journalisten geschrieben hatte, weil sie so aufregend war. „Dem Burschen war es tatsächlich gelungen,“ fährt Conrad da fort, „einen Leichter mit Silber zu stehlen, und zwar, wie es scheint, allein deshalb, weil er das vorbehaltlose Vertrauen seiner Arbeitgeber besaß, die eine außerordentlich schlechte Menschenkennntnis gehabt haben müssen. In der Geschichte des Matrosen wird er als Schurke durch und durch dargestellt, als kleiner Betrüger, dümmlich wüst, mürrisch, von schäbigem Äußeren und völlig unwürdig der Größe, die ihm diese Gelegenheit aufgedrängt hatte. Interessant war, dass er sich der Tat offen rühmte.“
Joseph Conrad hingegen ist bis heute für seine außerordentlich gute Menschenkenntnis berühmt. Zu seinem 100. Todestag und um den Ruhm dieses vor 120 erschienen Romans angemessen zu würdigen, hat der Manesse Verlag in einer verlegerischen Großtat „Nostromo“ in einer sorgfältig editieren und bibliophil ausgestatten Neuausgabe (bedruckter Ganzleinenband, Lesebändchen) herausgeben. Sie wurde von Gisbert Haefs und seinem Sohn Julian aus dem viktorianischen Englisch in das Deutsche unserer Tage neu übertragen, in einer Fassung, in der es von unretuschierten „Negern“, „Indios“ oder „Mulatten“ nur so wimmelt – zur hellen Freude „alter weißer Männer“.
Was mir am Ende in der großen Erzählung dennoch fehlt, sind die himmelblauen Augen Peter O’Tooles. Doch Nostromo ist nicht Lord Jim. Eher ist auch er ein „Mensch in seiner Auflösung“, wie Captain Charles Marlow, den Joseph Conrad schon im Jahr 1899 in seiner Novelle „Herz der Finsternis“ als tragische Hauptfigur charakterisiert hatte. Der Name Nostromo hingegen leitet sich ab von „nostro uomo“. Er ist, wie er ist, aber: er ist „unser Mann.“
Paul Badde, deutscher Sachbuchautor, Journalist und Filmemacher. Von 2000 bis 2013 arbeitete er als Korrespondent der Tageszeitung Die Welt, zuerst in Jerusalem, dann in Rom und beim Vatikan. Seit 2013 ist er auch Autor und Korrespondent des Fernsehsenders EWTN Deutschland.
Joseph Conrad, Nostromo. Roman. Neu übersetzt von Julian und Gisbert Haefs. Manesse Verlag, Sorgfältig gestaltete, gebundene Ausgabe, bedruckter Ganzleinenband, Lesebändchen, 560 Seiten, 38,00 €
Mit Ihrem Einkauf im TE-Shop unterstützen Sie den unabhängigen Journalismus von Tichys Einblick! Dafür unseren herzlichen Dank!!>>>