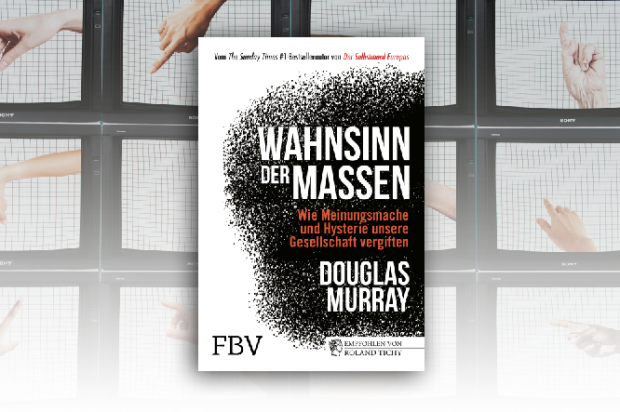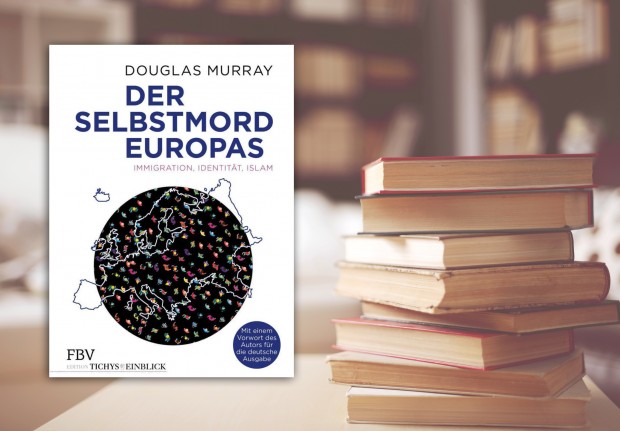London, ein kühler Oktoberabend. Ein paar Steinwürfe entfernt tagt das Unterhaus. Dramatische Stunden: Endlich bekommt Premierminister Boris Johnson seine langersehnten Neuwahlen. Doch die Leute, die zahlreich in die Central Hall Westminster strömen, lassen das politische Drama links liegen. Sie sind wegen tiefer schürfender Angelegenheiten gekommen. Das Wochenmagazin Spectator hat zu einem Gespräch geladen. Das Thema: das neueste Buch von Douglas Murray mit dem Titel «Madness of Crowds» – «Wahnsinn der Massen».
Die Central Hall ist der größte Veranstaltungsraum im Zentrum der britischen Hauptstadt. Hier trat 1946 die Uno-Generalversammlung erstmals nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zusammen. Am Abend mit Douglas Murray ist jeder der gut zweitausend Plätze belegt. Jung und Alt, Mann und Frau, Menschen aller Farben – ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Der Eintrittspreis von rund fünfzig Franken sei so bemessen, dass er Störenfriede abhalte, scherzt jemand zur Einleitung. Es ist nur halb im Spaß gemeint.
Der Protagonist des Abends gehört zu den wichtigsten Stimmen der englischsprachigen Welt. In mittelständischen Verhältnissen in London aufgewachsen, besuchte er das Elite-Internat Eton. Direkt nach dem Schulabschluss, noch vor dem Geschichtsstudium in Oxford, schrieb er eine vielgelobte Biografie von Lord Alfred Douglas. Später wurde er unter anderem als Journalist beim Spectator tätig.
Es ist das kennzeichnende Element von Murray als Autor, dass er seine Diagnosen nicht vom Schreibtisch in der Londoner City aus erstellt, sondern dass er in die Herzkammern dessen vorstößt, was er zu ergründen sucht. Für «Der Selbstmord Europas» bereiste er die Mittelmeerroute, die griechischen Inseln, die Problemquartiere der europäischen Metropolen.
Für sein kürzlich erschienenes neues Buch hat sich Murray die vorderste Linie eines erbitterten Kulturkampfs ausgesucht. «Wahnsinn der Massen» handelt davon, dass die Gesellschaft derzeit in Gruppen zerfällt, die sich selbst für unterdrückt erklären: Gruppen nach dem Geschlecht, der sexuellen Orientierung oder der Hautfarbe. Dabei wird die Zugehörigkeit zu einer dieser Opfergruppen zum wichtigsten und erstrebenswerten Persönlichkeitsmerkmal. Es entbrennt ein regelrechter Wettbewerb um den Opferstatus, inszeniert als Kampf selbsternannter Krieger für soziale Gerechtigkeit («Social Justice Warriors»).
Seine Analyse beginnt Douglas Murray mit der Homosexualität – einem Thema, bei dem er sich besonders gut auskennt, da er selbst schwul ist. Heute sei es gesellschaftlich kaum noch akzeptabel, einfach nur für die Gleichberechtigung einzustehen. Als ginge es darum, die Diskriminierung der Homosexualität in frühen Zeiten auszugleichen, werde sie heute als leicht höherwertig dargestellt. Firmen begehen ausgiebig die Schwulenparade Pride, und man lässt Homosexuellen ein sexuelles Verhalten in der Öffentlichkeit durchgehen, das sonst inakzeptabel wäre. So würden Demonstrationen für die Rechte sexueller Minderheiten oftmals mit obszönen Szenen garniert, so Murray, «die vielen Homo- und Heterosexuellen die Schamröte ins Gesicht treiben».
Sein Buch versteht Murray als Appell an die junge Generation, den Lebensweg nicht als selbsterklärte Angehörige einer Opfergruppe anzutreten. Dafür müsse man sich der kompletten politischen Vereinnahmung des Lebens verweigern und lernen, über Fehltritte anderer Menschen hinwegzuschauen.
Einige Stunden vor dem öffentlichen Großanlass trifft die Weltwoche Douglas Murray zum privaten Gespräch. Wie es sich für einen britischen Konservativen gehört, trinkt er Schwarztee mit kalter Milch. Der Mann wirkt gar nicht wie der Scharfmacher, als der er von seinen Gegnern dargestellt wird. Im Gegenteil, er entpuppt sich als das, was man in seiner Heimat soft-spoken nennt: leise im Auftritt, sorgfältig in der Argumentation, offen für Einwände.
Herr Murray, Ihr neues Buch trägt den Titel «Wahnsinn der Massen». Was meinen Sie damit?
Murray: Dieses übermäßige Gewicht, das wir heute auf Gruppenidentitäten legen. Der Wahnsinn ist darin angelegt, dass dieses Gesellschaftssystem nicht einmal nach seinen eigenen Maßstäben funktionieren kann. So wird von uns beispielsweise erwartet, dass wir an Dinge glauben, die sich gegenseitig ausschließen. Jede Gesellschaft in der Geschichte hat Sachen gemacht, die im Rückblick bizarr anmuten. Es ist aber schwierig, diese Tendenzen zu identifizieren, während man mittendrin ist. Das ist die Aufgabe, die ich mir selbst gestellt habe. Damit wir uns in Zukunft weniger schämen müssen.
Sie schreiben in Ihrem Buch über radikalisierte Minderheiten. Spielen diese Social Justice Warriors im Leben der meisten Leute überhaupt eine Rolle?
Murray: Spätestens beim Thema Frau – über das ich in meinem Buch auch schreibe – ist es kein Minderheitenthema mehr. Die Einzigen, die das heute noch für eine Randerscheinung halten, sind Selbständige. Wer hingegen irgendwo angestellt ist, beginnt zu realisieren, dass er als Nächster dran ist. Wenn wir das jetzt nicht stoppen, dann frisst es uns alle auf.
Sprechen wir über ein paar aktuelle Ereignisse aus dem Themenbereich Ihres Buches. Auch in Deutschland häufen sich Fälle, in denen rechte Politiker oder Professoren von linken Aktivisten am Reden gehindert werden.
Always, ein Hersteller von Damenbinden, tilgt das VenusSymbol von seinen Verpackungen. Dadurch soll eine angebliche Diskriminierung von Menschen männlichen Geschlechts beseitigt werden, die sich als Frau fühlen, aber keine Periode bekommen können.
Murray: Das ist die Politisierung von allem und jedem. Für Firmen ist das unglaublich schwierig. Sie versuchen zu zeigen, dass sie am Puls sind. Wenn der Takt ändert, müssen sie sich anpassen. Dabei übertreiben sie es. Viele Firmen meinen, dass sie als der böse Wolf betrachtet werden, als kapitalistisches Ungeheuer. Also suchen sie etwas, das ihnen Deckung gibt.
Weiteres Beispiel: der Gipfel für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Queer (LGBTQ) der amerikanischen Demokraten. Ein Neunjähriger meldet sich zu Wort und fragt die Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren, wie sie geschützte Räume für Transsexuelle wie ihn an den Schulen sicherstellen wolle …
Murray: Und wie jeder im Raum klatschte Elizabeth Warren Beifall. Auch die Mutter dieses neunjährigen Transgender hätte nicht glücklicher sein können und strahlte ihr Kind an. In meinen Augen ist das krankhaft. Das müsste man thematisieren. Im letzten Kapitel meines Buchs schreibe ich über Transgender und bin dabei so vorsichtig wie möglich. Es gibt da plausible Argumente für Erwachsene. Aber ein neunjähriges Kind weiß in diesen Belangen nicht, was es will. Auf jeden Fall kann es keine lebensprägenden Entscheidungen treffen. Die Idee, dass ein Neunjähriger eine sexuelle Identität hat, ist grotesk, aber in der amerikanischen Kultur heute allgegenwärtig. Und die amerikanische Kultur schwappt über auf die restliche Welt.
Die Studentenschaft an der Universität Oxford hat entschieden, das Klatschen als Zeichen des Beifalls durch stille Gesten abzulösen, damit akustisch empfindliche Personen nicht verletzt werden.
Murray: Das ist das verwandte Thema der Verletzlichkeit. Es fährt im Seitenwagen der Social Justice Warriors, ist eine damit verwobene Haltung. Aber wenn einem das Klatschen schon zu viel ist, hat man es vermutlich schwer auf der Welt. Es ist ein Problem, dass wir heute vor jeder Verletzlichkeit einknicken. Klar kann man das Leben erträglicher machen, aber man bringt doch nicht alles weg, was irgendjemanden stört. Indem man das versucht, verschärft man leicht die Verletzlichkeit. Das sieht man ja auch an der derzeitigen Epidemie psychischer Erkrankungen.
Viele Firmen haben heute den Eindruck, sie müssten sogenannte safe spaces einrichten, in denen ihre Mitarbeiter als Zugehörige einer Minderheit vor unerfreulichen Erfahrungen geschützt bleiben.
Murray: Die Personalabteilungen dehnen sich immer weiter aus. Sie betrachten es als ihren Auftrag, Diversity im Unternehmen durchzusetzen.
Besonders sichtbar wird die politische Agenda des Silicon Valley bei der Google-Bildsuche. Murray zitiert in seinem Buch mehrere Beispiele dafür. So wird bei der Suche nach «Physiker» zuerst das Bild eines weißen Physikprofessors gezeigt und unmittelbar danach das Bild einer schwarzen Physikdoktorandin aus Johannesburg. Dem Nutzer soll offenbar gezielt die Vorstellung ausgetrieben werden, dass die meisten erfolgreichen Physiker weiß Männer waren – gegen das Stereotyp Albert Einstein. Ein anderes Beispiel: Wer nach Bildern von schwulen Paaren sucht, bekommt solche geliefert. Wer hingegen nach Bildern von heterosexuellen Paaren sucht, dem werden prominent immer wieder Bilder von homosexuellen Paaren eingestreut.
Auch bei der Textsuche werde manipuliert, so Murray. Der Starautor zückt sein Handy. Auf Englisch tippt er den Anfang einer Google-Suche ein: «Männer sind». Als ersten Vorschlag für die vollständige Suche zeigt ihm Google an: «Männer sind wie ein Bus». Irgendwo erscheint «Männer sind Hexen». Bei Frauen hingegen heißt es sofort: «Frauen sind toll» oder «Frauen sind schön».
Mit seinem Buch bewegt sich Murray an der vordersten Front eines erbitterten Kulturkampfs. An Universitäten wird er niedergeschrien, auf Youtube kommen seine Wortmeldungen in die «Quarantäne» – weil sie nach Auffassung von Google «Hass» verbreiten. Damit sind Beiträge gemeint, die dazu angetan seien, einzelne Gruppen aufgrund von «Eigenschaften wie Alter, Geschlecht, Rasse, Kaste, Religion, sexuelle Orientierung oder Veteranenstatus» zu «diskriminieren, zu segregieren oder auszuschließen». Sie werden zur Strafe für Werbung gesperrt und kommerziell ausgetrocknet.
Wie sind Sie überhaupt auf das Verhalten von «Big Tech» aufmerksam geworden?
Murray: Ich habe ehemalige Mitarbeiter von Tech-Firmen getroffen, die mir gezeigt haben, was sie da gemacht hatten. Sie haben sich darüber große Sorgen gemacht. Das musste jetzt mal jemand aufzeigen. Es ist sehr besorgniserregend, weil die Leute keine Ahnung haben, was da abgeht.
Welchen Schaden richtet das an?
Murray: Im Kern geht es darum, die Vergangenheit umzuschreiben. Das ist ein echtes Problem. Wenn Sie die Geschichte verfälscht präsentiert bekommen, dann ziehen Sie auch für die Gegenwart die falschen Schlüsse. Die Firmen haben zahlreiche Möglichkeiten, um ihre Ideologie zu transportieren. Von weich bis hart. Das Beispiel, das ich Ihnen gezeigt habe: Frauen seien wundervoll, und Männer, nun ja, so ein bisschen Schrott. Das ist so ein Überkompensieren von Leuten, die der Meinung sind, dass wir in einem furchtbaren patriarchalen Albtraum leben. Ich denke nicht, dass das jungen Männern und Frauen hilft, miteinander eine gehaltvolle Beziehung aufzubauen. Es ist schwer genug für junge Menschen, mit sich selber und dem anderen Geschlecht zurechtzukommen. Auch ohne diesen Schleier aus Lügen, der vor ihnen aufgebaut wird.
Youtube trocknet gewisse Inhalte kommerziell aus, indem sie für Werbung gesperrt werden. Man nennt es «Demonetarisierung».
Manche konservative OnlineStars haben sich zum sogenannten Intellectual Dark Web zusammengetan.
Murray: Eric Weinstein, der den Ausdruck erfunden hat, pflegt zu scherzen, ich sei die einzige Person im Intellectual Dark Web. Selbst sehe ich mich nicht so. Ich schreibe seit zwanzig Jahren, auch für wichtige Magazine, und ich fühle mich nicht als Randfigur. Offenbar vertrete ich manchmal Meinungen, die bei einer bestimmten Art von totalitären Möchtegernzensoren sehr unpopulär sind. Ihre einfachste Art, damit umzugehen, scheint – um in der Sprache der sozialen Medien zu bleiben – das Stummschalten zu sein. Da hat das eine zum anderen geführt. Die Idee war ja nie, dass Mark Zuckerberg plötzlich die Rolle des Weltzensors ausfüllen muss.
Was kann man gegen diese Form der Zensur im Internet unternehmen?
Murray: Manche Leute arbeiten an Plattformen, die das vermeiden wollen. Das braucht es bestimmt. Es gibt ein neues Projekt, das bald online geht, aber ich kann darüber noch nicht sprechen. In die bestehenden Plattformen ist viel Doppelmoral hineinprogrammiert. Sie bevorzugen Exoten, die ihrer Meinung sind, und versuchen, konventionelle Personen stummzuschalten, die andere Ansichten haben. Sie probieren definitiv, die Debatte zu verzerren.
Wie werden sich die Internetkonzerne bei der bevorstehenden Präsidentschaftswahl in den USA verhalten?
Murray: Wer auch immer gegen Trump antritt: Sie werden versuchen, diesem Gegenkandidaten – und sei es Satan – zur Wahl zu verhelfen. Sie sind der absurden Vorstellung verfallen, dass die Wahlen 2016 und das Brexit-Referendum in Großbritannien mit ein paar Facebook-Anzeigen von den Russen gesteuert wurden. Dadurch haben sie sich die Gelegenheit verbaut, herauszufinden, warum sie verloren haben, und ihren Kurs zu korrigieren.
Dieser Beitrag von Florian Schwab erschien zuerst in DIE WELTWOCHE Ausgabe 47/2019.
Empfohlen von Tichys Einblick. Erhältlich im Tichys Einblick Shop >>>