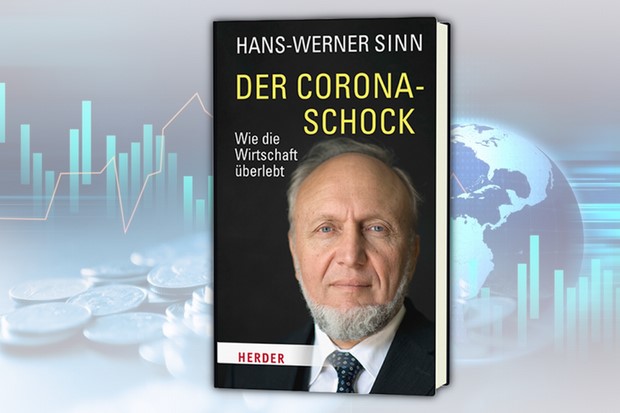Die Linderung, die die Verschuldung und das Geld aus der Druckerpresse bedeuten, behindert die Selbstheilung der Wirtschaft und verfestigt die Probleme. Zwar kann man mit dem Kredit, egal ob er aus dem Ausland oder aus der Notenpresse der nationalen Notenbank stammt, Nachfrage erzeugen, sei es über das Staatsbudget oder über die wieder belebte Bauindustrie. Diese Nachfrage schafft Jobs in den Binnensektoren, die nicht im internationalen Wettbewerb stehen. Der Pensionär geht ins Restaurant, der Restaurantbesitzer zum Frisör, der Frisör ins Fitnessstudio und so weiter. Dadurch werden wieder Lohnerhöhungen in diesen Bereichen möglich, oder es können die eigentlich erforderlichen Lohnanpassungen nach unten unterbleiben. Doch müssen die im internationalen Wettbewerb stehenden Sektoren diese Löhne auch zahlen, ohne dass sie zugleich auf eine Erhöhung der Nachfrage nach ihren Produkten rechnen können oder deswegen Produktivitätszuwächse haben, die es möglich machen würden, mit den hohen Löhnen zurechtzukommen. Sie verlieren deshalb ihre Wettbewerbsfähigkeit, und dadurch wird die gesamte Volkswirtschaft immer stärker abhängig von ausländischen Finanzhilfen.
Natürlich kann man wieder die schönen Geschichten erzählen, die schon vor zehn Jahren bei der Griechenlandkrise vorgebracht wurden, dass man mit dem Wiederaufbaufonds die Infrastruktur und damit die Wachstumschancen der Industrie angebotsseitig verbessern kann. Das Argument könnte also, überspitzt gesagt, sein, dass man die deutschen Autos nimmt, um mit ihnen italienische Arbeiter dafür zu bezahlen, dass sie italienische Autobahnen herstellen, die anschließend die Transportkosten für die italienische Industrie senken. Doch eine Lösung über konditionierte Mittel des Rettungsfonds ESM, die speziell für solche Zwecke hätten reserviert werden können, hat die italienische Regierung ja mit Händen und Füßen erfolgreich bekämpft. Nach aller Erfahrung wird man davon ausgehen müssen, dass statt der Autobahnen doch wohl mehr Restaurant-Essen und andere Dienstleistungen erzeugt werden, die die Standortbedingungen eher nicht verbessern. Und selbst wenn man die deutschen Autos nehmen würde, um die Arbeiter für den Aufbau einer lokalen Infrastruktur zu kompensieren, so wäre Fiat darüber immer noch nicht glücklich gewesen, denn Autos hätten sie ja auch gerne selbst hergestellt.
Was sich an diesem Gedankenexperiment zeigt, ist ein fundamentales Problem der Entwicklungspolitik. Dort erkannte man schon vor Jahrzehnten, dass Geldmittel an Entwicklungsländer, die zwangsläufig einen Warenfluss nach sich ziehen, für die dortige Industrie kontraproduktiv sind. Der Warenfluss in ein bedrängtes Land hilft dem Lebensstandard in diesem Land, hilft Versorgungskrisen zu überwinden, schädigt aber die dortigen Industrien. An diesem Konflikt kommt man nicht vorbei. Insofern kann man bestimmt nicht davon reden, dass der neue Geldtopf der EU ein Wiederaufbaufonds ist. Das ist ein von Politprofis geschickt gewählter Begriff, um die Mittel zur Ruhigstellung der lokalen Bevölkerung der wirtschaftlich angeschlagenen Länder des Mittelmeerraumes in den öffentlichen Medien plausibel zu machen, doch verschleiert er das, was durch diesen Fonds tatsächlich ausgelöst wird. Ein Etikettenschwindel, sonst nichts.
Die Volkswirte bezeichnen die negativen Auswirkungen auf die Industrie als „Holländische Krankheit“. Als die Niederlande in den 1960er Jahren Gas gefunden hatten und in die Welt verkauften, erzielten sie ordentliche Einnahmen. Davon hat der Staat profitiert, die Löhne konnten erhöht werden, alles, was an der Gaswirtschaft hing, prosperierte. Aber die steigenden Löhne setzten der heimischen Industrie zu, der es immer schwerer fiel, international wettbewerbsfähig zu bleiben. Erst als die Gaspreise in den 1980er Jahren fielen, die Bestände zur Neige gingen und die Tarifpartner mit dem sogenannten Wassenaar-Abkommen eine Kehrtwende bei der Lohnentwicklung einleiteten, löste sich das Problem allmählich wieder, und die Industrie kam wieder hoch.
Eine andere Bezeichnung für die Holländische Krankheit ist der „Ressourcenfluch“ (resource curse). Länder, die über hohe Einnahmen aus dem Verkauf von natürlichen Ressourcen verfügen wie zum Beispiel Norwegen oder Venezuela, haben, gemessen an der lokalen Standortqualität und der Produktivität der Arbeitskräfte, zu hohe Löhne, als dass eine wettbewerbliche Industrie sich etablieren oder halten kann. Das ist so lange kein Problem, wie die Ressourcen verfügbar und die Preise hoch sind, denn man kann sich ja die Güter, die man braucht, in der Welt zusammenkaufen, anstatt sie selbst zu produzieren. Aber wenn die Ressourcenpreise fallen, wird die einseitige Abhängigkeit ein Problem, wie die wirtschaftliche Katastrophe und die sozialen Aufstände Venezuelas in den letzten Jahren in aller Deutlichkeit gezeigt haben. Norwegen hat seine Erlöse aus dem Ölverkauf verwendet, um ein Vermögensportfolio im Ausland aufzubauen, den berühmten Sovereign Wealth Fund. Damit kommt es vorläufig über die Runden. Aber auch in Norwegen sucht man eine leistungsfähige Industrie vergebens. Bis auf die Werften ist da nicht viel zu finden.
Was in den Niederlanden der Gasverkauf und für Norwegen und Venezuela der Ölverkauf war, der zu einem Mittelzufluss aus dem Ausland führte, ist in den mediterranen Ländern Europas nun der Geldtransfer aus dem Norden, der in den letzten 30 Jahren in Form billiger privater Kredite unter dem Schutz des Euro, durch Rettungsaktionen der Staatengemeinschaft und der EZB sowie durch echte Transfers organisiert wird, wie sie nun Macron erfolgreich gegenüber Deutschland in Form des großen Wiederaufbaufonds durchgesetzt hat. Die Wirkungen sind immer dieselben. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Geldmittel als Kredit oder als Geschenke kommen. In beiden Fällen fließen Geldmittel in das bedrängte Land, und mit diesen Geldmitteln lässt sich ein Lohnniveau stützen, das sonst keine wirtschaftliche Basis mehr hat, und es lassen sich Importe ins Land holen. Man kann durch solche Mittel in einer akuten Krise natürlich den Untergang von Industrien verzögern, aber sobald das eine Dauereinrichtung wird, zementiert man ein Lohnniveau, bei dem die Exportwirtschaft ihre Wettbewerbsfähigkeit verliert. Der Patient wird drogenabhängig und kommt vom Tropf nicht mehr los.
Das Problem der fehlenden Wettbewerbsfähigkeit der südeuropäischen Industrien ist nicht, dass die Produktivität dort nicht so hoch wie anderswo ist. Dass einige Länder nicht so produktiv sind wie andere, das ist immer so auf der Welt, und trotzdem kann der Wettbewerb funktionieren. Das unproduktivste Land der Welt kann wettbewerbsfähig sein, wenn es sich mit Lohnstrukturen begnügt, die der niedrigen Produktivität entsprechen, aber es verliert seine Wettbewerbsfähigkeit, wenn man sagt, dort muss der Lebensstandard derselbe sein wie bei den produktiveren Handelspartnern, dann bricht alles zusammen. Wir haben ja gerade mit Süditalien, dem Mezzogiorno, ein Musterbeispiel für die verheerenden Wirkungen dauerhafter Geldtransfers auf die wirtschaftliche Prosperität einer Region. Die dortigen Löhne werden von den Gewerkschaften des produktiven Nordens bestimmt, und die verheerenden Konsequenzen der resultierenden Löhne werden durch die Transfers des italienischen Staates abgefedert. So lässt es sich im Süden zwar leben, doch lebt man mit fremdem Geld, das aus den Regionen Norditaliens stammt und letztlich auch sie herunterzieht und im Übrigen im Süden die Mafia ernährt, weil staatliche Pfründe stets Begehrlichkeiten bei Personengruppen schaffen, die ihre Kraft nicht mehr in den Verkauf eigener Leistungen legen, sondern sich lieber in den Kampf um staatliche Mittel begeben.
Ich habe angesichts dieser Probleme zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits bin ich sehr für solidarische Maßnahmen. In einer Krise wie dieser gilt es, den besonders betroffenen Ländern Italien und auch Spanien großzügig zu helfen. Das sollte aber ein jedes Individuum in eigener, freier Entscheidung tun, und meinetwegen noch der Staat, zu dem es gehört. Andererseits habe ich große Angst vor der Einrichtung kollektiver Leistungsmechanismen, die das Individuum oder den einzelnen Staat einer Mehrheitsentscheidung unterwerfen und die zu Dauereinrichtungen werden, an die sich die Empfänger gewöhnen und anpassen. Ich finde es nicht nur moralisch verwerflich, das Geld anderer Leute spenden zu wollen. Ich finde den neuen Weg der EU darüber hinaus gefährlich. Die Welt, in die wir unsere Kinder entlassen, ist schwierig genug. Den Wettbewerb mit den Völkern Asiens und auch den immer aggressiver agierenden USA zu bestehen, wird nicht leicht sein. Angesichts dessen können wir es uns gar nicht leisten, Europa dauerhaft durch eine Transferunion à la Macron mit der Holländischen Krankheit zu infizieren und zuzulassen, dass der gesamte Mittelmeerraum in Lethargie verharrt und zu einem großen Mezzogiorno mutiert, der vom Tropf des Nordens nicht mehr loskommt.
Auszug aus: Hans-Werner Sinn, Der Corona-Schock. Wie die Wirtschaft überlebt. Herder, 224 Seiten, 18,00 €.