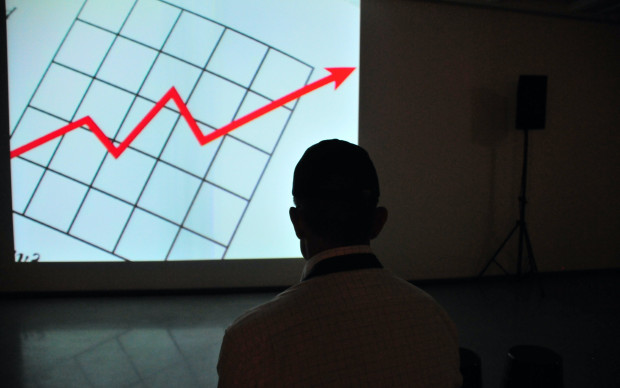Nach und nach werden die Kosten der Corona-Pandemie deutlich. Am vergangenen Donnerstag nun kam die Katastrophenmeldung des Statistischen Bundesamts: Das Bruttoinlandsprodukt ist im Vergleich zum ersten Quartal dieses Jahres um 10,1 Prozent zurückgegangen. Das bedeutet: Alle Bürger, Firmen und andere, die nicht von Steuergeld leben, haben ein Zehntel weniger konsumiert, ein Zehntel weniger erarbeitet, ein Zehntel weniger verdient.
Ähnlich sieht es in den USA aus: Von dort wird ein Rückgang von über 30 Prozent gemeldet, dieser ist aber auf das ganze Jahr hochgerechnet. Auf quartalsweise Veränderungen des BIP bezogen, ist das BIP der USA um „nur“ zehn Prozent gefallen. In Großbritannien liegt das BIP 20 Prozent unter dem Vor-Pandemie-Niveau. Auf der Insel sind nicht nur gemeine Bürger betroffen: Im Haushalt des Royal Collection Trust, der königlichen Kunstsammlung, fehlen durch das Ausbleiben von Touristen gut 20 Millionen Euro. Diese sollen durch den Verkauf eines Royalen Gin ausgeglichen werden. Sicherlich, die erzwungenen Produktionsstopps während der Shutdowns in vielen Ländern haben die Wirtschaftsleistung künstlich reduziert: Fabriken, die stillstehen, produzieren nichts, daher sinkt das BIP. Aber die Vorstellung, dass die Wirtschaft einfach so wieder auf Vorkrisenniveau anspringt, ist utopisch. Es wird Jahre, nicht Monate, dauern, den verlorenen Wohlstand wieder einzuspielen.
Doch von dieser Realität bekommt man an den Börsen wenig mit. Noch im Februar stand der DAX bei circa 13.500 Punkten, stürzte dann auf 8.400 Punkte ab, erholte sich seitdem und beendete den Montag bei deutlich über 12.600 Punkten.
Die NASDAQ-Indizes verloren zeitweise mehrere tausend Punkte auf um die 7.300. Mittlerweile stehen aber sowohl NASDAQ Composite als auch NASAQ-100 bei gut 11.000 Punkten. Doch der NASDAQ Composite enthält hauptsächlich Technologieunternehmen, während NASDAQ-100 nur die 100 größten Technologieunternehmen listet: Und diese sind oft die Gewinner dieser Krise.
Doch gerade beim DAX wird deutlich, dass etwas im Ungleichgewicht liegt. Denn im Februar befand sich der DAX auf einem Rekordwert – ein Rekordwert, der erreicht wurde, obwohl sich schon seit 2018 die Anzeichen einer heraufziehenden Rezession mehren. Die Preise von Aktien sollten sich eigentlich an den Umsätzen und Gewinnen der Unternehmen orientieren, deren Eigentumsurkunden sie sind. Also steigen in Wachstumsphasen und sinken, wenn die Leistung stagniert oder nachlässt – jedenfalls ist das die Erwartung. Dass aber die Aktienwerte trotz Kurzatmigkeit der Industrie, trotz Pandemie, trotz weltweiter unsicherer Wirtschaftssituation steigen, ist auf den ersten Blick kontra-intuitiv.
Seit Ende 2010 konnte der DAX sich von gut 7.000 auf zwischenzeitlich 13.500 Punkte hocharbeiten – beinahe eine Verdopplung! Haben sich Produktivität und Gewinn der DAX-Unternehmen in den letzten zehn Jahren verdoppelt? Nein, natürlich nicht.
Ähnlich wie mit Aktien verhält es sich auch mit anderen Vermögenswerten. Die Immobilienpreise steigen ins Unermessliche und das seit Jahren; der Goldpreis nähert sich dem Rekordpreis von 2.000 Dollar, der Preis für Silber ist so hoch wie seit sieben Jahren nicht. Gold gilt aber als eine Krisenwährung: Geht es der Wirtschaft gut, ist der Goldpreis erfahrungsgemäß eher niedrig, geht es ihr schlecht – oder sind die Erwartungen trotz guter Wirtschaft pessimistisch – steigt der Goldpreis.
Silber hingegen ist Krisenwährung und Industriemetall, seine Preisentwicklung ist deswegen oft schwieriger einzuschätzen. Aber wenn es massive Preissprünge hinlegt, muss entweder das Wachstum stark oder die befürchtete Krise sehr groß sein.
Der Grund, warum die Märkte sich so zweideutig verhalten, ist die Geldpolitik der Zentralbanken weltweit und in Europa. Die EZB pumpt schon seit Jahren immer neues Geld in die Wirtschaft. Das offizielle Ziel ist es, eine Inflationsrate von zwei Prozent zu erreichen, das inoffizielle Ziel der niedrigen Zinssätze ist aber, den hoch verschuldeten Staaten die Refinanzierung ihrer Schulden zu erleichtern. Waren zum Beispiel in der Eurozone 2010 noch 9.294 Milliarden Euro im Umlauf, waren es im März dieses Jahres 13.790 Milliarden Euro – innerhalb von zehn Jahren wuchs die Geldmenge also um 48 Prozent an, während das reale Bruttoinlandsprodukt (um Preissteigerungen bereinigt) in dieser Zeit kaum mehr als 14 Prozent wuchs – wobei dabei der BIP-Rückgang dieses Jahres noch nicht mit eingerechnet ist.
Aber obwohl eine immer größer werdende Geldmenge auf eine in den letzten Jahren in der Eurozone nur wenig gewachsene und jüngst sogar schrumpfende Wirtschaft trifft, bleibt die Inflation niedrig: Im Juni gab es, für einige Güter, gar eine leichte Deflation. Auch das ist eigentlich kontra-intuitiv. Mehr Geld und weniger Waren – das müsste nach historischer Erfahrung eigentlich mit einer Inflation, also stark steigenden Preisen einhergehen. Tut es derzeit aber nicht.
Konsumgüter sind in den letzten Jahren kaum teurer geworden. Und nur sie werden zur Bemessung der offiziellen Inflation herangezogen, die definiert ist als die Teuerungsrate eines Warenkorbs von Produkten, die ein „durchschnittlicher“ Haushalt im Monat kauft. Dass diese Teuerung relativ gering, jedenfalls weitgehend unter zwei Prozent, bleibt, liegt sicher zu einem Teil auch daran, dass durch die Globalisierung der Preisdruck auf Konsumgüter so hoch geworden ist, dass sie trotz Geldentwertung nicht teurer werden können – sonst würden günstigere Produkte aus China, Bangladesch oder anderswo importiert.
Dass in den vergangenen Monaten die Teuerungsrate in Deutschland sehr gering war, liegt das vor allem an drei Faktoren:
- die Ölpreise sind so niedrig wie schon lange nicht mehr; und Ölpreise sind oft ein treibender Faktor für Inflationsraten. Treibstoff kostete laut statistischem Bundesamt im Juni 15,1 Prozent weniger als im Juni 2019. Leichtes Heizöl ist sogar 26,5 Prozent günstiger. Aber das sind nur kurzfristige Effekte: Sobald die OPEC-Staaten ihre Produktionskapazitäten nach unten korrigieren, werden die Preise wieder ansteigen.
- Zum anderen haben sich durch die Lockdowns des März und April in den Kaufhäusern Warenstaus gebildet, die nun mithilfe von Sonderverkäufen abgebaut werden müssen – das ist zum Beispiel besonders im kurzlebigen Modegeschäft zu beobachten. Bekleidung und Schuhe kosten 0,5 Prozent weniger als im Vorjahr.
- Und schließlich ist die Mehrwertsteuersenkung eine effektive Preissenkung, also Deflation, aus Sicht der Kunden.
Aber die Preise für Obst, Gemüse und andere Nahrungsmittel und Alltagswaren sind gleichzeitig massiv gestiegen. Frisches Obst kostete im Juni 11,1 Prozent mehr als 2019. Bei Fleisch betrug die Teuerungsrate 8,2 Prozent, insgesamt sind Nahrungsmittel um 4,4 Prozent teurer geworden. Die Mieten sind um 1,4 Prozent gestiegen – sie reagieren mit Verzögerung auf die immer weiter steigenden Immobilienpreise.
Und nicht zuletzt: Die Vermögenswerte, die in der offiziellen Inflationsrate nicht mit berücksichtigt werden, erleben eine massive Inflation, weil das billige Geld, das in die Volkswirtschaften gepumpt wird, gespart, also in Aktien, Gold oder Immobilien angelegt wird.
Wie lange geht das gut? Vermutlich, bis das Vertrauen der Menschen in die Scheinnormalität endgültig schwindet; bis auch das viele Geld der Zentralbanken die Arbeitslosigkeit, Produktionsrückgänge und somit Wohlstandvernichtung der Pandemie nicht mehr kaschieren kann. Dann müssen die Menschen ihre Wohlstandsreserven abbauen, um liquide zu bleiben: Die Kurse sinken. Aber bis die Krise endgültig über Deutschland und die Welt hineinbricht, werden die Kurse weiter steigen, dann dürften sie eine Zeitlang stagnieren, doch dann kommt der Absturz, und zwar schnell. Gute Zeiten für Hoch-Risiko-Investoren, schlechte Zeiten für die, die ihre Ersparnisse behalten wollen.