In letzter Zeit hat man mehr über den homo politicus Jörg Bernig als über den Schriftsteller, den Erzähler, Lyriker und Essayisten gehört, der er eigentlich ist. Glücklich kann man die Zeiten nicht nennen, in denen sich das Politische vor das Ästhetische schiebt.

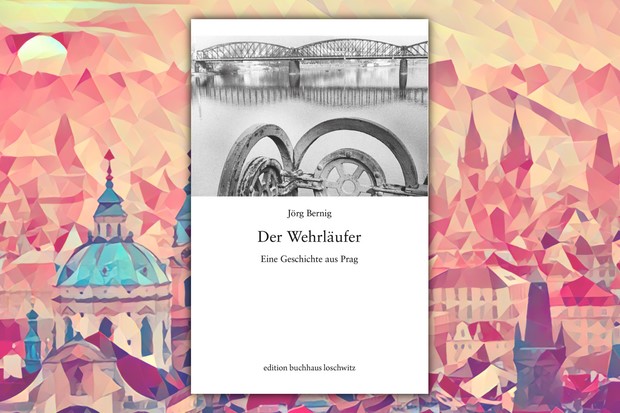
Viele Gründe und viele Arten existieren, vor dem Leben zu fliehen, sich der Verantwortung zu entziehen, die Schuld, wenn auch schuldlos schuldig, zu verdrängen. Eine davon erzählt uns Jörg Bernig in der Geschichte eines Schriftstellers, der nach Prag geht, wohl auch flieht, was er sich selbst gegenüber nicht einzugestehen vermag. Er kann nicht ahnen, dass er in Prag sich selbst begegnet, er den Weg zur Sühne findet, die allein ihn aus der Schuld, die er auf sich geladen hat, zu befreien vermag. Seine schriftstellerische Existenz beruht im Grunde auf dieser Schuld, auf der Flucht vor ihr, wird zum Vorgang der Verdrängung, zur Flucht in Geschichten, in Romane und Erzählungen, um seiner wahren Geschichte zu entkommen, um im Fremden das Eigene als Fremdes darzustellen. Wie soll aber der, der vor sich selbst davonläuft, der sich in die Literatur vor dem wirklichen Leben rettet, echte Beziehungen aufbauen, sich anderen Menschen gegenüber vollkommen und ganz öffnen, sich dem anderen ganz zuwenden, wenn er in seine Texte, in sein Schreiben verschwindet? Der Preis für die Verdrängung der Schuld ist die existentielle Einsamkeit.
Roman für Roman geht das zwar für den Schriftsteller, nicht aber für den Menschen gut. Doch wie jede Flucht ein Ende hat, so kann man der Wirklichkeit nicht ewig ein Schnippchen schlagen, denn der Roman über einen Maler, an dem er arbeitet, will sich nicht fügen, verweigert sich dem Erzählt-werden, weil es ihm weniger um den Maler, als eher um ihn selbst geht. Doch was haben die Probleme beim Verfassen des Romans mit seinen drei Freunden zu tun, die bereits Tod sind, einer als Kind, einer als Jugendlicher, einer als Mitvierziger ums Leben gekommen? Mit den vier Musketieren, als die sie sich sahen? Und weshalb erinnert er sich an die toten Freunde erst im Anblick der Moldau, in der Beobachtung des Wehrläufers, nachdem er über Jahre die Erinnerung an sie tief im Gehirn verkapselt, sogar das Etikett auf der Kapsel mit jeder neuen Geschichte überschrieben hat, um wie bei einem Palimpsest die ursprüngliche Geschichte wieder und wieder zu überschreiben?
Man sagt indes nur allzu wenig über Bernigs Erzählung, wenn man die Handlung nacherzählt, denn die Geschichte lebt von den Anspielungen, den Farben, den Nuancen, vom Geflecht, das Bernig souverän ausbreitet. Folgt man den Schriftsteller auf seinen Wegen durch Prag, wird man an Stephen Dedalus Weg durch Dublin erinnert – und Pola, der Ort, an den sich der Maler zurückzieht, ist der Ort, an dem das selbstgewählte Exil des James Joyce begann, des Autors des „Ulysses“, wenn man so will Joyce Odyssee zum „Ulysses“.
Beziehungsreicher nun als Pola ist Prag, eine der Hauptstädte der deutschen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, und nicht nur der deutschen. Wer denkt nicht an Franz Kafka, an Gustav Meyrink, an Rainer Maria Rilke, an Jan Neruda, an Bohumil Hrabal?
Es ist durchaus kein Zufall, dass der Schriftsteller nach Prag geht und die Moldaustadt zu Fuß erkundet, sich immer wieder Hinweise auf Bohumil Hrabals „Bafler“, auf Rilke und Thomas Manns Novelle „Tod in Venedig“ finden. Doch während in der Geschichte des Gustav von Aschenbach der Niedergang, die Dekadenz, der Zerfall erzählt wird, erzählt uns Jörg Bernig die Geschichte einer Heilung. So gesehen hat Bernigs Schriftsteller mehr mit Hesses Harry Haller im „Steppenwolf“ als mit Thomas Manns Gustav von Aschenbach im „Tod in Venedig“ gemein.
Da der „Ulysses“ des James Joyce bereits erwähnt wurde, in dem es auch um die Schuld geht, die Stephen Dedalus wie der Schriftsteller in Jörg Bernigs Erzählung mit sich herumträgt, rückt der zentrale Begriff der griechischen Tragödie in den Blick, der Katharsis, und die beginnt mit einem zufälligen Erlebnis des Schriftstellers, der es liebt am Fenster zu stehen und auf die Welt hinaus zu blicken, in sicherer Entfernung von der Wirklichkeit, in einem Zimmer, hinter einer Scheibe, immer eine Erzählung oder einen Roman weit weg von der Welt. Er beobachtet einen Wehrläufer, einen Mann, der von einem Boot auf ein Wehr der Moldau abgesetzt wird und es von Ablagerungen und Überwucherungen befreit, die dann von der Strömung des Flusses weggetragen werden. Dieser Wehrläufer ist nichts anderes als das Gewissen und der Fluss der Strom des Lebens. Wie der Wehrläufer muss auch das Gewissen des Schriftstellers sich regen und die eigene Existenz von Ablagerungen und Überwucherungen, die sich im Laufe der Zeit angelagert haben, befreien. Nicht länger dürfen sie den Fluss des Lebens hindern oder gar umlenken. Er muss die Scheibe zwischen sich und dem Leben durchbrechen, aus seinem Glashaus ausbrechen und durch den Verlust der Sicherheit, die Distanz schafft, Lebendigkeit gewinnen.
Auch wenn im Mittelpunkt der Erzählung ein Schriftsteller und ein Maler stehen, erzählt Jörg Bernig keine Künstlergeschichte, denn es geht nicht um ästhetische, sondern um existentielle Konflikte, nicht um eine Schaffens-, sondern um eine Lebenskrise, es handelt sich um die Frage, wie geht man mit den Handlungen in seinem Leben um, auf die man gelinde gesagt nicht stolz ist, wie schafft man es, sich von den Ablagerungen und Überwucherungen seiner Biographie zu befreien, damit das Leben im Fluss bleibt – auch wenn Sühne dazu gehört, was vielleicht das schwerste ist. Der Leser wird selbst herausfinden müssen, was es mit der Freundschaft der vier Jungen und auf sich hat. Aber er wird für diese Mühe reichlich belohnt. Man wird nachdenklicher, wenn man Bernig liest. Und das ist nicht wenig.
Jörg Bernig, Der Wehrläufer. Eine Geschichte aus Prag. Edition Buchhaus Loschwitz, Hardcover mit Schutzumschlag und Lesebändchen, 192 Seiten, 24,00 €
Empfohlen von Tichys Einblick. Erhältlich im Tichys Einblick Shop >>>


























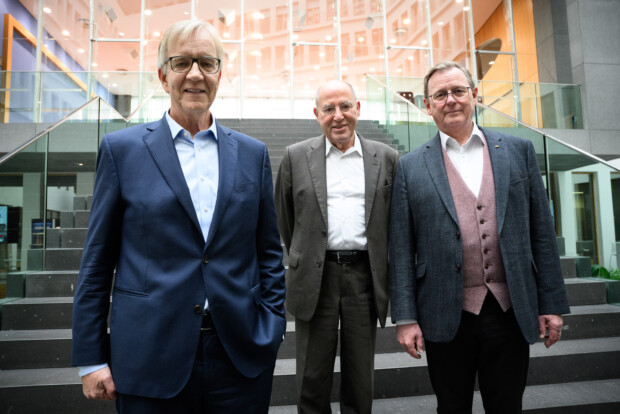





Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
»Mach dir klar, dass es keinen großen Unterschied macht, ob du in hundert Jahren stirbst oder morgen. Das Leben ist weder unerträglich noch ewig.« Marc Aurel, Kaiser (121 – 180)