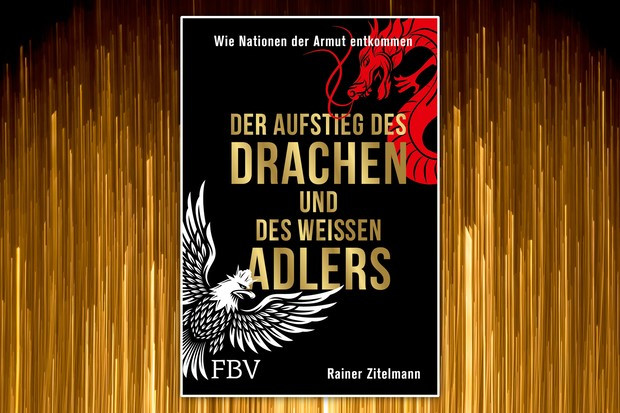Die Aufgabe des achtjährigen Phung Xuan Vu und seines zehnjährigen Bruders war es, für ihre Familie, die ständig unter Hunger litt, Essen zu besorgen. Das war – bevor die marktwirtschaftlichen Doi-Moi-Reformen [Doi-Moi: vietnamesisch für „Erneuerung“ – Anm. d. Red.] in Vietnam zu wirken begannen – nur mit Essensmarken möglich. Der wichtigste Gegenstand hierbei war ein Heft mit Coupons für Lebensmittel. Als der Ältere trug Vus Bruder das Heft bei sich, und er wusste, dass die Familie nichts zu essen haben würde, wenn er es verlieren würde. Die Gutscheine im Inneren waren auf wachsartigem gelbem Seidenpapier gedruckt. Sie bedeuteten den Unterschied zwischen hungern und etwas zu essen haben, obwohl es nie genug war.
Die Gutscheine musste man bei Einrichtungen für die Lebensmittelausgabe einlösen. Oft musste man viele Stunden warten, manchmal den ganzen Tag, um ein wenig zu essen zu bekommen, und wer eine ganz sichere Chance haben wollte, kam schon in der Nacht: »Die Kinder standen gemeinsam mit Nachbarn stundenlang in der Warteschlange. Einige Leute trafen schon um 2 Uhr, 4 Uhr oder 5 Uhr morgens ein, wenn es noch dunkel war. Andere stellten einen Korb oder einen Ziegelstein ab, um ihren Platz in der Schlange zu halten, und gingen dann wieder weg, um andere Dinge zu erledigen. Sobald die Sonne aufgegangen war, nutzten die Schulkinder die Wartezeit, um ihre Hausaufgaben zu erledigen. Bei Regen wurde der Boden unter ihnen schlammig und rutschig. Und wenn es heiß war, wurden sie von Durst und Erschöpfung fast ohnmächtig.«
Sie standen schon an, bevor die Lebensmittel geliefert wurden – in der Hoffnung, dass irgendwann welche kommen würden. Familien schickten ihre Kinder, andere schickten Leute vor, die stellvertretend für sie anstanden – und natürlich musste man sich abwechseln. War man schließlich an der Reihe, wurde man oft mit harschen Beamten konfrontiert: »Die Beamten waren nicht freundlich«, erinnert sich Vu. »Sie waren herrisch – und sie hatten die Macht. Wir hatten das Gefühl, dass wir um das Essen betteln mussten, das uns rechtmäßig zustand.«
Wie viel Essen man bekam, hing vom Status der Familie ab. Staatsbedienstete erhielten mehr, Fabrikarbeiter weniger. Wenn nicht genug Reis da war, bekamen sie Weizen, aber viele wussten nicht, was sie damit anfangen sollten. Doch selbst wenn sie wussten, wie man Brot backt, war es schwierig, weil die dafür notwendigen Zutaten meist nicht vorhanden waren. Zudem brauchte man Strom für den Ofen, aber Elektrizität gab es nur wenige Stunden am Tag. Und den Strom nutzte die Familie nicht, um zu backen, sondern, um eine Lampe anzumachen oder ein altes Radio zu hören. Manchmal fiel der Strom plötzlich aus, dann musste man eine Kerze anzünden. Manche Familien stahlen Strom, aber das war gefährlich.
Vus Familie war sehr stolz darauf, ein Fahrrad zu besitzen. Obwohl es ziemlich alt war, empfanden sie es wie einen Rolls-Royce. Damals, in den 80ern und Anfang der 90er-Jahre, fuhren fast alle Vietnamesen Fahrrad. Heute in Hanoi sieht man nicht mehr viele Fahrräder, etwa 85 Prozent der Fahrzeuge auf den Straßen sind Motorräder und Mopeds.
Die Amerikanerin Nancy K. Napier, die die Berichte von Vietnamesen aus der Zeit vor und nach den Doi-Moi-Reformen zusammengetragen hat, überschrieb das Kapitel über die Zeit davor mit dem Wort »Hunger«. Sie unterrichtete ab 1994 an der National Economics University in Hanoi. Sie erinnert sich, was ihre Kollegen zu ihr sagten, wenn sie etwas zugenommen hatte: »Nancy, you are fat!« Sie belehrte die Vietnamesen, dass man einer amerikanischen Frau nie und unter keinen Umständen sagen solle, sie sei fett. Das verstanden sie nicht: »Oh, aber das heißt doch, dass du wohlhabend bist. Du hast genug zu essen, nur deshalb kannst du dick werden. Du solltest glücklich sein!«
Als ich 2022 einen Vortrag an der gleichen Universität hielt, sah ich gut gekleidete Studenten und Professoren, die voller Ehrgeiz waren, etwas aus ihrem Leben zu machen. Eine andere Erinnerung von Nancy Napier: Sie wunderte sich, warum es in Hanoi so wenig Vögel gab. Als sie die Frage stellte, schauten die Vietnamesen sie verdutzt an, so als ob sie nicht ganz richtig im Kopf sei. Sie klärten sie auf, dass die Menschen, die Hunger hatten, die Vögel fingen, um sie zu verzehren – sogar Spatzen. Viele Menschen waren damals unterernährt oder litten an Vitamin-A-Mangel. »Junge Mütter hatten manchmal nicht genug Milch für ihre Kinder. Deshalb kochten manche Reis und fütterten ihre Babys mit ›Reismilch‹ in der Hoffnung, dass die Nährstoffe ausreichen würden.«
Selbst das sowjetische Weißrussland wirkte verglichen damit wie ein Paradies. Luong Ngoc Khanh, der heute große Unternehmen besitzt und 1983 nach Minsk geschickt wurde, um Russisch zu lernen, erinnert sich: »Damals war Russland [gemeint ist Weißrussland] wie das Paradies. Dort hatten wir Äpfel, Milch und Fleisch. In Vietnam waren all diese Dinge Mangelware.«
Vietnamesen nennen diese Periode heute »Thoi Bao Cap« (Subventionsperiode) – es war die Zeit der sozialistischen Planwirtschaft, bevor Vietnam sukzessive durch die Doi-Moi-Reformen zu einer Markwirtschaft wurde. Vietnam hat sich durch diese Reformen massiv verändert, und dies ist das Thema dieses Kapitels: »Die Armut in Vietnam ist von einem Mehrheitsproblem zu einem Minderheitsproblem geworden.« Mit einem Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner von 98 USD war Vietnam 1990 noch das ärmste Land der Welt, noch hinter Somalia (130 USD) und Sierra Leone (163 USD).
Wie rückständig und arm Vietnam war – selbst im Vergleich mit anderen sozialistischen Ländern –, zeigen diese Zahlen: Die Elektrizität, die pro Einwohner produziert wurde, lag 1985 in Ungarn bei 4.656 kwh, in der DDR bei 6.839 kwh, in Polen bei 3.702 kwh und in Vietnam bei 87 kwh. Das durchschnittliche Einkommen (in Rubel) betrug 1960 in Ungarn 669,80 Rubel, in Polen 581,80 Rubel und in Vietnam 20 Jahre später (1980!) lediglich 50 Rubel.
Vor Beginn der ökonomischen Reformen führte jede Missernte zu Hunger, und Vietnam war angewiesen auf Unterstützung durch das World Food Programme der UNO und auf finanzielle Unterstützung der Sowjetunion und anderer Ostblockstaaten. Noch 1993 lebten 79,7 Prozent der Vietnamesen in Armut. Bis 2006 hatte sich die Quote auf 50,6 Prozent reduziert. 2020 lag sie bei nur noch 5 Prozent.
Fragt man nach den tieferen Ursachen des Erfolgs in Vietnam, so sind das vor allem der Pragmatismus und die Gegenwartsorientierung. Dieser Pragmatismus hat seine ideellen Wurzeln im Konfuzianismus. Der Pragmatismus zeigt sich nicht nur in den ökonomischen Reformen, sondern auch im Umgang mit der Geschichte und dem Verhältnis zu den Amerikanern.
Die Unternehmerin Ngyuen Xuan sagte mir: »Ich bin 1987 geboren, als der Krieg schon zwölf Jahre zu Ende war. Meine Eltern und Großeltern haben zwar davon erzählt, wie schrecklich der Krieg war, aber sie haben nie ein negatives Wort über die Amerikaner gesagt. Im Gegenteil: Sie haben mir gesagt: Du musst Englisch lernen, ziehe dich an wie Amerikaner, iss, was die Amerikaner essen, und vor allem lerne zu denken, wie die Amerikaner denken. Dann wirst du erfolgreich sein.«
In einer 2014 vom PEW Research Center durchgeführten Umfrage erklärten 76 Prozent der Vietnamesen, dass sie eine positive Sicht auf die USA haben. Bei den besser gebildeten Vietnamesen waren es sogar 89 Prozent und auch bei den Befragten von 18 bis 29 Jahren sahen 89 Prozent die USA positiv. Selbst bei den Personen über 50 Jahren, die den Krieg noch miterlebt hatten, bewerteten über 60 Prozent die USA positiv.
Ich bewundere immer Menschen, denen es gelingt, den Blick stärker in die Zukunft zu richten als in die Vergangenheit. Solche Menschen sind meist sehr viel erfolgreicher im Leben als jene, die sich ständig vorwiegend mit ihrer Vergangenheit befassen. Und das gilt nicht nur für Individuen, sondern auch für Nationen. Viele afrikanische Länder klagen heute über die Folgen des Kolonialismus und nehmen das als Erklärung für all ihre heutigen Probleme. Die Vietnamesen könnten das ebenso gut, sie tun es aber nicht – und richten ihren Blick in die Zukunft.
Gekürzter und um die im Buch enthaltenen Fußnoten zu den Quellen bereinigter Auszug aus:
Rainer Zitelmann, Der Aufstieg des Drachen und des weißen Adlers. Wie Nationen der Armut entkommen. FBV, 208 Seiten, 25,00 €