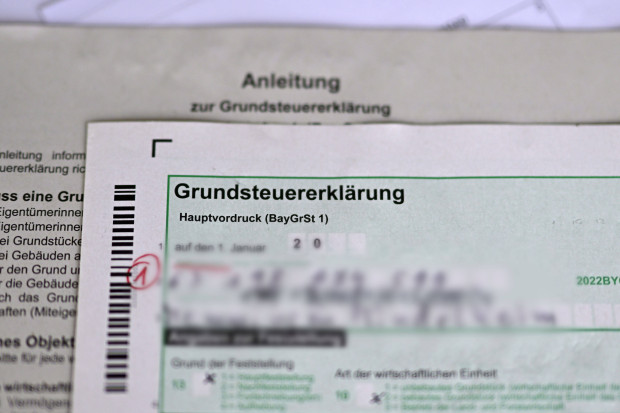Bislang ging es, wenn von den neu abzugebenden Grundsteuererklärungen die Rede war, vor allem um den nerven- und zeitaufreibenden Aufwand für die Grundeigentümer. Aber viele von ihnen wird die Reform nicht nur viele mühevolle Stunden mit Dokumenten und Ämtern kosten, sondern auch Geld. Treffen wird es aber voraussichtlich gerade nicht jene „Superreichen“, deren Vermögen nach Wunsch von Saskia Esken und Katrin Göring-Eckardt dem von ihren Parteifreunden regierten Staat noch mehr als bislang zugeführt werden soll.
Bizarr genug, dass die Bürger in Zeiten, da schon die vorherige Bundesregierung die Stelle einer Staatsministerin für Digitalisierung eingerichtet hatte, nun also Daten von verschiedenen Ämtern zusammentragen und einem anderen Amt in gewünschter Form präsentieren müssen, weil der Staat dies offenkundig selbst nicht hinkriegt. Die Amtsinhaberin Dorothee Bär verstand ihren Job in den mehr als drei Jahren offenkundig eher als Freifahrtschein zum ganztägigen Twittern denn als Aufgabe. Eine von ihr angekündigte „Bundeszentrale für Digitale Aufklärung“ gibt es nach wie vor nicht. In der neuen Bundesregierung ist Digitalisierung als „Querschnittaufgabe“ definiert, mit einem kaum durchschaubaren Zuständigkeitswirrwarr.
Das Versprechen von Bund und Ländern nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 2018, dass die Bürger unterm Strich nicht mehr zahlen müssen, ist allein deswegen schon unhaltbar, weil die Länder nur über das Modell der Berechnung entscheiden, aber die Kommunen die Steuer kassieren und auch über die sogenannten Hebesätze entscheiden. Darin sind sie frei. Es gibt sogar einige Gemeinden, die den Hebesatz auf Null gestellt haben, also auf jegliche Grundsteuer verzichten. Die Tendenz geht allerdings in die Gegenrichtung. Gerade in der Corona-Pandemie haben viele Kommunen ihre Hebesätze erhöht.
Die Umstände der neuen Grundsteuer sind sowohl unpassend, weil sie in eine Zeit fallen, in der die Bürger ohnehin unter steigenden Belastungen ächzen, als auch ungerecht. Denn voraussichtlich werden die Eigentümer in privilegierten Lagen nicht mehrbelastet werden, aber dafür ausgerechnet die ohnehin im Schnitt deutlich weniger vermögenden Bürger in den neuen Ländern und Ostberlin. Viele von ihnen werden wohl deutlich höhere Grundsteuern zahlen müssen.
Denn in den Ländern der ehemaligen DDR wurden bisher Werte aus dem Jahr 1935 herangezogen, in den westdeutschen Bundesländern basieren sie auf Zahlen aus dem Jahr 1964. Besonders große Steigerungen sind also in Ostberlin und rund um Berlin in Brandenburg zu erwarten. Und ausgerechnet Grundbesitzer in Münchens Bestlagen, wo die Immobilienpreise in den vergangenen Jahrzehnten besonders explosiv gestiegen sind, kommen wohl weitgehend ungeschoren davon. „Für zwei gleich große Wohnungen in München in Bestlage und in einfacher Wohnlage wird künftig Grundsteuer in derselben Höhe fällig“, zitiert Focus.de einen Berater von Ernst & Young.
Das Portal „kommunal.de“ hat beispielhafte Rechnungen zusammengetragen, etwa vom Verband der Hausbesitzer für Hohen Neuendorf in Brandenburg. Der Hebesatz dort liegt bei 350 Prozent. „Für ein vom Verband berechnetes Musterhaus wurden somit bisher rund 210 Euro fällig. Künftig wären es bei gleichem Hebesatz 385 Euro. Alternativ müsste der Hebesatz auf 190 Prozent sinken, sollte das Versprechen, dass es unterm Strich für Hausbesitzer nicht teurer wird, eingelöst werden. Jedoch ist im örtlichen Gemeinderat bereits ein entsprechender Antrag auf Selbstverpflichtung, den Hebesatz so anzupassen, dass die Stadtkasse unterm Strich nicht mehr Geld einnimmt als bisher, abgelehnt worden.“
Die meisten ostdeutschen Gemeinden müssten ihre Hebesätze also aktiv senken, um den Grundeigentümern eine Steuererhöhung zu ersparen. Die Versuchung für die Lokalpolitiker dürfte groß sein, dies einfach bleiben zu lassen.