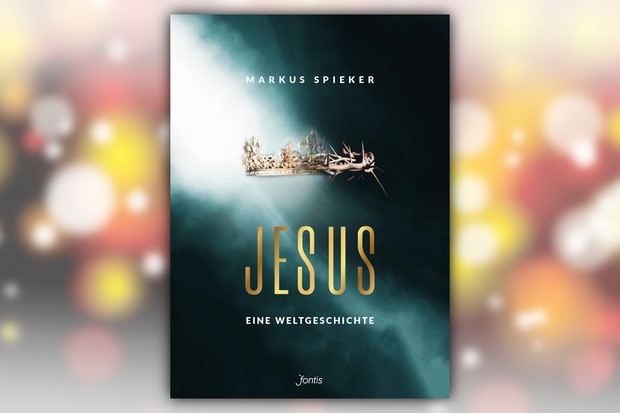Die Verunglimpfung des sogenannten Mittelalters täuscht über dessen tatsächliche Errungenschaften hinweg. Allein das Wort «Mittelalter» degradiert die Zeit zwischen den Jahren 500 und 1500 zu einer Sandwich-Epoche zwischen Antike und Neuzeit. Dabei nahmen viele Entwicklungen, denen wir unseren heutigen Wohlstand verdanken, damals ihren Ausgang. Mit der Etablierung des Christentums als vorrangige europäische Religion entstand nichts Geringeres als: Die Moderne.
Das ist kein Scherz, sondern zumindest dem Wortsinn nach, unumstößlicher Fakt. Mit dem Christentum kam nämlich ein neues Wort in Umlauf. «Modernus», abgeleitet von «modo», übersetzt: soeben. Normalerweise wird das Wort «modern» nicht mit den Christen der Spätantike assoziiert. Aber sie waren es, die das Wort «modern» benutzten, um die neue Zeit von der zurückliegenden heidnischen Epoche zu unterscheiden. Tatsächlich gehen viele Innovationen der letzten Jahrhunderte zurück auf Entwicklungen, die in der Spätantike und im Mittelalter von Christen angestoßen wurden.
Die Christen waren die Bewahrer und Neuerfinder, nicht die Zerstörer des Abendlandes. Das Römische Reich war an Überdehnung, aber auch an innerer Erschlaffung zugrunde gegangen. Das stagnierende Imperium, das von der Bretagne bis hinter den Bosporus reichte, konnte dem Druck nicht standhalten, der von den nach Europa eingewanderten Völkern ausging, ganz zu schweigen von Klimakatastrophen, Missernten, Hungersnöten und verheerenden Seuchen.
Der christliche Glaube, der ab dem vierten Jahrhundert die ausgelaugten Götter- und Kaiserkulte ablöste, erwies sich als Rettung in der Not. Die Christianisierung der germanischen Stämme schuf Brücken der Verständigung. Die Metzeleien des Hunnenkönigs Attila wären nicht die Ausnahme, sondern die Regel gewesen. Weil die Menschen von Island bis Sizilien, von der schottischen Nordsee bis zum östlichen Mittelmeer eine gemeinsame Glaubensbasis hatten, kooperierten sie immer besser miteinander. Nicht immer, aber immer öfter.
Waffenruhe und Kollaborationsbereitschaft waren die eine Vorbedingung für Fortschritt, die andere war Bildung. Darum verdient machte sich die imposanteste Herrscherpersönlichkeit des frühen Mittelalters, Karl der Große. Der Frankenkönig, der im Jahr 800 auch zum «römischen Kaiser» gekrönt wurde, machte seinen Hof zum Wissenszentrum. Karl liebte es, mit Gelehrten zu tafeln. Er las gerne die Bücher von christlichen Vordenkern wie Augustinus und Boëthius. Angeregt debattierte er mit Theologen darüber, wie der Erlösungstod Jesu denn genau zu verstehen sei, und wollte von ihnen wissen, welche Lieder Jesus mit seinen Jüngern wohl beim Abendmahl gesungen hatte.
Im Alter von ungefähr 33 Jahren hatte Karl eine folgenschwere Begegnung. Er traf auf den etwa dreizehn Jahre älteren britischen Mönch Alkuin, der als einer der gelehrtesten Köpfe seiner Zeit galt. Karl engagierte ihn als Bildungsbeauftragten. Alkuin trieb die Alphabetisierung im Land voran und half dabei, eine fränkische Bildungselite zu formen. Eine entscheidende Rolle kam den Klöstern zu. Sie erweiterten ihre Bücherbestände und boten Schulunterricht an.
Verglichen mit dem Geld, das zur gleichen Zeit die arabischen Kalifen in Kultur und Wissenschaft investierten, war die «Karolingische Renaissance» ein eher bescheidendes Unternehmen. Aachen verhielt sich zu Bagdad wie heute Greifswald zu New York. Mit dem Hinweis darauf geht oft die Unterstellung einher, der wahre Fortschrittsmotor im Mittelalter sei nicht das Christentum, sondern der Islam gewesen. Die deutschen Mönche mochten noch so fleißig alte Schriften kopieren; sie konnten nicht heranreichen an die Massenübersetzung antiker Bücher ins Arabische.
Das stimmt, aber eben nur zum Teil. Die Kalifen profilierten sich in der Tat als Bildungsmäzene. Die eigentliche Forschungsarbeit leisteten aber bis zum Jahr 1000 viele Christen. Einer von ihnen, Hunain Ibn Isaak, spielte im 9. Jahrhundert am arabischen Kalifenhof eine ähnliche Rolle wie in der Bibel Daniel am Hof des Perserkönigs Darius. Hunain glänzte durch sein Wissen, bestach aber auch durch seine Integrität. Hunain kannte sich besser als jeder andere mit den Schriften von Platon, Aristoteles, Archimedes und Euklid aus. Viele davon übersetzte er selbst ins Arabische. Er profilierte sich auch als Mathematiker und verfasste ein mehrbändiges Werk zur Augenheilkunde.
Gleichzeitig wechselte der europäische Fortschrittsmotor in einen höheren Gang. Ein Grund dafür war naturgegeben. Die Temperaturen kletterten wieder in die Höhe. Die Ernten fielen üppiger aus, auch dank neuer landwirtschaftlicher Techniken. Die Einführung des eisernen Räderpflugs machte es leichter, harte Böden umzugraben. Bessere Erträge führten zu mehr Handel. Neue Städte entstanden. Das Handwerk florierte.
Bald gab es auch nichtkirchliche Bildungseinrichtungen. 1088 nahm in Bologna die erste Universität den Lehrbetrieb auf. Das Wort «Wissenschaft» kam in Gebrauch. Es wurde heller in der Welt. Von wegen «dunkles» Mittelalter: Die lichtdurchfluteten gotischen Kathedralen symbolisierten eine Zeit, in der die Sonne des Geistes immer höher stieg. Je klarer die Menschen die Welt um sich herum sehen und erforschen, desto mehr lernen sie auch über den dreieinigen Gott, den Schöpfer, den Erlöser, den Helfer. Der Glaube an einen Gott, der die Menschen erschaffen hat, sie erlösen will und durch seinen Heiligen Geist weiter in der Welt präsent ist, beruhigt eben nicht nur. Er dient auch als Motivationshilfe dafür, die Geheimnisse des Universums und des Menschseins noch gründlicher zu erforschen.
Ins Hochmittelalter, also in die Jahre zwischen 1050 und 1250, fallen die Kreuzzüge. Es ist auch die Zeit der Scholastik. So nennt man den damals dominierenden Bildungsansatz. Das Wort «Scholastiker» ist aus dem Griechischen abgeleitet und bedeutet so viel wie «gelehrte Müßiggänger». Damit wird man den Intellektuellen dieser Zeit sicher nicht gerecht. Was zutrifft: Ihre Gedankenanstrengungen waren eher abstrakt und spekulativ, mehr auf die Beantwortung theoretischer Fragen ausgerichtet als auf die konkrete Verbesserung der Lebensbedingungen.
Für einen ganz anderen Ansatz plädierte ein Franziskanermönch, dem seine Brillanz den Beinamen «Doktor Mirabilis», «Erstaunlicher Lehrer», einbrachte: Roger Bacon. Er lebte an der Schwelle vom Hoch- zum Spätmittelalter, von 1220 bis 1292. Von den theologischen Debatten seiner Zeit hielt er sich fern. «Es gibt nur eine vollkommene Weisheit», war er überzeugt, «und die ist in der Heiligen Schrift vollständig erhalten.»
Bacon wehrte sich dagegen, vorgegebene Meinungen nachzuplappern. Er beschrieb vier Hindernisse, die aus seiner Sicht den Fortschritt behinderten: Autoritätshörigkeit, Gewohnheit, Konformismus und Sturheit. Wer die Dinge begreifen wollte, wie sie sind, durfte nicht nur darüber palavern, sondern musste ihnen auf den Grund gehen. Wer Gott kennenlernen wollte, musste Gottes Wort studieren, vorzugsweise im Original. Und wer die Welt kennenlernen wollte, musste sie genau beobachten: «In den Naturwissenschaften kann man ohne Erfahrung und Experiment nichts Zureichendes wissen.»
Das gilt ganz besonders für den Naturforscher und frühreformatorischen Hobby-Theologen Theophrastus Bombastus von Hohenheim, besser bekannt als «Paracelsus». Er kam einige Jahre nach Luther in der Schweiz zur Welt und fühlte sich trotz seiner adligen Abstammung vor allem zu einfachen Leuten hingezogen. Er vollzog einen radikalen Bruch mit dem medizinischen Wissen der antiken Griechen und der mittelalterlichen Araber. Nach dem Motto: «Den papiernen Büchern ist nicht zu vertrauen», setzte Paracelsus auf das unmittelbare Beobachten der Natur, entwickelte daraus neue Therapien und Arzneien. Er wollte das Leben der Menschen verbessern und war deshalb überzeugt: «Der höchste Grund der Arznei ist die Liebe.»
Während Paracelsus die Medizin ausschließlich im «Licht der Natur» betreiben wollte, akzeptierte er für die Theologie allein «das Licht des Evangeliums». Einige Jahre durchzog er als Wanderprediger das Gebiet der Schweiz und des heutigen Österreichs. So sehr ihn die natürliche Welt faszinierte, so klar war für ihn die Priorität der göttlichen Transzendenz: «Christus ist übernatürlich und über der Natur, und die Natur ist unter ihm.»
Während Paracelsus, der sich auch leidenschaftlich für Alchemie interessierte, als Übergangsfigur zwischen Mittelalter und Neuzeit gilt, markiert der Kirchenjurist, Arzt und Astronom Nikolaus Kopernikus den Beginn der neuzeitlichen Wissenschaft. Seine Schrift «Über die Umdrehungen der himmlischen Kreise» verbannte die Erde aus dem Zentrum des damals bekannten Universums. Genau wie Paracelsus war Kopernikus ein tiefgläubiger Christ.
Das galt auch für den Engländer Francis Bacon. Er knüpfte um das Jahr 1600 an die Erkenntnisse seines Namensvetters Roger Bacon an und wurde so zum zweiten Pionier des Empirismus. Wissenschaftlich arbeiten – das bedeutete künftig, Erfahrungen auszuwerten und Experimente durchzuführen, nicht bloß zu spekulieren und alte Traditionen wiederzukäuen. Theorie war so lange grau, wie sie nicht durch die Praxis bestätigt wurde.
Paracelsus, Kopernikus, Bacon – sie alle ließen sich nicht nur von ihrer Neugier anstacheln. Sie beherzigten auch die Worte von Psalm 19: «Der Himmel verkündet Gottes Hoheit und Macht und das Firmament bezeugt seine großen Schöpfungstaten.» Dieser Botschaft und diesem Zeugnis galt es, auf die Spur zu kommen. Genau wie die Bibel war für die christlichen Wissenschaftler auch die Natur eine göttliche Offenbarung, die man studieren konnte. «Groß sind die Werke des Herrn», hatte der Dichter des 112. Psalms gejubelt, «wer sie erforscht, der hat Freude daran.»
Aus dieser Überzeugung verabschiedete sich Johannes Kepler von seinem ursprünglichen Berufswunsch, Pfarrer zu werden, und widmete sich stattdessen der Erforschung der Gestirne. Kepler war in Süddeutschland geboren und in einfachsten Verhältnissen aufgewachsen. Sein Vater, ein Berufssöldner, starb auf dem Schlachtfeld. Die Zeiten, in denen er lebte, waren ebenfalls chaotisch. Kepler erlebte die schlimmsten Auswüchse des Hexenwahns: Seine eigene Mutter wurde als Zauberin angeklagt und wäre fast verbrannt worden. Als Kepler 46 Jahre alt war, brach der Dreißigjährige Krieg aus. Wegen seiner protestantischen Konfession musste er mehrfach Wohnort und Arbeitsplatz wechseln.
Umso stärker beeindruckt war Kepler von der Ordnung und Schönheit, die er in der Schöpfung beobachtete. Für ihn waren «die Himmelsbewegungen nichts anderes als eine fortwährende mehrstimmige Musik». In der Beschäftigung mit den Planeten und Sternen fühlte sich Kepler, als würde er «die Gedanken Gottes nachlesen». Sein Leitspruch war: «Ich suche in mir den Gott, den ich außer mir überall finde.»
Für Kepler blieb Jesus trotz aller Schicksalsschläge sein geliebter «Herr und Heiland». Kepler war der Erste, der den Stern von Bethlehem als dreifache Jupiter-Saturn-Konjunktion deutete und für die Zeit unmittelbar vor der Zeitenwende nachwies. Für ihn war damit klar erwiesen, dass «Jesus Christus nicht nur ein Jahr vor Anfang unserer heutzutage gebräuchlichen Jahreszahl geboren ist, sondern fünf ganze Jahre».
Als der Glaube an einen persönlichen Gott in gebildeten Kreisen bereits schwindet, veröffentlicht der englische Theologe William Paley am Anfang des 19. Jahrhunderts ein Buch über «Naturtheologie» und vergleicht Gott darin mit einem Uhrmacher: «Stell dir vor, du gehst spazieren und findest eine Uhr auf dem Boden liegen. Während du sie untersuchst, staunst du über das komplexe Zusammenspiel der einzelnen Teile, die alle einem gemeinsamen Zweck dienen. Zweifelsohne wirst du nicht auf den Gedanken kommen, dass dieses erstaunliche Gerät zufällig entstanden ist. Die Uhr weist auf einen Macher hin. Was für die Uhr gilt, das gilt noch weit mehr für die Natur. Schau dir nur die Komplexität des menschlichen Auges an. Der Schluss ist zwingend, dass die Natur einen Schöpfer hat.»
Das Uhrmacher-Argument, das vor Paley auch schon Robert Boyle sowie die Philosophen René Descartes und Gottfried Wilhelm Leibniz benutzten, hat bis heute nichts von seiner Schlüssigkeit verloren.
Auch im 19. und 20. Jahrhundert waren es immer wieder Christen, die der Wissenschaft wichtige Impulse gaben. Zu erwähnen sind der Mikrobiologe Louis Pasteur; der Pionier der Genforschung, Gregor Mendel; und der Begründer der Urknalltheorie, Georges Lemaître.
Die beiden Quantenphysiker Max Planck und Werner Heisenberg waren zwar nicht gerade orthodox christlich eingestellt. Ihr Gottesbekenntnis ist dennoch beachtenswert. «Religion und Naturwissenschaft schließen sich nicht aus, wie heutzutage manche glauben und fürchten», versicherte Planck, «sondern sie ergänzen und bedingen einander. Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende aller Überlegungen.»
Heisenberg, der Entdecker der Unschärferelation, kam zu einem ganz ähnlichen Schluss: «Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott.»
Leicht gekürzter Auszug aus:
Markus Spieker, Jesus. Eine Weltgeschichte. Fontis Verlag, Hardcover mit Überzug, goldenes Vorsatzpapier, goldfarbenes Lesebändchen, 1004 Seiten, 30,- €.