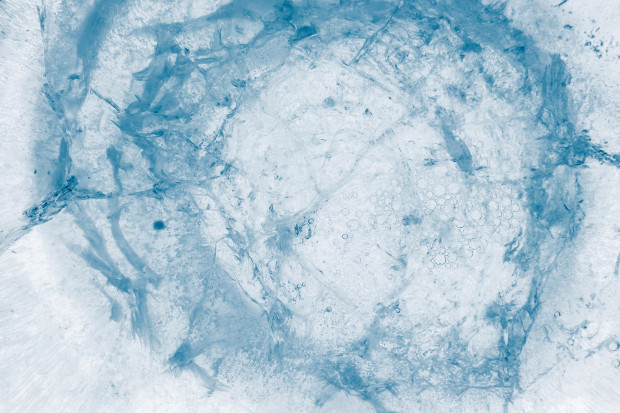Ein Tigerhai (mittlerweile der zweite, da der erste auseinandergefallen war), in einer aquariumartigen Vitrine, konserviert in fünfprozentiger Formaldehydlösung. Das Maul des Tieres ist aufgerissen. Wer es wagt, sich von Angesicht zu Angesicht vor den Hai zu stellen, blickt erst auf dessen Zähne, und dann tief in den Rachen des Tieres hinein (so beim zweiten Hai, beim ersten war das Maul nur ein klein wenig geöffnet, siehe etwa independent.co.uk, 11.1.2008 und Wikipedia-Foto – für das aktuelle Werk siehe etwa dieses YouTube-Video, eventuell ohne Ton).
Es wäre die Szene eines todbringenden Angriffs – wenn der Hai nicht festgehalten würde in einer weißgerahmten Vitrine, in giftiger Lösung, und vor allem natürlich in der Tatsache, dass er tot ist.
Die Rede ist vom bekanntesten Kunstwerk des Briten Damien Hirst. Der Titel, der ein fundamentaler Teil des Werks ist, lautet: »The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living«, zu Deutsch: »Die physische Unmöglichkeit des Todes in der Vorstellung eines Lebenden«.
1991, als das Werk entstand und breit in der Kunstszene diskutiert wurde, war ich noch Schüler, zwei Jahre vorm Abitur. Ich belegte Kunst als »Leistungsfach«, und vielleicht liegt es daran, dass ich mich an die Debatte erinnere – doch heute verstehe ich die dringende Aktualität dieses »Monsterwerkes«.
Selbst Kritiker, die der modernen Kunst offen gegenüberstehen (wie doch alle Kunstkritiker, die heute ihren Beruf ausüben wollen), stellten die Frage, ob ein in Formaldehyd eingelegter Haifisch wirklich »Kunst« ist. Allen ablehnenden Profi- und Hobbykritikern gilt Hirsts Hai heute als eines der Schlüsselwerke jener Epoche.
Es gibt eine Frage, die ich mir vor Jahrzehnten nebenbei stellte (nachdem ich sie mehrfach las), die mich in den letzten Jahren aktiv zu beschäftigen begann, und die mich heute körperlich spürbar quält – und ich weiß aus Ihren vielen E-Mails, dass diese Frage auch viele von Ihnen schlaflos lässt.
Ich meine, im Werk »The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living« heute den Ansatz einer Erklärung zu sehen. Nicht einer Lösung nein (das Wort »Impossibility« ist nicht trivial!) – es ist (nur) der Ansatz einer Erklärung.
Zu verharren
In der Bibel, in Genesis 19:1-29, lesen wir von Lot, der auf göttlichen Befehl hin aus Sodom flieht – ja, dem Sodom, das wir aus der Redensart »Sodom und Gomorrha« kennen. Da die beiden Städte so sündig sind, will Gott sie zerstören, und Lot erhält als einziger Gerechter in der Stadt die Chance, samt seiner Familie zu fliehen. Lots Frau ist wohl wenig angetan vom Gedanken, aus der lebensfrohen Stadt Sodom mit der lebendigen Partyszene fortzugehen, wegen irgend einer Warnung des Himmels. Entgegen eines ausdrücklichen Verbots dreht sich Lots Frau auf der Flucht aus der Stadt noch einmal um – und erstarrt zur Salzsäule (ja, daher stammt diese Redeweise). Lot aber zieht mit seinen zwei Töchtern weiter nach Zoar (wo ganz andere merkwürdige Dinge geschehen, doch das ist ein anderes Thema).
Die große Frage, die mich zu quälen beginnt: Was dachte sich Frau Lot dabei? – Präziser gefragt: Wir wissen, dass Frau Lot sich nach der Stadt zurücksehnte – aber warum sehnte sie sich zurück, obwohl doch klar sein sollte, dass diese zerstört werden wird?
Diese quälende Frage, was Lots Frau zurückhielt, sie begegnet uns in unseren Geschichten wie auch in unserer Geschichte immer wieder, vielleicht häufiger als wir es uns wünschen würden.
Im Film Titanic, als das unsinkbare Schiff sinkt und »Nearer My God to Thee« gespielt wird (siehe YouTube), sehen wir Menschen, die mit aller Kraft versuchen, sich und ihre Familie zu retten, wie gering die Chance auch sein. Doch wir sehen auch eine Mutter, die ihre Kinder liebevoll ins Bett bringt und zudeckt, auf dass sie friedlich schlafend in ihr eiskaltes Wassergrab sinken. Im Bewusstsein, dass das Thema emotional geladen ist und bereits die Frage moralschwer wirken könnte, frage ich mich, ohne jedes Vorab-Urteil: Ich verstehe, warum die Kämpfer kämpfen, doch was sind die Motivation und innere Logik der Mutter?
In manchen bis heute von den Schrecken des Dritten Reiches geprägten Familien fragt man sich: Was bewegte einige Menschen zum Dableiben, was hielt sie, obwohl und als es bereits abzusehen war, dass dazubleiben für sie tödlich enden könnte?
Man darf dieselbe Frage auch heute stellen, zunächst allgemein: Was bewegt Menschen, zu verharren und nichts zu tun, obwohl ein auch für sie gefährlicher Ausgang droht, der sich durch Aktion vielleicht abwenden ließe?
Etwas konkreter: Was bewegt Menschen etwa, ihre Kinder weiter zu einer Schule zu schicken, in welcher den Kindern (zum Beispiel durch antideutschen Rassismus) ernsthafter Schaden an Körper und Seele droht? Oder: Was bewegt Menschen, einen Politiker oder eine Politikerin zu wählen, dessen Politik bereits ihre Heimat zu zerstören begonnen hat?
Uns zugängliches Farbspektrum
Was den Menschen zu seinem Tun treibt, was er so tut und treibt, es ist stets mehr als nur eine einzige Kraft. Es ist mehr als ein Pferd, das an unserem Wagen zerrt, und wenn die Pferde sich uneins sind, droht das Zerren den Wagen umzuwerfen. Und doch: Manche Motivatoren scheinen mir stärker zu sein als andere, manches Pferd wilder als die übrigen Gäule.
Von wilden Pferden zum Rehwild: Es gibt die einen Rehe, die vorm sich schnell nähernden Auto geschwind zur Seite springen. Und es gibt die anderen Rehe, die wie hypnotisiert in die Lichter blicken, bis es ungeplantes Wildbret gibt. Was unterscheidet die einen Rehe von den anderen?
Ich will wagen, eine These vorzulegen bezüglich einer der beharrenden Kräfte, welche Lots Frau zögern ließen, und sie hat mit Damien Hirsts konserviertem Haifisch zu tun.
»Die physische Unmöglichkeit des Todes in der Vorstellung eines Lebenden«, so der Titel jenes Werkes in der deutschen Übersetzung – er stellt ja selbst eine These auf, und das ohne ein einziges finites Verb. Der Titel impliziert (oder fragt er es?): Der Mensch ist aufgrund der Beschaffenheit seines Gehirns nicht imstande, sich den Tod vorzustellen.
Ich erlaube mir, die implizierte These für meine essayistischen Zwecke zu paraphrasieren und, semantisch durchaus als ko-extensiv denkbar, »Tod« durch »das maximal Schreckliche« zu ersetzen. Desweiteren würde ich gern die Allaussage des Künstlers einschränken, denn aus der Einschränkung entwickelt sich meine Erklärung. Schließlich will ich die etwas dickpinselige »physische Unmöglichkeit« aufs »einfach nicht vorstellen können« reduzieren.
Also, derart: »Manche Menschen können sich das maximal Schreckliche einfach nicht vorstellen.«
Die Formulierung »können nicht« meine ich im Geiste der ursprünglichen »physischen Unmöglichkeit«. So wie wir Menschen uns keine Farben außerhalb des uns zugänglichen Farbspektrums vorstellen können, so wie sich Menschen mit gewissen inneren Eigenschaften nicht (»empathisch«) vorstellen können, was für Gefühle in anderen Menschen stattfinden, so können auch manche Menschen sich nicht das maximal Schreckliche vorstellen.
Dass einige von uns körperlich nicht in der Lage sind, sich etwas maximal Schlimmes vorzustellen – und das kann sehr gefährliche gesellschaftliche und politische Konsequenzen haben.
»Wollt ihr den totalen Krieg?«, brüllte Goebbels am 18. Februar 1943 im Berliner Sportpalast, »Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können?«
Die Menge sagte, dass sie ihn wollte. Jedoch, die Menge sagte auf eine gewisse Weise die Unwahrheit – und welche Unwahrheit sie sagte, das war ja bereits in der gebrüllten Frage enthalten: »totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können«: Das maximal Schreckliche ist für die meisten Menschen unvorstellbar, es ist »physisch unmöglich«. Wie soll man wollen können, was man sich nicht einmal vorstellen kann?
Der Mensch, der sich das maximal Schreckliche nicht vorstellen kann, führt das maximal Schreckliche eher herbei, sei es aktiv oder durch blindes Hineingleiten (in der Geschichte meist eine Kombination aus beidem).
Die Worte sind nicht dasselbe wie das, was sie bezeichnen, und das Gefühl im Moment des Aussprechens fühlt sich noch einmal ganz anders an. Die Menschen, die 1943 dem »totalen« Krieg zujubelten, fühlten sich im Aussprechen gut – die Bedeutung dessen, was sie aussprachen, konnten sie sich ja, wie ihnen sogar direkt gesagt wurde, gar nicht vorstellen. Im psychologischen Mechanismus war die Reaktion des Sportpalast-Publikums vergleichbar jener der Gutmenschen von heute, die »Keine Grenzen!« rufen, und sich im Brüllen gut fühlen, weil sie sich einfach nicht vorstellen können, was all das, was sie brüllen, wirklich und praktisch bedeutet (das Ende des Rechtsstaates, der nur in Grenzen existieren kann, und ohne den das Land in Anarchie, Korruption und brutale Mobherrschaft verfällt – damit ein Land ohne Grenzen und Abweisung von Fremden existieren kann, muss es notwendigerweise weniger attraktiv als alle übrigen Länder der Nachbarschaft sein, und »Nachbarschaft« ist heute praktisch die gesamte Welt).
Ein Mensch kann sagen und behaupten, dass er sich das maximal Schreckliche vorstellen kann, doch wenn es in ihm praktisch keine Handlungsmotivation auslöst, dürfen wir in Frage stellen, wie »lebendig« seine Vorstellung ist, ob es überhaupt eine »Vorstellung« jenseits der ausgesprochenen Worte ist.
Wer noch am Abend des 30. Juni 1946 am Strand des Bikini-Atolls spazieren ging, der konnte ruhige Wellen an den Strand rollen sehen und hören, die warme Meeresluft atmen und den Palmen zusehen, wie sie sich friedlich in der Pazifik-Brise wogen.
Stellen wir uns vor, jener von der karibischen Natur bezauberte Strandenthusiast wäre auf einen panischen Fremden gestoßen, der ihm zugerufen hätte: »Es wird alles ganz schrecklich werden! Wir werden sterben! Wir müssen weg, so schnell wie möglich! Weit weg!« – Der von der Natur bezauberte Strandläufer hätte das panische Geschrei als Verrücktheit abgetan, als Irrtum eines Fehlgeleiteten, der einfach nicht die Schönheit des Moments zu genießen weiß. – Nun, wie wir wissen explodierte am 30. Juni 1946 um 22:00 Uhr UTC, also Mitternacht lokaler Zeit, über dem Bikini-Atoll die Bombe namens Able mit 23 Kilotonnen Sprengkraft, einer von vielen folgenden Atomtests (woraufhin eine gewisse Damen-Strandkleidung nach jenem »heißen« Atoll benannt wurde). Eine Minute bevor die Atombombe explodierte, war das Bikini-Atoll ein sehr idyllischer Ort.
Wer es sich einfach nicht vorstellen kann, dass etwas Schreckliches passiert, dem erscheint derjenige, der es sich vorstellen kann und davor warnt, wie ein depressiver Spinner, ein Bösartiger und immerzu negativer Abweichler. Ich glaube, dass es einen Grund hat, warum im selben Volk ein lautes »Hurra« zum totalen Krieg gebrüllt wird und später »besorgte Bürger« als Schimpfwort gilt. Wer sich das Schreckliche nicht vorstellen kann, der droht eben dieses immer wieder herbeizuführen.
Wieviel und welche Schuld
Ich lege eine Erklärung für eine der Motivationen des merkwürdigen menschlichen Beharrens im Angesicht des möglichen maximal Schrecklichen vor.
Ich habe keine Lösung parat – noch nicht. Ich versuche, das Muster des Problems nachzuzeichnen. Ethische Dilemmas entstehen meist, indem zwei Strukturen bedroht sind, die uns beide sehr relevant sind, und wir also ungewohnte, sonst wenig beachtete Kriterien zur Entscheidung heranziehen. Das wohl bekannteste ethische Denkexperiment ist das »Trolley-Problem« (siehe etwa Essay vom 1.12.2017). Ich sehe uns hier vor einem ethischen Problem, das man der Einfachheit halber »Lots Dilemma« nennen könnte.
Was soll Lot tun? Soll Lot versuchen, seine unwillige Frau vom Blick zurück abzuhalten? Soll Lot gar ihren Willen brechen und sie mit gewisser Gewalt dazu zwingen, aus Sodom zu fliehen ohne einen Blick zurück? Wieviel und welche Schuld trägt Lot daran, dass seine Frau zur Salzsäule wurde?
Nehmen wir an, ein Familienvater im Dritten Reich sah die Katastrophe nahen, doch seine Familie wollte einfach nicht fort, weil sie anders als er nicht in der Lage war, sich das maximal Schreckliche vorzustellen, zumindest nicht realistisch genug, um die Gefahren und Verluste der rechtzeitigen Flucht auf sich zu nehmen. Was sollte der Familienvater tun? Sollte er es aufgeben und selbst fliehen? Sollte er bis zuletzt versuchen, die Familie von der Gefahr zu überzeugen, die sie nicht sah?
Ich rede heute mit Bürgern, die buchstäblich ihre Kinder an die von deutschem Staatsfunk und Propaganda-NGOs gepredigte gutmenschliche Ideologie verloren haben (siehe auch »Hast du deinem Verräter die Windeln gewechselt?« von 2018). Wie soll sich ein Familienvater entscheiden, wenn die Kinder und/oder die Ehefrau nicht in der Lage sind, sich das Wahrscheinliche vorzustellen? Man kennt ja die Formulierungen: »Das wird schon werden.«, »Frau Merkel kümmert sich, gut, dass wir sie haben«, »Du mit deinen Verschwörungstheorien« – wenn es nicht gleich in heftigere Kategorien vorstößt, etwa ins Pseudopolitische (»Du Nazi«) oder Vulgärpsychologische (»geisteskrank«, »depressiv«, »-phob«).
Seine Zähne zählen
Das konzeptuelle Kunstwerk »The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living« ist eine Skulptur in der »echten Welt«, seit 1991 schon sehr real, und als solche von allen Seiten zu betrachten. Der Haifisch ist nicht »unvorstellbar« – wenn es gelingt, ihn ausgestellt zu sehen, kann der Haifisch sehr wohl betrachtet und damit vorgestellt werden, und wenn nicht, existieren noch immer zahlreiche Bilder und Videos im Internet (hier ein Video-Schnipsel auf YouTube).
Wir können dem Kunstwerk-Hai in die Augen und in den Rachen blicken, seine Zähne zählen und seine Falten bedauern. Den tatsächlichen Hai des Künstlers können wir alle sehen, und die, die sich dem Hinschauen verweigern – es ist ja gruselig! – die wissen, dass sie sich verweigern. Das ist ja die Aufgabe der Kunst: Kunst macht aus dem Unvorstellbaren etwas Davorstellbares. (Witzerklärung: Etwas, wovor man sich mit kluger Miene hinstellen kann.)
Das maximal Schreckliche aber, dass sich einige Menschen nicht vorstellen können, ist nicht wie der Haifisch, auf dessen Rachen man einfach so zeigen könnte.
Und selbst unter denen, die das maximal Schreckliche ahnen, gibt es jene, die es zwar durchaus sehen, die aber beschließen, in Ruhe unterzugehen sei vorzuziehen gegenüber einem Kampf ums Überleben, dessen Erfolgschancen ohnehin dünn sind – siehe jene Mutter auf der Titanic, die ihre Kinder liebevoll zum letzten Mal zudeckte.
Auch ist es ja durchaus denkbar, dass jene, welche das maximal Schreckliche zu sehen meinen, sich irren – man denke nur an die vielen religiösen Weltuntergangspropheten mit ihren zuverlässig falschen Weltuntergangsdaten.
Am Ende gewinnt immer die Realität, ob wir uns die Realität zuvor irrational strahlend oder irrational gefährlich malten. Es empfiehlt sich, unsere Vorhersagen an die tatsächlichen Kausalitäten anzupassen – außer in Märchen, Träumen und sozialistischen Manifestos passen sich die Kausalitäten eher selten unseren Vorhersagen an.
Rückverwandlung der Salzsäule
»The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living« lädt uns ein, fordert uns auf, ja: zwingt uns, wenn wir nicht gänzlich unsensibel für diese Dinge sind, dem Hai ins aufgerissene Maul zu blicken.
Der Hai ist tot, das macht die Angelegenheit ein wenig weniger schrecklich (und auf andere Art noch schrecklicher). Das andere Schreckliche, das lebt auch, doch nur eine Zahl von uns können seine Zähne blitzen sehen.
Lot sah die Zähne des Haifisches, und er floh. Lots Frau sah sie nicht, sie wollte zurück nach Sodom.
Was sollte Lot tun? Hätte Lot nicht alles geben sollen, seine Frau zu retten, ja sogar die Salzsäule zwecks Rückverwandlung mitnehmen?
Ich weiß es nicht. Ich wünsche niemandem, in Lots Lage zu geraten. Ich fürchte, dass wir längst in Lots Lage geraten sind – gesellschaftlich, wirtschaftlich, kulturell, politisch.
Ich bin mir sehr wohl dessen bewusst, dass auch »grüne« Weltuntergangs-Panikmacher sich in ähnlicher Lage sehen – und uns alle als »Lots Frau« betrachten. Im Szenario der Öko-Apokalyptiker wird Lots Frau, wenn sie sich umdreht, die gesamte Familie und dazu den Rest der Menschheit auslöschen.
Helft mir, liebe Freunde eingelegter Haifische, einen Rat für Lot zu finden (einberechnend, dass er sich irren könnte)! Manche Dinge werden komplizierter, je besser man sie versteht – diese Angelegenheit scheint nach Erklärung schier unlösbar. Hofft, nicht selbst zum Lot zu werden!
Schaut dem Haifisch ins Gesicht, ins aufgerissene Maul – und versteht, dass einige eurer Lieben den Haifisch einfach nicht sehen können.
Die Welt kann ja so schön sein, auch mit Haifischen im Wasser! Bleibt halt am Ufer, am Strand unter den Palmen.
Nehmt einen Cocktail in die eine Hand und euren Schatz an die andere, raunt euch romantischen Unsinn in die Ohren, lacht und schlürft, und genießt diesen schönen Abend am Bikini-Atoll.
Dieser Beitrag erschien zuerst auf dushanwegner.com
Dushan Wegner (geb. 1974 in Tschechien, Mag. Philosophie 2008 in Köln) pendelt als Publizist zwischen Berlin, Bayern und den Kanaren. In seinem Buch „Relevante Strukturen“ erklärt Wegner, wie er ethische Vorhersagen trifft und warum Glück immer Ordnung braucht.