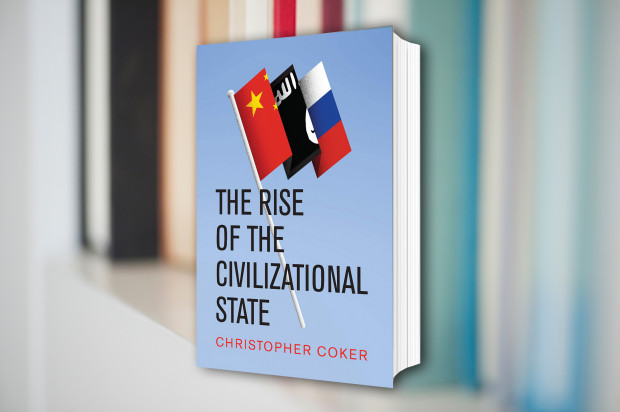Wie man allgemein beobachten kann, geht die Epoche einer europäisch-westlichen Hegemonie in der Welt ihrem Ende entgegen. Einerseits zweifelt der Westen mehr denn je an sich selber – zum Teil bis hin zum offenen Selbsthass – andererseits befindet sich namentlich Europa im demographischen Niedergang. Eine relative wirtschaftliche Stagnation im Vergleich zu aufstrebenden Ländern wie China oder Indien, eine massive Überschuldung und die Krise des Sozialstaates europäischer Prägung treten hinzu. Die Zukunft scheint anderen Kräften und Mächten zu gehören. Die USA mögen sich trotz innerer Krisen als eine von mehreren Weltmächten behaupten, der finale Niedergang Europas hingegen scheint nicht mehr abwendbar zu sein, es wird jedenfalls für den alten Kontinent immer schwieriger, zwischen globalen Mächten wie den USA und China aber auch in Konkurrenz zu aggressiven Nachbarn wie Russland und der Türkei einen eigenen Platz zu finden. Diese veränderte weltpolitische Lage ist auch das Thema des aktuellen Buches von Christopher Coker, der die Herausforderungen des Westens mit dem Begriff des Civilizational State fassen will.
Was ist der Civilizational State? Es ist ein Staat, eigentlich wohl eher ein Reich, das seine Identität definiert über eine unverwechselbare Kultur, die nicht an den Maßstäben einer vermeintlich universalen Werteordnung gemessen werden kann, eine Kultur also, deren Werte in diesem Sinne inkommensurabel sind. Eine Kultur, die überdies für sich in Anspruch nehmen kann, sich autonom entwickelt zu haben, so dass alle äußeren Einflüsse mit der Zeit so verarbeitet wurden, dass sie ein Teil der ursprünglichen kulturellen Matrix wurden. Einwanderer, so die Selbstwahrnehmung, wurden, selbst wenn sie in Form regelrechter Völkerwanderungen oder von Eroberungszügen in das Land eindrangen, doch stets so weitgehend assimiliert, dass sie am Ende von der ursprünglichen Bevölkerung nicht mehr zu unterscheiden waren. Das klassische Beispiel für ein Land, das in dieser Weise seine eigene Traditionen gleichsetzt mit einer in sich abgeschlossenen Kultur, die sich kontinuierlich über einen Zeitraum von mehr als 2000 Jahren, wenn nicht länger, entwickelt hat, ist China.
Der Westen verliert seine Vorbildfunktion
Cokers Studie konzentriert sich freilich nicht auf China, sondern seine eigentliche These ist, dass das chinesische Modell Schule macht. Immer mehr Länder wenden sich von den westlichen Ordnungsvorstellungen einer mehr oder weniger liberalen Demokratie, aber auch von der westlichen Hochkultur mit ihrem freilich brüchigen Bildungskanon als Vorbild ab, und stellen solchen Idealen ihren eigenen Kosmos von Werten gegenüber. Die einschlägigen Beispiele sind einerseits Länder, die unter dem Einfluss eines antiwestlichen Islam stehen, wozu mittlerweile nicht nur der Iran und Pakistan, sondern auch die Türkei und viele andere Länder zählen. Aber auch Russland, dessen Führung unter Putin die Distanzierung vom Westen immer stärker betont. Russland, so lautet das offizielle Geschichtsverständnis, sei ein eurasisches Land, geprägt durch das Erbe der Mongolen- und Tatareneinfälle, aber auch durch das orthodoxe Christentum, für das daher ganz andere Maßstäbe gelten müssten als für westliche Demokratien, zumal der „Westen“ mit seiner postheroischen feminisierten Kultur sich ohnehin im letzten Stadium der Dekadenz befinde. Der Chefideologie dieser Art von Geschichtsverständnis ist der dubiose Alexander Dugin, der mit seinen raunenden Prophetien auch in West- und Mitteleuropa eine Gemeinde von Anhängern für sich gewonnen hat, die oft Gegner von Liberalismus und Demokratie sind.
Schließlich ist an das heutige Indien zu denken, das von Hindu-Nationalisten wie Narendra Modi regiert wird, die die Identität eines Landes unendlich vieler Sprachen und ethnischer Gruppen ausschließlich über den Hinduismus definieren wollen. Für Muslime, Christen oder andere Minderheiten ist in einem solchen Land dann eigentlich kein Platz mehr. Dem Hindu-Nationalismus fällt es schwerer als dem Neo-Osmanismus von Erdogan an ein Großreich der Vergangenheit anzuknüpfen, denn die Großreiche, die es in Indien in den letzten tausend Jahren gab, waren muslimisch oder zuletzt britisch, aber von der Überlegenheit der indischen Kultur über alle Rivalen ist auch er tief überzeugt, und davon, dass es die Aufgabe Indiens sei, im Dienste des Gottes Rama (einer Inkarnation von Vishnu) erneut zur spirituellen Weltmacht zu werden.
Kosmopolitismus oder Bekenntnis zur Sonderrolle Europas
Coker analysiert in seinem Buch die unterschiedlichen Varianten dieser Versuche, eine politische Ordnung durch eine vermeintlich homogene kulturelle Tradition zum Teil auch in Verbindung mit einer bestimmten Weltreligion zu legitimieren und die Identität des eigenen Landes über diese Kultur und ihre spezifischen Werte, die mit denen des Westens, wie man betont, nicht kompatibel sind, zu definieren. Aber sein Buch hat eine große Schwäche, er kann sich nicht entscheiden, wie er diese neuen Entwicklungen und die damit verbundene Schwächung des Westens am Ende bewerten soll.
Ja, er geht sogar so weit, an einer Stelle zu vermuten, dass soziale Praktiken und kulturelle Prägungen, wenn sie über einen sehr langen Zeitraum hinweg konstant bleiben, den Genpool einer gegebenen Bevölkerung beeinflussen könnten. Bekannt ist in der Tat, dass viele Chinesen unter einer Laktose-Intoleranz leiden, oder dass bei bestimmten Kasten in Indien spezifische Krankheiten häufiger vorkommen als bei anderen, was freilich auch an der verbreiteten Endogamie liegen mag. Aber Coker spekuliert darüber, dass andere, wenn auch oberflächlich betrachtet geringfügige Unterschiede im Gen-Code auch dafür verantwortlich sein könnten, dass Chinesen weniger individualistisch denken und handeln als Europäer (78). Solche Spekulationen sind nicht ungefährlich, weil man damit Gefahr läuft, ins Kielwasser von früheren Rassentheorien zu geraten, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und im 19. Jahrhundert eine recht unheilvolle Wirkung entfaltet haben.
Dem stehen aber andere Passagen gegenüber, in denen er die Versuche, eine Vision kultureller Homogenität und Gegenmodelle zum westlichen Wertekanon zu konstruieren wie in Russland und Indien als bloße Demagogie abtut. Am Ende ginge es Leuten wie Putin, Erdogan oder Modi immer nur darum, ein autoritäres Regime an der Macht zu halten, und dafür brauche man eben ein Feindbild und eine sorgfältig konstruierte Vergangenheit, die mit der wirklichen Geschichte wenig zu tun habe. Bei dieser Kritik wird allerdings China deutlich zurückhaltender behandelt. Hier scheint sich Coker in seinem Urteil weniger sicher zu sein.
Recht oberflächlich und geprägt von Plattitüden sind die Urteile Cokers über die immigrationskritischen Bewegungen in Europa, die europäische Traditionen gegen eine vermeintliche oder wirkliche „Überfremdung“ verteidigen wollen. Alle diese Bewegungen werden pauschal als „rechtspopulistisch“ und bloß demagogisch abgetan.
Und schließlich bleibt bei Coker recht unklar, wie sich Europa und der Westen insgesamt angesichts der neuen Konfliktkonstellation positionieren sollen. Offenbar sind die eigenen Werte und die eigene politische Kultur kein Vorbild mehr für den Rest der Welt. Wenn aber Europa und der Westen nur ein Zentrum neben mehreren anderen in einer multipolaren Welt rivalisierender Kulturen ist – das war auch die Position von Huntington -, dann liegt es nahe, dass der Westen sich auf das besinnt, was den Kern seiner Geschichte ausmacht, um nicht einfach zur Einflusszone fremder Imperien zu werden.
Coker lässt freilich offen, ob es einen solchen Kern überhaupt gibt, denn einen kulturellen Essentialismus („Kulturen haben ein geheimnisvolles Wesen, das über Jahrhunderte und vielleicht Jahrtausende gleich bleibt“) lehnt er ja gerade ab. Pseudo-Propheten wie Dugin sieht er als typische Vertreter eines solchen Essentialismus. Aber hier ist Coker nicht konsequent, denn am Ende ist es dann doch das Erbe Griechenlands und Roms, das für ihn das Spezifikum der europäischen Kultur ausmacht. In seinem Namen soll eine Botschaft des liberalen Kosmopolitismus von Europa ausgehen, die sich gegen die feindlichen „civilizational states“ genauso richtet wie gegen „Populisten“ und Vertreter antiliberaler Werte im Westen selber. Allerdings, die antike Polis oder die römische Res Publica, an deren politisches Vermächtnis Coker hier appelliert, waren alles andere als liberale Gemeinwesen in unserem modernen Sinne. Außerdem ist in Cokers Vision der europäischen Geschichte kaum Platz für das christliche Mittelalter, das er ganz im Geiste der Aufklärung nur als Zeit des Niedergangs begreift.
Coker schreibt freilich, dass in der Konkurrenz historischer Narrative, mit deren Hilfe Kulturen und Staaten sich ihrer Identität versicherten, das Master-Narrativ der europäischen Geschichte den Vorteil habe, relativ robust zu sein („It just so happens that the historical narratives which give Western civilization its shape tend to be more robust than most“, S. 67). Aber ist das plausibel, vor allem in der Perspektive, die Coker sich zu eigen gemacht hat?
Heute leiden der Westen und Europa eher unter einer Identitätskrise, wie Coker im Grunde genommen selber durch die Unklarheit seiner Positionsbestimmungen deutlich macht. Außerdem geht er auf ein Spezifikum der europäischen Geschichte gar nicht ein: Den Pluralismus von Herrschaftszentren, der schon das klassische Griechenland gekennzeichnet hatte und der sich in der Spätantike nach dem Untergang des weströmischen Reiches und im Laufe des Mittelalters schrittweise wieder durchsetzte. Sicher, nur einige der modernen Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts gingen unmittelbar aus mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Königreichen oder Republiken hervor, aber Großreiche mit universalem Herrschaftsanspruch waren anders als in der islamischen Welt, in Russland oder in Ostasien niemals die unbestritten vorherrschende Form der politischen Organisation in Europa. Deshalb kann man aus Europa auch schlecht einen „civilisational state“ werden lassen, wie es China war und ist. Was nicht heißt, dass die EU sich nicht in den nächsten Jahrzehnten immer mehr am Ordnungsmodell des Imperiums, nicht des Staates, orientieren wird.
Was bleibt als Resümee aus Cokers Buch? Der Kampf der Kulturen, den Huntington thematisiert hatte, ist kein Hirngespinst eines Untergangspropheten, er ist sehr real, weil Staaten mit imperialen Ambitionen sich diesen Kampf auf die Fahne geschrieben haben. So fragil das intellektuelle und wirtschaftliche Fundament der politischen Visionen Putins und Erdogans sein mag – was mit Blick auf die Wirtschaftskraft Chinas freilich nicht gilt und für Indien vermutlich auch nicht – so sind die „civilizational states“ Russland und die Türkei doch durchaus dazu in der Lage, Europa und besonders die EU herauszufordern und in die Defensive zu drängen, wie man ja in diesen Tagen im östlichen Mittelmeer sieht. Eine Antwort auf diese Herausforderungen oder generell auf den eskalierenden Kampf der Kulturen hat Europa aber nicht. Man findet sie auch nicht in dem Buch von Coker.
Christopher Coker, The Rise of the Civilizational State (Cambridge: Polity Press, 2019)