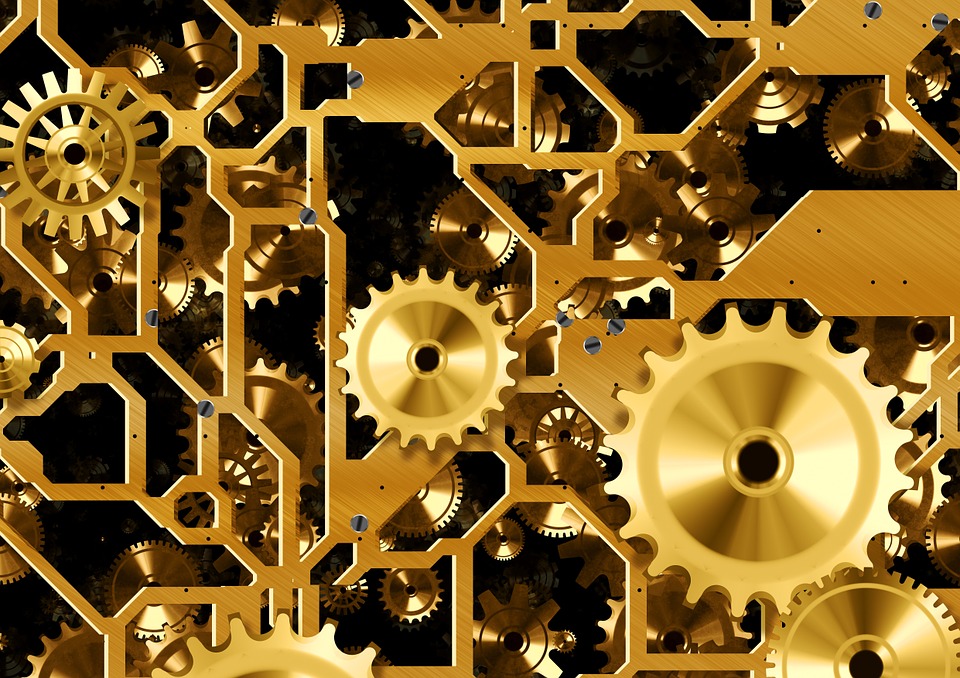Das Gefühl, dass die Mehrheitsgesellschaft einen zu hohen Preis für die vermeintliche Integration der Muslime bezahlt, hat seine Berechtigung. Grund für diese Fehlentwicklung sind diametrale Konzepte der gesellschaftlichen Kooperation.
Vor kurzem besuchte ich die Podiumsdiskussion „Last Exit Europe – Welcher Islam gehört zu uns?“. Das Thema war zwar alles andere als neu, aber sowohl die Zusammensetzung der Runde, als auch ihre Inhalte, spiegelten erstaunlich gut das Grundproblem der Integrationsdebatte, die ja in erster Linie eine Islamdebatte ist, wider. Der iranischstämmige Michel Abdollahi moderierte die Veranstaltung in aufgeheizten Momenten mit dem richtigen Witz und legte den Finger oft treffend in die Wunden der jeweiligen Diskutanten. Von diesen vertrat Michel Friedman überraschend gut die oft emotional aufgeladenen Hoffnungen und Sorgen derer, die man zum deutschen wir-schaffen-das-Bürgertum zählen könnte. Necla Kelek widmete sich der Frage dadurch, erstmal die ganz große Axt an die Theologie des Islam anzulegen. Der palästinensisch-israelische Psychologe Ahmad Mansour diagnostizierte die Lebenssituation insbesondere junger Muslime sehr nüchtern und pragmatisch als Kombination mehrerer problematischer Variablen, von denen die Religion eine, aber eben nicht die einzige ist. Mansour konnte auch als einziger in der Runde ebenso pragmatische und klar konzipierte Maßnahmen benennen, die auch die Muslime in die Pflicht nehmen. Benjamin Idriz, seines Zeichens Imam einer Moscheegemeinde im oberbayerischen Penzberg, begnügte sich dagegen mit der Rolle, sowohl die Ansätze von Necla Kelek, als auch von Ahmad Mansour, nach Kräften zu torpedieren.
Michel Friedman war deshalb so repräsentativ deutsch innerhalb der Debatte, weil sich seine Standpunkte und Erwartungen durch eine gewisse Gutgläubigkeit auszeichneten. Diese Gutgläubigkeit spiegelt sich in der grundlegenden Annahme des deutschen „Integrationsverhalten“ wider, dass alle Seiten im Bemühen um die Integration an ein und demselben Strang ziehen, um ein identisches Ziel zu erreichen. Dieses Ziel könnte man aus deutscher Perspektive so umreißen: Muslime können ihre Religion frei praktizieren, ihre Kinder erhalten Zugang zur Mehrheitsgesellschaft, damit auch die Möglichkeit, durch Bildung und Leistung in ihr erfolgreich zu sein und sind durch ihre aufgeklärte Weltsicht für Extremisten nur schwer erreichbar. Die Mehrheitsgesellschaft erhält dafür im Austausch die Gewissheit, dass die Minderheit keine bedrohlichen Kräfte hervorbringt, sondern stattdessen selbstbestimmte Individuen, die sich in erster Linie als Bürger und nur nachrangig als Angehörige einer Religionsgemeinschaft definieren. Das, was die Mehrheitsgesellschaft also verlangt, ist im Grunde das genaue Gegenteil von Diskriminierung oder Unterordnung – man könnte auch sagen, dass sie bereit ist, hier ein sagenhaftes Sonderangebot zu offerieren. Da liegt es nahe, davon auszugehen, dass die Gegenseite nicht ernsthaft in Erwägung ziehen könnte, es auszuschlagen.
Möglichst viel nehmen, möglichst wenig geben
Die Tragik dabei ist, dass hier ein grundsätzliches Missverständnis vorliegt. Natürlich wird die Integration als gesellschaftlicher Prozess in ihrem Erfolg dadurch bestimmt, welche Anstrengungen die beteiligten Gruppen für sie zu machen bereit sind. Dies wiederum bestimmt sich durch die Wahrnehmung des Nutzens, den sie sich von der Integration erwarten. Die grundlegende Divergenz zwischen der deutschen Mehrheitsgesellschaft und insbesondere den religiös organisierten Muslimen liegt in der fundamental unterschiedlichen Wahrnehmung des Nutzens der Integration begründet. „Die Muslime“, also diejenigen, die sich bewusst über ihre Religion definieren und auch vom Rest der Gesellschaft abgrenzen, sehen in der Integration in erster Linie eine Gefahr für ihre Lebensart und einen Verzicht – auf die traditionellen, patriarchalischen Familienstrukturen, auf die Kontrolle über die Bildungs- und Partnerwahl der eigenen Kinder, auf den Griff zur Religion als Mittel der Disziplinierung und sozialen Kontrolle, auf liebgewonnene Feindbilder. Was also aus Sicht „der Muslime“ vorliegt, ist ein gesellschaftliches Nullsummenspiel: Würden alle gemeinsam am Strang der Integration ziehen, würde die deutsche Gesellschaft gewinnen, die Muslime aber verlieren. Eine Situation, in der alle durch Kooperation hinzugewinnen, gibt es aus ihrer Sicht nicht. Aus diesem Verständnis heraus ist es konsequenterweise am sinnvollsten, sich egoistisch zu verhalten und so viel wie möglich von der Mehrheitsgesellschaft zu nehmen und ihr so wenig wie möglich zurückzugeben.
Benjamin Idriz verkörperte diese Haltung in der Runde wunderbar anschaulich. Problematische Elemente in der islamischen Theologie gäbe es für ihn nicht, deshalb sei es auch gar nicht notwendig, ein hinterfragendes Religionsverständnis zu vermitteln. Gegen Salafismus habe er eine schriftliche Distanzierungserklärung verfasst. Dagegen hätten die Deutschen jahrzehntelang nichts für die Muslime getan und könnten wenigstens jetzt mal etwas Geld in den Bau repräsentativer Moscheen stecken, dann wäre die Gefahr viel geringer, dass eine Radikalisierung in Hinterhofmoscheen stattfinde. Da schüttelte selbst Michel Friedman am Ende nur noch den Kopf.
Als ich so dasaß und mir diesen Unsinn anhörte, erinnerte ich mich an einen Fall in meiner Heimatstadt: Dort veranstaltet ein Stadtteil regelmäßig ein interkulturelles Familienfest. Vor einigen Jahren beschloss allerdings die dortige DITIB-Gemeinde, dass sie nur noch als Mitorganisator des Festes aktiv werden würde, wenn dort kein Schweinefleisch verkauft würde. Natürlich hatte dort nie ein muslimischer Bürger Schweinefleisch zubereiten, verkaufen, oder gar essen müssen. Es ging bei der Forderung auch nicht um das Schweinefleisch an sich. Man wollte einfach sehen, ob man damit durchkommen und der Mehrheitsgesellschaft in diesem Punkt die Gestaltung des öffentlichen Raumes diktieren könnte. Die betreffende Gemeinde hatte hoch gepokert und in diesem Fall verloren, denn die übrigen Organisatoren lehnten ein Schweinefleischverbot ab, weshalb die DITIB-Gemeinde dann tatsächlich aus ihrem Kreis ausschied. Damit hat sie natürlich ausgerechnet alle diejenigen vor den Kopf gestoßen, die sich ehrlich und aufrichtig um ein Zusammenleben aller Religionsgemeinschaften im Stadtteil bemüht hatten. Aber dieser Preis war anscheinend nicht hoch genug gewesen, um die muslimische Gemeinde von ihrem Versuch abzubringen, ihren Partnern deren Gutmütigkeit und Toleranzbereitschaft so bitter und schmerzhaft wie nur möglich zu machen.
Tribalismus
Was aber sind die Ursprünge dieser fatalen Nullsummenmentalität? Verhaltensökonomen führen rund um die Welt Experimente in Form so genannter „public goods games“ durch, um zu testen, in welchen Gesellschaften Menschen die Möglichkeiten der Kooperation erkennen und nutzen. In diesen Experimenten ist der Ertrag für jeden Spieler am höchsten, wenn alle Beteiligten hohe Summen in einen gemeinsamen Topf einzahlen. Die Einzahlungen werden dann vervielfacht und gleichmäßig an alle Spieler zurückgezahlt. Jeder Spieler kann sich also auch als Trittbrettfahrer gerieren, indem er selbst wenig einzahlt und von den Beiträgen der anderen profitiert. In westlichen Staaten kooperieren die Teilnehmer generell auf hohem Niveau. In Asien beginnen sie misstrauischer, steigern die Kooperation und damit ihren Zugewinn aber schon nach wenigen Wiederholungen des Spiels. In der Türkei und in arabischen Staaten verharrt der Grad der Beteiligung dagegen auf sehr niedrigem Niveau. Noch schlimmer: In diesen Ländern werden einzelne Spieler, die versuchen, das geringe Ausmaß der Kooperation zu durchbrechen, von den restlichen Teilnehmern bestraft. Diese Unfähigkeit, durch Vertrauen und Zusammenarbeit ein größeres Wohl für alle zu schaffen, ist kein rein arabisches oder muslimisches Problem, sondern bspw. auch in Staaten südlich der Sahara weit verbreitet. Barack Obama bezeichnet es als „tribalism“.
Trifft diese Einstellung durch Einwanderung auf die vertrauensseligen westlichen Gesellschaften, entsteht eine Situation, in der die eine Seite beständig guten Willen vorschießt, aber wieder und wieder zu wenig von der Gegenseite zurückerhält. Denn wenn ein Nullsummenspieler sich gewiss ist, dass sein Gegenüber immer noch bereit ist, in der Hoffnung auf einen Sinneswandel etwas auf den Tisch zu legen, wird er dies umso unnachgiebiger ausnutzen. Trotzdem versuchen Deutschland und andere europäische Gesellschaften nun seit mindestens fünfzehn Jahren ausgerechnet dieser Einstellung auch noch beschwichtigend (oder „tolerant“) entgegenzukommen. Erstens hat dies dazu geführt, dass man es jetzt mit einer viel größeren und breiter verwurzelten Radikalisierungsbewegung als noch 2001 zu tun hat. Deshalb befinden sich Präventionsprojekte wie das unter der Leitung von Ahmad Mansour ja im Dauereinsatz, um die Schäden dieser Ignoranz in Schach zu halten. Zweitens hat man genau diejenigen Muslime marginalisiert, die erkannt haben, dass die Nullsummenmentalität früher oder später zum Schaden für alle wird und sie deshalb innermuslimisch kritisiert und überwunden werden muss. Drittens wurde jede Menge guter Wille insbesondere derjenigen, die bereit waren, im Alltag offen für die Integration einzutreten, in den Wind geschlagen. Irgendwann könnte dann niemand mehr da sein, der sich dagegen wehrt, dass die Gesellschaft vollends in misstrauische Grüppchen zerfällt.
Wer glaubt, durch das fortgesetzte Verkennen dieses Irrtums und der Verweigerung eines Umdenkens etwas für das Zusammenleben in Deutschland zu gewinnen, täuscht sich leider gewaltig. Es ist dabei immer wieder überraschend, wie verbreitet das Wissen um die richtigen Knöpfe, die man bei den Deutschen drücken muss, anscheinend ist. Erinnert sich noch jemand an Reem, das vierzehnjährige Mädchen, das zusammen mit seiner Familie aus dem Libanon „fliehen“ musste und während einer Fragestunde mit der Bundeskanzlerin vor laufenden Kameras in Tränen ausbrach? Wer weiß, vielleicht hatte dieser Auftritt Frau Merkel dazu bewegt, danach ein freundliches Gesicht zu zeigen. Jedenfalls hat Reem schon sehr gut begriffen, wie der Hase läuft, denn während sie einerseits darauf drängte, das Asylrecht ein wenig zu Gunsten ihrer Familie zu dehnen, äußerte sie außerdem an anderer Stelle den Wunsch, dass Israel von der Landkarte verschwinden möge. Von einem Welt-Reporter darauf hingewiesen, dass die Deutschen beim Thema Israelauslöschung ein klein wenig empfindlich seien, entgegnete sie: „Ja, aber es gibt Meinungsfreiheit, hier darf man das sagen.“ Immerhin weiß sie, was ihre Grundrechte sind – da hat sich die Gutmütigkeit doch gelohnt. Auf der Website der Welt kann man ihre Aussagen zu Israel und zur Meinungsfreiheit übrigens nicht mehr nachlesen – der Artikel ist zwar noch online, aber die betreffenden Zeilen wurden irgendwann kommentarlos gelöscht. Das Internet vergisst jedoch nicht: Hier! Und konfrontiert uns mit der Frage: Sind wir Teil der Lösung – oder Teil des Problems?
Andreas Backhaus arbeitet in München an seiner Promotion zu den Themen Entwicklungsökonomie und internationale Wirtschaftsbeziehungen.