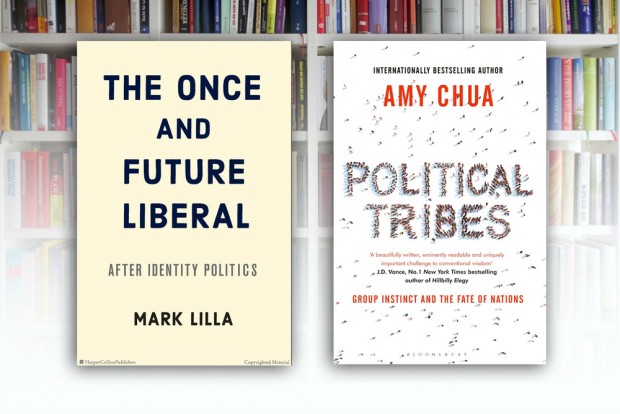Wenn man das Programm der heutigen postmodernen und postmarxistischen Linken auf einen Nenner bringen will, dann ist es der der Identitätspolitik. Die Politik konzentriert sich nicht mehr auf die vermeintliche Befreiung der sozial Schwachen oder gar der mythischen Arbeiterklasse, sondern auf ganz spezifische gesellschaftliche Opfergruppen, die nicht über ihr Einkommen oder durch sozialen Status definiert sind, sondern durch zugeschriebene soziale Merkmale, also durch ethnische Identität, Geschlecht und Hautfarbe zum Beispiel – nichts, was man im Laufe des Lebens erworben hat. Hinzu tritt noch die sexuelle Orientierung, bei der auch unter den Vertretern der Identitätspolitik bis zu einem gewissen Grade strittig ist, ob sie angeboren oder Ergebnis einer bewussten Wahl und Entscheidung ist, wobei der bei der heutigen Linken vorherrschende radikale Konstruktivismus grundsätzlich dahin tendiert, sexuelle Orientierung als eine Form der freiwilligen Selbstinszenierung zu betrachten.
Die Identitätspolitik ist in den USA entstanden und hat dort auch heute noch ihre meisten Anhänger, breitet sich aber zunehmend in dem Maße nach Europa aus, wie die linken Parteien ihre alte Machtbasis in der Arbeiterschaft und den Gewerkschaften verlieren und sich eine neue Klientel suchen müssen. Hinzu tritt das wohlige Schuldgefühl eines linken Bürgertums, der „bobos“ (bourgeois bohemiens), wie man sie in Frankreich nennen würde, gegenüber Minderheiten jeder Art, das sich zugleich mit einer Abneigung gegen allzu hohe Steuern und einen allerdings ohnehin nicht mehr bezahlbaren Ausbau des Sozialstaates verbindet. Wenn man aber keine zusätzlichen Sozialleistungen mehr bieten kann, worin kann dann linke Politik bestehen? In der Vergabe von Sonderrechten für vermeintlich oder auch wirklich diskriminierte Minderheiten, denn das kostet rein fiskalisch zunächst einmal nichts. Die Universitätsprofessur muss der Staat in jedem Fall bezahlen, egal ob sie von einem Mann besetzt wird, oder von einer Frau, der vielleicht auch eine bewusste Gleichstellungspolitik zum Erfolg verholfen hat.
Was ist das oberste Prinzip der Identitätspolitik? Es ist die Vorstellung, dass die Gesellschaft aus Opfergruppen und aus Tätern besteht. Täter sind, ein wenig überspitzt formuliert, vor allem weiße heterosexuelle Männer, Opfer fast alle anderen, also Frauen, ethnische Minderheiten, Homosexuelle oder Personen mit ambivalenter sexueller Identität, die sich selbst einem dritten Geschlecht zuordnen. Aufgabe der Täter ist es, sich schuldig zu bekennen und rituell Buße zu tun, oder aber, noch wichtiger und vor allem erfreulicher, andere noch nicht bußfertige Täter zu ermahnen und permanent zu belehren, während die Opfer Fürsorge verdienen und ein Anrecht auf Vorzugsbehandlung haben. Das gilt auch dann, wenn dem einzelnen Angehörigen der Opfergruppe persönlich nie etwas Böses im Leben widerfahren ist, denn die Zugehörigkeit zur Opfergruppe erwirbt man in der Regel bei der Geburt, das Lebensschicksal ist dafür zweitrangig oder ganz gleichgültig. In diesem Sinne ist etwa in den USA eine afroamerikanische Tochter eines Chefarztes per definitionem Opfer, während der Sohn eines arbeitslosen weißen Stahlarbeiters aus Illinois, dessen Urgroßvater aus Irland in die USA eingewandert war, in jedem Fall Täter ist, der sich für die Sklaverei und die lange Unterdrückung der Afroamerikaner in den Südstaaten im Sinne einer „critical whiteness“ schuldig fühlen muss. Tut er es nicht, gehört er tendenziell zu den Verworfenen, den Sündern und ist schlimmstenfalls ein halber Faschist. Für die Opfer ist überdies wichtig, dass ihnen implizit die eigene Handlungsfähigkeit abgesprochen wird. Hilft man ihnen nicht durch eine positive Diskriminierung, eine Vorzugsbehandlung, dann, so wird unterstellt, könnten sie sich nicht selber aus ihrer misslichen Lage befreien, sie werden damit potentiell entmündigt. Das kann die Angehörigen der Opfergruppen, Amerika bietet dafür durchaus Beispiele, gegebenenfalls auch demoralisieren und entmutigen.
Die Krise der politischen Linken in den USA
Diese bewusst polemisch zugespitzte Skizze mag überzogen erscheinen, aber sie unterscheidet sich wenig von dem, was Mark Lilla in seinem kleinen Büchlein über Identitätspolitik schreibt und auch schon in zahlreichen Zeitschriftenartikeln publiziert hat. Lilla ist ein bekannter Politikwissenschaftler und Ideenhistoriker, der an der Columbia Universität in New York lehrt. Er ist, weiß Gott, kein Konservativer oder „Rechter“, obwohl ihm das natürlich sofort von der Linken vorgeworfen wurde, als er seine Kritik vorbrachte. Er ist ein überzeugter Anhänger der Demokraten und ein leidenschaftlicher Gegner Trumps. Was er sich jedoch fragt, ist, wie ein Mann wie Trump in seiner ganzen krassen Vulgarität und seinem Narzissmus mit seiner fadenscheinigen Demagogie je an die Macht gelangen konnte. Dafür macht Lilla die Identitätspolitik seiner Partei, der Demokraten, zumindest mitverantwortlich. Die Demokraten sind heute einerseits eine Partei des linken Bürgertums – welche linke Partei in der westlichen Welt ist das heute nicht ? – und andererseits der ethnischen und sexuellen Minderheiten und vielleicht auch noch der von unterschiedlichen Varianten des Feminismus bewegten Frauen. Für den weißen Mann der unteren Mittelschicht oder der Industriearbeiterschaft – und deren weibliche Partnerinnen – hat der Mainstream der demokratischen Partei im Grunde genommen kein Angebot mehr.
Mit Bernie Sanders als Präsidentschaftskandidat wäre das wohl anders gewesen, aber er musste sich, und das zeigt, wie vergiftet die Atmosphäre in den USA ist, im Wahlkampf von einem Mitglied des Clinton-Teams vorwerfen lassen, er sei selbst Rassist, weil er die Identitätspolitik des Clinton-Lagers ablehnte, wie Amy Chua schreibt (S. 183).
Amy Chua ist die bekannte Autorin des Buches Battle Hymn of the Tiger Mother (2011), in der sie ihre eigenen „asiatischen“ Erziehungsmethoden selbstironisch darstellte; sie lehrt Jura in Yale. Chuas Buch ist insgesamt zu sehr im Plauderton gehalten, um Analysen mit Tiefendimension zu bieten. Immerhin offeriert sie dem Leser einige interessante Beobachtungen. So stellt sie fest, dass an ihrer eigenen Universität, Yale, die „law class of 2019“ (also die Studenten, die 2019 ihr Studium abschließen werden) zwar bunter im Sinne von ethnischer und sexueller „Diversity“ sei als jemals zuvor, dass sich aber unter den rund 200 Studenten maximal drei befänden, die aus der weißen Unterschicht, die es ja durchaus auch noch gibt, stammten. Auch andere Daten zeigten, dass die weiße Unterschicht und das entsprechende Kleinbürgertum in den USA eine Schicht im Niedergang sei. Die Lebenswartung vor allem von Männern aus dieser Schicht ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gefallen, und die Chancen auf sozialen Aufstieg in der nächsten Generation sind sehr begrenzt, begrenzter wohl als bei den Latinos, von den Asiaten ganz zu schweigen, wenn auch wohl nicht kleiner als bei den Afroamerikanern (Chua, S. 172-173).
Die Identitätspolitik in den USA mag anfangs eine verständliche Reaktion auf die lange Tradition des ganz offenen Rassismus gewesen sein, die die politische Kultur der USA und auch die Gesetzgebung vieler Staaten bis in die 1960er Jahren hinein prägte, und deren fatale Nachwirkungen nicht zuletzt in Form eines afroamerikanischen Selbsthasses auch heute noch spürbar sind, das muss man ganz ehrlich zugeben. Aber heute wirkt diese Politik stark spaltend. Folgt man Chua, dann verhalten sich auch die weißen Ost- und Westküsteneliten einerseits und die weniger gebildeten und weniger wohlhabenden Weißen vor allem des Binnenlandes wie unterschiedliche Stämme. Sozialkontakte gibt es fast gar nicht und eine Heirat über die „Stammesgrenzen“ hinweg ist nahezu undenkbar. Entsprechend groß ist die gegenseitige Abneigung. Eine ganze Reihe von kulturellen Faktoren vertiefen den Graben zwischen den beiden Stämmen. Für arme männliche Weiße in den USA gibt es nach Chua einen Zuschauersport, der sie kulturell definiert, World Wrestling Entertainment (WWE), Schaukämpfe, bei denen das Ergebnis in der Regel vorher abgesprochen und alles auf die theatralische Inszenierung von hypertropher Männlichkeit zugeschnitten ist. Es wundert einen nicht, dass Trump selbst einmal (2007) bei einem Wettkampf auftrat und seinen Rivalen, den Milliardär Vince McMahon, öffentlich verprügelte, oder so tat, als würde er ihn verprügeln. Später holte er dann dessen Frau Linda in sein Kabinett. Für liberale Amerikaner gibt es nichts Befremdlicheres als die seltsamen Schaukämpfe des WWE und ganze wissenschaftliche Abhandlungen sind über dieses exotische Spektakel, das gebildeten Ostküstenamerikanern offensichtlich viel fremder ist als die in manchen Ländern noch übliche Polygamie oder ein traditioneller Ehrenmord, geschrieben worden.
Chua demonstriert an solchen Beispielen gut die kulturelle Entfremdung zwischen den unterschiedlichen „Stämmen“ der USA. Sie versucht diese Analyse auch auf andere Länder der Welt wie Venezuela – wo sie in der Chavez-Revolution einen Aufstand der Mestizen und Indios gegen die hellhäutige, „spanische“ Oberschicht und in Chavez einen linken Trump sieht – oder auf das Phänomen des Terrorismus zu übertragen, weiß hier aber oft nicht viel mehr als Anekdoten zu bieten. Für die USA selbst setzt sie darauf, dass der amerikanische Traum an den, wie sie meint, auf unterschiedliche Weise Rechte wie Linke dann doch immer noch glauben, das Land wieder zusammenführen werde. Wie das geschehen soll, bleibt aber ganz offen.
Identitätspolitik als destruktive Selbsterfahrungstherapie – gibt es einen Ausweg?
Hier analysiert Lilla dann doch etwas genauer, obwohl auch er für die Zukunft wenig klare Perspektiven zu bieten versteht. Aber seine Analyse der Genese der Identitätspolitik ist schärfer. Zum einen konstatiert er, dass es Ronald Reagan durch seinen entfesselten Wirtschaftsliberalismus gelungen sei, die politische Landschaft zu verändern. Reagan predigte einen unbegrenzten Individualismus, Ziel jedes Menschen müsse die Selbstverwirklichung durch wirtschaftlichen Erfolg sein, der Sozialstaat sei bei dieser Aufgabe nur ein Hindernis. Das war zwar in den USA eine alte, von Reagan nur neu verpackte Botschaft, aber während früher vom wohlhabenden Bürger auch Selbstdisziplin und eine Art Askese im Sinne einer calvinistischen Ethik erwartet wurde, war der Wirtschaftsliberalismus der Reagan-Republikaner durch ein zumindest implizites Bekenntnis zu einem fröhlichen Hedonismus geprägt, das es so zuvor in konservativen Kreisen nicht gegeben hatte.
Die Antwort der Linken darauf war die Aufforderung zu einer anderen Art von exzessivem Individualismus. In der Politik sollte es fortan nicht um bürgerliche Werte und Pflichten, sondern um die Begegnung mit der eigenen Identität gehen, Privates und Politisches wurden bewusst vermischt. Nur dann lohnte sich politisches Engagement noch, wenn man auf diesem Wege zur eigenen Identität, ob nun als Frau, Afroamerikaner, Homosexueller, oder reuiger weißer Mann, oder wie auch immer diese Identität definiert sein mochte, fand. Wer sich am politischen Prozess beteiligte, sprach jetzt auch nicht mehr als Bürger, sondern als Vertreter einer Identitätsgruppe. Die Sprachformel „Speaking as an X“ (als Frau, als Transgender-Person, als Latino etc.) setzte sich zunehmend, besonders an den Universitäten durch, und gemeint war damit, dass kein Außenstehender einen Standpunkt in Frage stellen könne, der Ausdruck einer besonderen Gruppenidentität sei (Lilla, S. 90). Von dort war es dann kein sehr weiter Schritt mehr zur Forderung, alle Äußerungen und Ausdrücke, die die besondere, rein subjektive Sensibilität einer konkreten Opfergruppe verletzen könnten, müssten verboten werden. Daraus entstand dann ein System der politischen Korrektheit, das zumindest in den Geisteswissenschaften offene Diskussionen über heikle Themen heute fast unmöglich machen.
Allerdings droht die heutige Identitätspolitik, wie Lilla deutlich macht, an inneren Widersprüchen zu scheitern, denn einerseits beharrt man auf dem naturgegebenen Opferstatus zahlreicher Identitätsgruppen, andererseits betont man genauso nachdrücklich, dass jeder Mensch sich seine Identität selber konstruieren könne, dass also weder die Biologie und die Gene noch kulturelle Traditionen, die seine Sozialisation geprägt haben, ihm oder ihr irgendwelche Grenzen setzen. Wenn ein Mann sich wie eine Frau fühlt, dann ist er eben eine Frau, und nichts wäre verwerflicher, als zu behaupten, dass bestimmte ethnische Gruppen wirtschaftlich oder akademisch auch deshalb erfolgreicher seien als andere, weil sie durch bestimmte kulturelle Traditionen geprägt sind. Das ist dann im Grunde genommen schon „Kulturrassismus“, ein heute ja sehr beliebtes Totschlagargument, in jenen Kreisen, auch in Deutschland, die zu den „Gutgesinnten“ gehören.
Identität ist für die heutige linke Politik einerseits von zentraler Bedeutung, andererseits immer fluide, hybrid, intersektional, performativ und transgressiv, wie Lilla zu recht feststellt (S. 86-87). Wer die heutigen Geistes- und Sozialwissenschaften kennt, kann diese Feststellung nur bestätigen. Diese Art kulturwissenschaftlicher Scholastik abzulehnen, ist die schlimmste Form der Ketzerei und führt geradewegs auf den geistigen Scheiterhaufen, der in den USA auch ein wirklicher sein kann, weil dann die universitäre Karriere rasch beendet ist.
Lilla betont zu Recht, dass die Identitätspolitik immer selbstbezogen bleibt. Man kann zwar vielleicht eine bunte Koalition von Minderheitsgruppen zusammenstellen, um Wahlen zu gewinnen, aber es wird einem kaum gelingen, jemanden, der selbst weder zu den bemitleideten Opfergruppen noch zur linken Bourgeoisie gehört, klar zu machen, dass es vielleicht seine Pflicht als Bürger sei, nicht nur an seine eigenen Interessen zu denken, sondern auch an die Schwächerer, denn auch die Identitätspolitik selber ist ja nur Ich-bezogen. Lilla fordert daher die Rückkehr zu einem republikanischen Ethos, das nicht an tribale Gruppen, sondern an Bürger appelliert, die vor allem auch Pflichten, und nicht nur Rechte haben. Ob das in der gegenwärtigen Lage erfolgversprechend ist, sei dahingestellt.
Relevanter könnte zumindest für die politische Linke sein Hinweis darauf sein, dass die wichtigsten Führer der Bürgerrechtsbewegung und der politischen Linken in den 1960er Jahren an der Universität eben keine identitätsbezogenen Fächer studiert hatten, sondern solche Disziplinen, die sie einerseits mit dem Erbe der europäischen Aufklärung und andererseits mit den Glaubensinhalten und der exegetischen Tradition eines radikalen Protestantismus vertraut machten. Heute würde ein Martin Luther King nicht Theologie, sondern eher Black Studies studieren und Angela Davies, statt Philosophie feministische Kulturwissenschaft. Die Möglichkeit an einen Wertekanon zu appellieren, den auch die Gegenseite potentiell teilt, hätten sie dann nicht mehr, und das ist der Unterschied zu den 1960er Jahren.
Aber auch hier wird Lillas Appell wohl auf taube Ohren stoßen, in Europa genauso wie in den USA. Vor kurzem ging eine Meldung durch die Medien, dass das Institut für Philosophie an der Universität Oxford sich nun entschlossen habe, nicht nur eine Professur für feministische Philosophie einzurichten – worüber man vielleicht noch diskutieren könnte – , sondern auch für alle Lektürelisten in den Kursen und Seminaren einen Pflichtanteil von 40% für Werke und Studien von weiblichen Autorinnen zu verlangen. Sonst, das ist die Logik, die dahinter steht, seien Frauen offenbar vom Philosophiestudium zu leicht abgeschreckt oder gar überfordert. Oxford ist immerhin die wohl zweitbeste englische Universität. Zwar war es im Vergleich zu Cambridge, seinem Rivalen, in seiner Geschichte oft eine Hochburg der Gegen-Aufklärung, aber diese Kapitulation vor den Forderungen einer bis ins Absurde gesteigerten akademischen Identitätspolitik zeigt, dass der Prozess der Selbstdemontage der Geisteswissenschaften auch in Europa bereits begonnen hat. Ob man ihn wird stoppen können, ist mehr als ungewiss. Hier werden jedenfalls die sanften Ermahnungen eines Mark Lilla nicht reichen, da braucht man wohl doch die härtere und oft recht bittere Medizin, die ein Jordan Peterson – ein kanadischer Psychologe, der sich durch seinen Widerstand gegen die vorherrschende Ideologie der politischen Korrektheit einen Namen gemacht hat – verabreicht.
Mark Lilla, The Once and Future Liberal: After Identity Politics, New York 2017, 145 S.
Amy Chua, Political Tribes: Group Instinct and the Fate of Nations, New York 2018, 293 S.